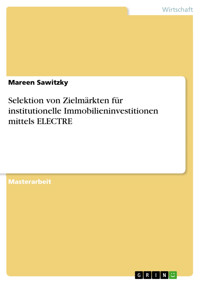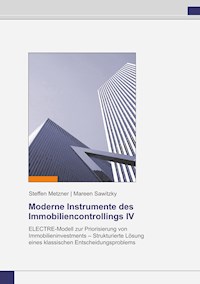
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Moderne Instrumente des Immobiliencontrollings
- Sprache: Deutsch
In Zeiten volatiler Immobilienmärkte und einer hohen Wettbewerbsintensität der Immobilienbranche sind leistungsfähige Systeme der Planung, Steuerung, Kontrolle und Informationsversorgung unverzichtbar. Das Immobilien- und Portfoliocontrolling unterstützt diese Aufgaben durch eine integrierende Gesamtkonzeption, leistungsfähige Analysetools und Beratungsleistungen. Ein signifikanter Entwicklungsbedarf besteht im Bereich der Planung und Entscheidungsunterstützung. In zunehmendem Maße müssen bisher intuitiv getroffene, oft subjektiv geprägte Entscheidungen rational begründet und gut dokumentiert werden. Immobilienwirtschaftliche Entscheidungsmodelle können dabei nicht auf den einfachen Renditevergleich reduziert werden. Bei Investitionsentscheidungen sind regelmäßig diverse Kriterien parallel zu beachten, beispielsweise Eigenschaften des Standortes, der Objektqualität und der Finanzebene. Unterschiedliche immobilienwirtschaftliche Investitionsalternativen können pro Kriterium durchaus gegensätzliche Eigenschaften aufweisen. Für diese typische immobilienwirtschaftliche Entscheidungssituation stellen erweiterte Entscheidungsmodelle aus der Gruppe der multikriteriellen Verfahren geeignete Lösungsansätze zur Verfügung. Speziell die Untergruppe des Outranking beschäftigt sich mit der stringenten Strukturierung, Ordnung und Priorisierung von mit Standardkennzahlen kaum vergleichbaren Alternativen. Als spezifische immobilienwirtschaftliche Fragestellung dient im hier vorgestellten Modell die Auswahl und Priorisierung von Zielmärkten durch das Portfoliomanagement eines internationalen Immobilienfonds. Da nicht alle denkbaren Immobilienmärkte zeitgleich und mit gleicher Intensität bearbeitet werden können, muss im taktischen Bereich der Akquisition eine Priorisierung von Märkten stattfinden. Modelle der Entscheidungsunterstützung müssen die relevanten Daten zu Volkswirtschaft, Rechtssystem, Immobilienmarkt und weiteren Faktoren so erfassen und verarbeiten. Die Formalisierung des Entscheidungsproblems "Priorisierung von Zielmärkten" erfolgt an dieser Stelle mit dem ELECTRE-Verfahren, womit unterschiedliche Konstellationen sehr gut abzubilden sind. Dazu werden die einzelnen Schritte, Kennzahlen und Algorithmen ausführlich und nachvollziehbar erläutert. Unabhängig vom hiermit berechneten Beispielszenario ist eine Übertragbarkeit auf andere Märkte, Marktzyklen, Rahmenbedingungen oder Fragestellungen gegeben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.immobiliencontrolling.de
Inhaltsübersicht
Vorwort: Modulares Immobiliencontrolling
1. Einsatz immobilienökonomischer Modelle zur Entscheidungsunterstützung
2 Priorisierung von Zielmärkten als typisches multikriterielles Entscheidungsproblem im Immobilienportfoliomanagement
3 Prämissen für ein Entscheidungsmodell zur Priorisierung von Zielmärkten nach dem ELECTRE-Ansatz
4 Schrittweise Entwicklung eines ELECTRE-Modells zur Priorisierung von internationalen Immobilienmärkten
5 Ergebnisinterpretation und Implementierung des ELECTRE-Modells im Immobilienportfoliomanagement
6 Zusammenfassung und Ausblick
Quellen und Verweise
Vorwort: Modulares Immobiliencontrolling
In Zeiten volatiler Immobilienmärkte und einer hohen Wettbewerbsintensität der Immobilienbranche sind leistungsfähige Systeme der Planung, Steuerung, Kontrolle und Informationsversorgung unverzichtbar. Das Immobilien- und Portfoliocontrolling unterstützt diese Aufgaben durch eine integrierende Gesamtkonzeption, leistungsfähige Analysetools und zielgerichtete Beratungsleistungen.
Insbesondere bei internationalen Immobilienportfolios und aktiven Investmentstrategien steigt die Komplexität der notwendigen Datenrecherche, Auswertung und Interpretation. Daraus resultiert ein hoher Bedarf an leistungsfähigen Fachkonzepten und Softwarelösungen. Aber auch bei einer weniger aufwändigen Struktur – etwa einem Portfolio aus zehn Büroimmobilien im Inland oder bei einem klassischen Wohnungsunternehmen – kann nicht einfach eine gleichmäßige, vorhersehbare Entwicklung der Liquidität und Performance vorausgesetzt werden. Das Controllingsystem muss die jeweiligen Chancen und Risiken erkennen und verarbeiten. Immobilienwirtschaftliche Entscheidungen können demnach nicht „aus dem Bauch heraus“ erfolgen. Hohe Anlagevermögen, immanente Risiken und die Verantwortung gegenüber Eigentümern, Nutzern, Mitarbeitern und anderen Stakeholdern verlangen, dass das Management konsistente Strategien verfolgt, Informationen erhebt, Daten aufbereitet und Alternativen mit Hilfe von Tools und Kennzahlen bewertet. Die in einem modernen Management- und Controlling-System erreichbare Transparenz unterstützt nicht nur die oberste Führungsebene. Sie bildet zudem eine wichtige Grundlage für die Kommunikation im internen Team sowie gegenüber externen Partnern.
Das Immobiliencontrolling widmet sich dabei zunehmend Fragen der Planung und Entscheidungsunterstützung. Im Vordergrund steht die Bewertung von Handlungsoptionen und die Ableitung entsprechender Empfehlungen. Mögliche Maßnahmen und Entscheidungen zur Optimierung des Portfolios können nicht mit „Trial and Error“-Methoden getestet werden. Dazu sind die Vermögenswerte zu hoch und die notwendigen Beobachtungszeiträume zu lang (Stichwörter: Unteilbarkeit der Assets, Time Lags, mehrjährige Zyklen). Vielmehr müssen Alternativen hinsichtlich ihres Erfolgs- und Risikobeitrages stets vorab bewertet werden. Eine vollkommene Sicherheit ist zwar nicht erreichbar, jedoch können methodische Verbesserungen die Entscheidungsqualität signifikant verbessern. Der Ausbau der jeweiligen Analysemethoden ist nur ein erster Schritt, ebenso wichtig ist eine gute Integration in das Immobilienunternehmen bzw. dessen Portfoliomanagement.
Immobiliencontrolling beschäftigt sich nicht als einzige Instanz im Unternehmen mit der Erstellung von Analysen, Kennzahlen, Reports und Empfehlungen. Oftmals wird nicht einmal eine eigene Abteilung mit der Bezeichnung „Immobiliencontrolling“ bzw. „Portfoliocontrolling“ zu finden sein. Die Institutionalisierung ist jedoch nicht entscheidend, vielmehr kann das mit dem Controlling verbundene Aufgabenspektrum auch über eine Verteilung und Vernetzung abgedeckt werden. Je nach Organisationsstruktur sind hierfür Bereiche wie das Risikomanagement, das Rechnungswesen, das Portfoliomanagement, das Asset Management, das Research, das Marketing, das Transaktionsmanagement, die Finanzplanung oder die taktische Portfoliosteuerung relevant. Bei der genaueren Betrachtung der einzelnen Stellen und Abteilungen zeigen sich Überschneidungen, Wechselwirkungen und Ergänzungen zum Kernbereich des Immobiliencontrollings. Für die Wirksamkeit des Management-System ist die individuelle Stellenzuordnung nicht entscheidend. Wichtig ist vielmehr, dass ein schlüssiges Gesamtkonzept zum Immobilien- und Portfoliocontrolling existiert und dieses auch organisatorisch umgesetzt wird.
Aufgrund der Heterogenität von Immobilienportfolios, Managementsystemen und Rahmenbedingungen kann die Literatur keinen vollständigen, allgemeingültigen Controllingstandard vorgeben. In den verfügbaren theoretischen Grundlagen zum Immobiliencontrolling werden jedoch
wichtige Abgrenzungen vorgenommen (z. B. Objektsicht vs. Subjektsicht),
zentrale Begriff definiert (z. B. Vermietungsstand, Kennzahlensystem),
notwendige Entwicklungsschritte beschrieben (z. B. Top-Down-Ansatz).
Allgemein gesehen, schafft das Immobiliencontrolling ein Informationsverarbeitungssystem, welches die Immobilie bzw. das Portfolio ganzheitlich und kontinuierlich erfasst, Abweichungen von Zielvorgaben erkennt und alternative Lösungsmöglichkeiten beurteilt. Immobiliencontrolling lässt sich grundsätzlich nicht auf Einzelaktivitäten beschränken, sondern es muss zu einer logischen, geschlossenen Gesamtkonzeption ausgebaut werden. Innovatives Controlling orientiert sich heute nicht mehr an der Abarbeitung traditioneller Kostenrechnungsmodelle, sondern stellt die vom Management benötigten internen Beratungs- und Serviceleistungen flexibel und in einer hohen Qualität bereit. Ausgangspunkte sind immer vorgegebene, i.d.R. langfristige Eigentümerziele. Immobilien werden in der Betrachtung entsprechend instrumentalisiert. In diesem Sinne ist Immobiliencontrolling ein ganzheitliches System zur Durchsetzung von Eigentümerzielen, welches selbständig und kontinuierlich bei Immobilien unter Beachtung ihres Umfeldes entsprechende Aufgaben der Information, Planung, Steuerung und Kontrolle definiert und wahrnimmt.1
Immobiliencontrolling installiert im Management einen ganzheitlichen Informationsverarbeitungsprozess. Dieser vernetzt die existierenden System-Elemente wie Funktionen, Aufgaben, Daten, Prozesse und Instrumente. Es entsteht ein kontinuierlich ablaufender Algorithmus folgender Art:
Beobachtung von Eigenschaften der Immobilie selbst, des Managements sowie des Umfeldes,
Generierung von Signalen bzw. Empfehlungen in Form von Kennzahlen, Daten, Charts und Berichten,
Ableitung und Bewertung von Entscheidungsalternativen unter Einbeziehung von Vorgaben des Eigentümers und weiterer relevanter Rahmenbedingungen,
Umsetzung von Maßnahmen zur Veränderung der Immobilien, der Portfoliostruktur, des Managements und in Ausnahmefällen auch des Umfeldes.
Unternehmensspezifische Controllingsysteme werden in individuellen Projekten konzeptionell entwickelt und anschließend im immobilienökonomischen Managementsystem implementiert. Dabei werden allgemeine Modelle und Standards soweit angepasst und konkretisiert, dass sie die vorgegebenen Ziele und festgestellten Rahmenbedingungen bestmöglich unterstützen. Zu beachten sind dabei die nutzbaren Ressourcen, welche für die Entwicklung und den laufenden Betrieb des Systems tatsächlich zur Verfügung stehen. Controllingsysteme sind daher immer Unikate.
Der Ausschluss eines universell einsetzbaren Controllingsystems muss jedoch nicht die grundsätzliche Abkehr von jeglicher Standardisierung bedeuten. Eine Lösung bilden vordefinierte Controllingmodule, welche die geforderte Qualität mit der notwendigen Flexibilität vereinbaren. Controllingmodule stellen ausgereifte Lösungen für abgegrenzte Teilprobleme dar. Geeignete Module werden im jeweiligen Anwendungsfall aus einer „Controlling-Tool-Box“ selektiert und zu einem individuellen Controllingsystem kombiniert.
Eine solche Controlling-Tool-Box entsteht durch Kombination wissenschaftlicher Studien, praxisnaher Fachkonzeptionen, marktgängiger Softwareanwendungen, verfügbarer Datenbanken und spezifischer Beratungsangebote. Inhaltlich bietet sie dem Portfoliomanagement und Controlling eine Auswahl an Basismodulen und Spezialmodulen an. Basismodule unterstützen grundlegende Funktionen und Prozesse. Sie werden daher in den meisten Controllingsystemen eingesetzt. Dazu zählen u.a. Kennzahlensysteme, DCF-Kalkulationen, Bewertungsverfahren, Benchmarking-Systeme, Balanced-Scorecard-Lösungen und Modelle der Entscheidungsunterstützung, die u. a. in diesem Buch besprochen werden.
Spezialmodule können je nach Situation und Bedarf das Basissystem ergänzen. Eine Gesamtaussage zum Risiko des Portfolios lässt sich z. B. mittels Checklisten, Scoring-Modellen, Monte Carlo-Simulationen oder Value-At-Risk-Modellen erzeugen. Hierbei besteht eine gewisse Wahlfreiheit. Die Entscheidung wird u.a. von der Zielstellung, der Interpretierbarkeit (Know How) und den Ressourcen (Software, Daten, Personal) beeinflusst. Andere Spezialmodule werden vielleicht nur in besonderen Situationen benötigt (z. B. Conjoint-Aalysen zur Produktoptimierung) oder setzen bestimmte Vorsysteme voraus (z. B. Portfolioanalysen mit spezifischem Datenbedarf aus der Objektebene).
Abbildung 1: Entwicklung von Controllingsystemen auf Basis von Controllingmodulen
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Metzner: Immobiliencontrolling2
Eine wissenschaftliche Bearbeitung des Themas „Immobiliencontrolling“ wurde erst Ende der 1990er Jahre wahrnehmbar und zeigte seitdem eine stetige Weiterentwicklung. Auf einer ersten Stufe entstanden grundlegende, themenübergreifende und strukturorientierte Publikationen zum Immobiliencontrolling. Sie präsentierten ganzheitliche Konzeptionen, welche sich am Lebenszyklus der Immobilie orientieren3 oder den Aspekt der Informationsverarbeitung in den Vordergrund stellen.4 Für ein einführendes Studium zur grundsätzlichen Konzeption, den wichtigsten Entwicklungsschritten sowie möglichen Ausbaustufen sei auf diese Grundlagenwerke verwiesen, an dieser Stelle soll auf eine detailliertere Einführung in das Immobiliencontrolling verzichtet werden.
Neben den bekannten immobilienspezifischen Quellen ist immer auch die Lektüre allgemeiner betriebswirtschaftlicher Controlling-Literatur zu empfehlen. In anderen Wirtschaftsbereichen finden sich diverse Controllingansätze als Vorlage. Die in dieser Literatur beschriebene Philosophie des Controllings kann oft auf den Immobilienbereich übertragen werden. Dies umfasst im Einzelnen auch zahlreiche Instrumente und Kennzahlen, insbesondere wenn diese strategisch ausgerichtet sind. Häufig entstehen auf dem Weg der Übertragung, Anpassung und Weiterentwicklung neue Lösungen.
Die hier weitergeführte Reihe „Moderne Instrumente des Immobiliencontrollings“ widmet sich spezifischen Modulen des Immobiliencontrollings. Mit jedem Band stellen wir innovative, immobilienwirtschaftlich anwendbare Lösungen im Detail vor, wobei jedoch stets auch der Gesamtkontext erläutert wird. Wir greifen damit den Ansatz einer „Controlling-Tool-Box“ auf, für die einzelne Instrumente zu definieren sind. Diese können später für das individuelle Controllingsystem ausgewählt und entsprechend kombiniert werden.
Im Band I der Reihe stellten wir mit der „DCF-Bewertung“ und dem „Kostenbenchmarking“ zwei erste Module vor.5 Das erste Modul zeigte die schlüssige Ableitung eines am Cash Flow orientierten Ertragswertverfahrens ausgehend vom klassischen Ertragswertverfahren nach ImmoWertV (Ansatz der Nachhaltigkeit). Dabei stellte sich heraus, dass die Ergebnisse deutscher und angelsächsischer Verfahren – eine entsprechende Umrechnung der Parameter vorausgesetzt – durchaus identisch sein können. Für diverse Fälle wurden Mängel der WertV-Ansätze nachgewiesen. Das zweite Modul „Kostenbenchmarking“ umfasste eine Fachkonzeption zur Erfassung, Analyse und Optimierung von Bewirtschaftungskosten. Dabei wurde eine Lösung entwickelt, welche die beiden Controllinginstrumente „Kennzahlensystem“ und „Benchmarking“ miteinander vernetzt. Es zeigte sich, dass eine zielgerichtete Auswertung von Großbeständen (z. B. Wohnportfolios) nur mit Hilfe mehrstufiger Kennzahlensysteme möglich ist. Entscheidend sind Definitionen und Normierungen. Eine Aussage entsteht, wenn qualitative Aspekte (z. B. Lage, Architektur, Ausstattung) und quantitative Ergebnisse (z. B. diverse Kostenarten) über Ursache-Wirkungs-Ketten in Beziehung gesetzt werden. Über Gewichtungen oder den Vergleich homogener Cluster erhält der Kostenmanager Auswertungen, welche die exakte Identifikation kritischer Objekte bieten. Speziell diese können dann zielgerichtet geprüft und optimiert werden.
Band II der Reihe widmete sich Informationsdefiziten, welche sich gerade für komplexe internationale Portfolios typisch sind. Ein aussagefähiges Reporting, wie es bei Direktanlagen im Inland Standard ist, scheitert dort oftmals an inhaltlichen, technischen oder organisatorischen Umsetzungsproblemen. Dafür ganzheitliche Lösungen zu finden, war Inhalt vorheriger wissenschaftlicher Studien und fokussierter Praxisprojekte bei Banken und Fondsgesellschaften. Die grundsätzlichen, projektübergreifenden Erkenntnisse bildeten die Ausgangsbasis für die Strukturierung eines Reportingsystems. Dabei wurden speziell für ein größeres internationales Portfolio die Auswirkungen aus der Integration von Teilportfolios, Objektgesellschaften und Holdings betrachtet. Der aus der Komplexität resultierende Reportingbedarf führte zu einem mehrstufigen Reporting-Modell, welches von organisatorischen Maßnahmen flankiert wird. Der Datenfluss geht von der Immobilienebene (Property Management) aus, berücksichtigt diverse Zwischenstufen wie Objektgesellschaften und Holdings (Asset Management) und ermöglicht schließlich Auswertungen auf der Fondsebene (Portfoliomanagement). Das gezeigte Vorgehensmodell bereitet die individuelle Umsetzung im jeweiligen Unternehmen durch Hintergrundwissen und einen theoretischen Rahmen vor. Auf zu enge Vorgaben, etwa eine Sammlung fertiger Berichts-Layouts, wurde jedoch bewusst verzichtet. Das Modell bleibt damit skalierbar. Auch sind individuelle Daten und Kennzahlen möglich. In einem Exkurs wurde der weitere Definitionsbedarf beispielhaft an der Kennzahl "Effektivmiete" demonstriert.6
Band III der Reihe behandelt mit der Balanced Scorecard ein multikriterielles Controlling-Tool, welches die einseitige Sicht auf finanzielle Kennzahlen verlässt und auch qualitative Faktoren in aktuellen Statusberichten abbildet. Eine differenzierte Betrachtung von Einflussfaktoren, Potenzialen und Risiken wird damit möglich, was am Beispiel eines Wohnungsunternehmens nachvollziehbar gezeigt wird. Die in diesem Band präsentierte immobilienwirtschaftliche Balanced Scorecard bietet dem Management ein geeignetes Controllinginstrument an, mit welchem sich auch komplexe Unternehmen bzw. Portfolios mit einem teilweise sehr breiten Analysespektrum überwachen und zielgerichtet steuern lassen. Balanced Scorecards etablieren kein separates Kennzahlensystem und sind auch nicht als reines Reporting zu verstehen. Kennzahlen spielen hier nur anteilig eine Rolle. Ebenso entscheidend sind Ziele, Vorgaben und Steuerungsprozesse, also ein aktives Management. Der eigentliche Ansatz besteht in der optimalen Nutzung von Wertschöpfungsketten entsprechend einer Strategie, wobei differierender Teilziele untereinander ausgeglichen werden sollen. Entsprechende Managementansätze werden anhand einer Case Study aus der immobilienwirtschaftlichen Praxis nachvollziehbar besprochen.
Zu den ersten drei Bänden der Reihe „Moderne Instrumente des Immobiliencontrollings“ erhielten wir zahlreiche Reaktionen, Fragen und Anregungen. Gleichzeitig hatten wir die Gelegenheit, weitere spannende Entwicklungsprojekte im Bereich Immobiliencontrolling- und Portfoliomanagement zu begleiten. Dabei konnten wir feststellen, dass das Analysespektrum der Immobilienökonomen stetig ausgebaut wird. Dies betrifft insbesondere Verbesserungen im Research und im Reporting.
Größeren Entwicklungsbedarf sehen wir im Bereich Planung und Entscheidungsunterstützung. Aus unterschiedlichen Gründen – beispielsweise der Unübersichtlichkeit von Entscheidungssituationen und Abbildungsproblemen bei komplexen Handlungsalternativen – werden in der immobilienwirtschaftlichen Praxis zahlreiche, auch wichtige Entscheidungen oft intuitiv („aus dem Bauch heraus“) getroffen.7 Sie stützen sich fallweise auf ein bestimmtes Erfahrungswissen („Marktkenntnis“), ein subjektives Empfinden („einmaliger Deal“), ein festes Handlungsmuster („Standard“) oder das abgeschaute Wettbewerberverhalten („Herdentrieb“). Auch ein solches Handeln kann – eine passende Intuition vorausgesetzt – letztendlich erfolgreich sein. In zunehmendem Maße müssen jedoch auch solche, subjektiv geprägten Entscheidungen begründet und dokumentiert werden. Entsprechende Szenariobeschreibungen, Checklisten oder Punkteverfahren schaffen zwar eine gewisse Transparenz für Aufsichtsorgane und Anleger, können jedoch unter Controllinggesichtpunkten allenfalls als Basisstufe angesehen werden.
Immobilienwirtschaftliche Entscheidungsmodelle werden oft auf den Vergleich von Renditen oder Scores reduziert. Der Fokus liegt dabei auf einer einzelnen Kennzahl. Diese einseitige Bewertung greift regelmäßig zu kurz. Tatsächlich sind bei Investitionsentscheidung stets mehrere Eigenschaften (Kriterien) wichtig. Keine Investitionsentscheidung kann ohne parallele Betrachtung von Standortqualität, Objektqualität und Rendite getroffen werden. Hinzu kommen typischerweise weitere Kriterien. Die Entscheidung ist damit nicht mehr mittels trivialer Regeln im Sinne von „mehr ist besser als weniger“ zu treffen, wenn unterschiedliche Immobilien (Alternativen) gegensätzliche Eigenschaften aufweisen. Beispielsweise könnte Investitionsalternative A die beste Rendite aufweisen. Das Objekt B befindet sich vielleicht an einem perfekten Standort. Die Immobilie C ist neu errichtet und weist – bei einer typischerweise geringeren Anfangsrendite – eine sehr hohe Bauqualität auf. Eine einfache Sortierung ist nicht mehr möglich.
Für diese typische immobilienwirtschaftliche Entscheidungssituation stellen erweiterte Entscheidungsmodelle aus der Gruppe der multikriteriellen Verfahren geeignete Lösungsansätze zur Verfügung. Speziell die Untergruppe des Outranking beschäftigt sich mit der Strukturierung, Ordnung und Priorisierung von auf den ersten Blick schwierig oder nicht vergleichbaren Alternativen. Die grundlegende Methodik muss nicht neu entwickelt werden. Vielmehr kann auf vielfältige Erfahrungen aus dem Bereich der Wirtschaft, der Technik, der Soziologie oder auch des Militärwesens und der Infrastrukturplanung zurückgegriffen werden.
Als spezifische immobilienwirtschaftliche Fragestellung dient an dieser Stelle die Auswahl und Priorisierung von Zielmärkten durch das Portfoliomanagement eines internationalen Immobilienfonds. Unabhängig von einer anderweitig vorgegebenen strategischen Portfolioallokation (z. B. Emissionsprospekt, Markowitz-Modell) muss zumindest im taktischen Bereich der Akquisition eine Priorisierung stattfinden, da nicht alle denkbaren Immobilienmärkte zeitgleich und mit gleicher Intensität bearbeitet werden können bzw. sollen. Die entsprechenden Entscheidungsmodelle müssen daher die relevanten Daten zu Volkswirtschaft, Rechtssystem, Immobilienmarkt und weiteren Faktoren so erfassen und verarbeiten, dass in der aktuellen Situation eine Rangfolge empfohlen werden kann. Die Formalisierung des Entscheidungsproblems „Priorisierung von Zielmärkten“ erfolgt an dieser Stelle mit dem ELECTRE-Verfahren, da damit unterschiedliche Konstellationen sehr gut abzubilden sind. Aktuelle Marktdaten werden dazu beispielhaft verarbeitet. Unabhängig vom hiermit berechneten Beispielszenario ist eine Übertragbarkeit auf andere Märkte, Marktzyklen, Rahmenbedingungen oder Fragestellungen beabsichtigt. Dazu werden die einzelnen Schritte, Kennzahlen und Algorithmen ausführlich und nachvollziehbar erläutert. Wichtig ist uns ein qualitativer Ausbau des immobilienökonomischen Instrumentariums im Bereich der Entscheidungsunterstützung. Das erste Kapitel greift dazu noch einmal den Status Quo auf und zeigt mögliche Ausbaustufen auf. Unterstützt wird die theoretische Argumentationskette durch die Ergebnisse einer Branchenumfrage.
Wir zeigen mit dieser Publikation anhand eines vereinfachten Beispiels typische Zielstellungen, geeignete Modelle und notwendige Entwicklungsprozesse im Bereich der Entscheidungsunterstützung. Diese dienen als Anregung für die individuelle Entwicklung von Entscheidungsmodellen, welche an die spezifischen Rahmenbedingungen wie Strategie, Management, Portfolio und Ressourcen angepasst sind. Das hier vorgestellte „Modul“ des Immobiliencontrollings soll keine Insellösung erzeugen. Übergeordnetes Entwicklungsziel bleibt stets ein ganzheitliches Controllingsystem für das individuelle Immobilienportfolio. Das multikriterielle Modell zur Entscheidungsunterstützung bildet dabei eine spezifische Lösung innerhalb einer größeren „Controlling-Tool-Box“. An weiteren Ergänzungen werden wir arbeiten.
Wir würden uns freuen, wenn unsere Reihe bei immobilienwirtschaftlich tätigen Controllern, Investoren, Fondsmanagern, Beratern, Softwareentwicklern und natürlich auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung eine interessierte und kritische Leserschaft findet. Sicher sind einige Ideen neu und noch nicht abschließend getestet. Andere Rahmenbedingungen werden weitergehende Lösungen erfordern. Unter www.immobiliencontrolling.de werden wir gern über weitere, aktuelle Studien berichten.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme und nützliche Lektüre. Über einen regen Austausch zu Erfahrungen und Ideen würden wir uns freuen.
Steffen Metzner, Mareen Sawitzky Leipzig, Frühjahr 2015
1 Vgl. Metzner, Immobiliencontrolling, 2002, S. 50
2 Vgl. Metzner, Immobiliencontrolling, 2002, S. 62
3 Vgl. Homann, Immobiliencontrolling, 1999
4 Vgl. Metzner, Immobiliencontrolling, 2002
5 Vgl. Metzner u.a., DCF-Bewertung und Kennzahlensysteme im Immobiliencontrolling, 2006
6 Vgl. Metzner u.a., Kennzahlenorientiertes Portfolio-Reporting, 2008
7 Vgl. Pommer, Entscheidungsunterstützung in der Immobilienprojektentwicklung, 2007, S. 60
Inhalt
Vorwort: Modulares Immobiliencontrolling
1 Einsatz immobilienökonomischer Modelle zur Entscheidungsunterstützung
1.1 Modelle als abstrakte Abbilder der Realität
1.2 Immobilienökonomisch relevante Modelle der Entscheidungsunterstützung
1.3 Monokriterielle Entscheidungsmodelle auf Basis der Renditebzw. Wertmaximierung
1.3.1 Investitionsrechnung mit statischen Methoden
1.3.2 Investitionsrechnung mit dynamischen Methoden
1.4 Bikriterielle Entscheidungsmodelle auf Basis von Renditebzw. Wertmaximierung sowie Risikobegrenzung
1.4.1 Rendite und einseitige, ausfallbezogene Risikomaße (Nebenbedingung)
1.4.2 Rendite und zweiseitige, schwankungsbezogene Risikomaße (Nebenbedingung)
1.4.3 Rendite-Risiko-Kombinationen (gleichberechtigte Kennzahlen)
1.4.4 Risikoadjustierte Renditen (Korrektur-Verfahren)
1.4.5 Komplexere Performancekennzahlen (Rendite-Risiko-Ratios)
1.5 Multikriterielle Entscheidungsmodelle unter Einbeziehung qualitativer Faktoren
1.6 Auswahl und Implementierung eines geeigneten Entscheidungsmodells
1.6.1 Filterung nach Leistungsfähigkeit
1.6.2 Filterung nach Ausschlusskriterien
1.6.3 Resultierende Auswahlmatrix
2 Priorisierung von Zielmärkten als typisches multikriterielles Entscheidungsproblem im Immobilienportfoliomanagement
2.1 Abgrenzung des Entscheidungsproblems
2.1.1 Zielbezogene Abgrenzung
2.1.1.1 Diversifikationsbezogene Ziele
2.1.1.2 Konzentrationsbezogene Ziele
2.1.1.3 Clusterbezogene Ziele
2.1.1.4 Pragmatische Ziele
2.1.2 Gegenstandsbezogene Abgrenzung
2.1.3 Prozessbezogene Abgrenzung
2.2 Bedarfsgerechte Entwicklung multikriterieller Entscheidungsmodelle am Beispiel der Zielmarktbestimmung
2.3 Outranking als Untergruppe der multikriteriellen Verfahren
2.3.1 Basistypen multikriterielle Entscheidungsprobleme
2.3.2 Grenzen monokriterieller Entscheidungsmodelle
2.3.3 Grenzen von Checklisten und Scorings
2.3.4 Einordnung des Outranking als multikriterielles Verfahren
2.3.5 Erweiterung des Präferenzbegriffs beim Outranking
2.4 ELECTRE als spezifisches multikriterielles Verfahren
2.4.1 Wesen des ELECTRE-Verfahrens
2.4.2 Modellierung von Präferenzen
2.4.3 Abgrenzung der Präferenzen mit Hilfe von Schwellenwerten
2.4.4 Konzept der Konkordanz und Diskordanz
2.4.5 Bisherige Anwendungserfahrungen
3 Prämissen für ein Entscheidungsmodell zur Priorisierung von Zielmärkten nach dem ELECTRE-Ansatz
3.1 Definition der ELECTRE-Version als Bewertungsverfahren
3.2 Definition der relevanten Bewertungskriterien zur Unterscheidung der Märkte
3.2.1 Auswertung bisheriger Studien
3.2.2 Notwendige Beschränkung der Datenbasis
3.3 Definition potenzieller Zielmärkte als Auswahlalternativen
3.3.1 Marktreife und Markttransparenz als vorgelagerte Filter
3.3.2 Investment- und Marktprofile als vorgelagerter Filter
3.3.3 Auswahl der modellrelevanten Immobilienmärkte
3.4 Definition des Datenfeldes
3.4.1 Ökonomisches Umfeld
3.4.2 Immobilienbezogenes Investitionsumfeld
3.4.3 Entwicklungsstand und Tiefe des Kapitalmarktes
3.4.4 Schutz des Investors und Qualität des Rechtssystems
3.4.5 Administrative Hindernisse und rechtliche Restriktionen
3.4.6 Sozio-kulturelles und politisches Umfeld
3.4.7 Übersicht Markteigenschaften
3.5 Definition des Entwicklungsprozesses
4 Schrittweise Entwicklung eines ELECTRE-Modells zur Priorisierung von internationalen Immobilienmärkten
4.1 Schritt 1: Bestimmung der Kriteriengewichte
4.1.1 Grundsätzliche Befragungstechniken
4.1.2 Einheitliche Gewichtung
4.1.3 Absolute Gewichtung
4.1.4 Point Allocation
4.1.5 Rangfolgenbasierte Gewichtung
4.1.6 Auswahl eines Verfahrens
4.1.7 Festlegung der Kriteriengewichte
4.2 Schritt 2: Bestimmung der Präferenzschwellenwerte
4.2.1 Festlegung der Präferenzschwellenwerte
4.2.2 Festlegung der Vetoschwellenwerte
4.3 Schritt 3: Überführung der Daten in die Entscheidungsmatrix
4.4 Schritt 4: Bildung von Kriteriendifferenzen
4.5 Schritt 5: Bestimmung der partiellen Konkordanzwerte
4.6 Schritt 6: Erstellung der globalen Konkordanzmatrix
4.7 Schritt 7: Bestimmung der partiellen Diskordanzwerte
4.8 Schritt 8: Zusammenführung von Konkordanz und Diskordanz
4.9 Schritt 9: Extraktion der nicht-dominierten Alternativen mittels Auf- und Abwärtsdestillation
4.9.1 Grundlegende Prinzipien des Destillationsverfahrens
4.9.1.1 Basisalgorithmus
4.9.1.2 Extraktionsverfahren
4.9.2 Bestimmung der ersten Präordnung mittels Abwärtsdestillation
4.9.2.1 Bestimmung der Outranking-Grenzwerte für die erste Abwärtsdestillation
4.9.2.2 Punktevergabe für die erste Abwärtsdestillation
4.9.2.3 Nachfolgende Abwärtsdestillationen
4.9.2.4 Ergebnis der Abwärtsdestillation
4.9.3 Bestimmung der zweiten Präordnung mittels Aufwärtsdestillation
4.10 Schritt 10: Bestimmung des finalen Rankings aus den Präordnungen
5 Ergebnisinterpretation und Implementierung des ELECTRE-Modells im Immobilienportfoliomanagement
5.1 Interpretation der Modellergebnisse im Portfoliomanagement
5.2 Modelltest mittels Sensitivitätsanalyse
5.2.1 Variation der Schwellenwerte
5.2.2 Variation der Gewichtungskoeffizienten
5.2.3 Stabilität des Modells
5.3 Methodische Eignung von ELECTRE III als Modul des immobilienökonomischen Entscheidungssystems
5.3.1 Flexible Kriterienbewertung
5.3.2 Indifferenz vs. Unvergleichbarkeit
5.3.3 Stabilität der Rangfolge
5.3.4 Intransitivität
5.3.5 Erklärungsbedürftigkeit von Methodik und Ergebnis
5.4 Anwendungspotenzial von ELECTRE im immobilienökonomischen Entscheidungssystem
5.5 Integration leistungsfähiger Entscheidungsmodelle in das Immobilienportfoliomanagement
6 Zusammenfassung und Ausblick
Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Autoren: Steffen Metzner, Mareen Sawitzky
Publikationen: Bücher zum Immobiliencontrolling
Fachliche Beratung: RES Consult GmbH
1 Einsatz immobilienökonomischer Modelle zur Entscheidungsunterstützung
Institutionelle Immobilienanleger treffen im Rahmen der Neuinvestition, bei Desinvestitionen und im täglichen Bestandsmanagement Entscheidungen, die regelmäßig größere Vermögens- und Ertragspositionen beeinflussen. Wesentliche immobilienwirtschaftliche Entscheidungen müssen dementsprechend analytisch unterstützt werden. Eine notwendige Grundlage sind geeignete Informationen (aus Erhebung, Planung), die anschließend im Sinne der Zielsetzung bewertet werden (Verdichtung, Vergleich, Priorisierung). Dabei kommen Modelle der Entscheidungsunterstützung zum Einsatz, die entsprechend leistungsfähig und nachvollziehbar sein müssen. Ein erweiterter fachlicher Anspruch entsteht aus der hohen Komplexität von Immobilienmärkten, Immobilienanlageprodukten und Bewirtschaftungsprozessen.
In der betriebswirtschaftlichen Theorie werden diverse Modelle zur Entscheidungsunterstützung beschrieben. Diese werden in anderen Branchen – wie z. B. der Finanzund Versicherungswirtschaft oder im produzierenden Gewerbe – auch praxisbezogen angewendet. Im Bereich der Immobilienwirtschaft treten dagegen oft methodische Mängel zutage. In der Untersuchung von Krisensituationen (einzelwirtschaftlich: Insolvenzen, gesamtwirtschaftlich: Preisblasen, erhöhte Volatilität) werden typischerweise Defizite im Bereich der Planung und Entscheidungsunterstützung erkannt. Auch bei unauffälligen Unternehmen und Portfolios ist eine Minderperformance aufgrund von wiederholten Entscheidungsfehlern naheliegend.
Die Untersuchung widmet sich der Frage, wie immobilienwirtschaftliche Entscheidungssituationen durch wissenschaftlich fundierte anwendbare Modelle wirksam zu unterstützen sind. Dabei werden mögliche Anwendungshindernisse gesucht und bewertet. Der Fokus liegt dabei auf Investitionsentscheidungen institutioneller Investoren. Zahlreiche Modelle sind darüber hinaus im taktischen und operativen Bereich des Immobilienmanagements einsetzbar.
1.1 Modelle als abstrakte Abbilder der Realität
Jede immobilienwirtschaftliche Investition ist notwendigerweise durch zahlreiche Parameter zu beschreiben und dementsprechend komplex. Allein die unterschiedlichen Konstellationen und Wertreiber in den Dimensionen Transaktion, Management, Finanzierung und Währung führen zu sehr individuellen, unmittelbar kaum vergleichbaren Investitionsalternativen. Dies gilt umso mehr, als dass einzelne Parameter (z. B. in der Finanzierung) zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Dennoch muss jede Investitionsvorlage entsprechend ihrer jeweiligen wirtschaftlichen Bedeutung ausreichend vorbereitet, begründet, entschieden, gesteuert und kontrolliert werden. Die gedankliche Durchdringung des realen Sachverhaltes wird jedoch häufig durch die hohe Komplexität der Realität begrenzt.8 Als geeignetes Instrument zur Komplexitätsreduktion gilt die Modellbildung. Modelle stellen strukturelle Abbilder des jeweiligen Untersuchungsgegenstandes dar, wobei man sich auf ausgewählte, relevante Aspekte konzentriert.
Immobilienökonomische Modelle beschreiben also zum einen die Wirklichkeit des Immobilienportfoliomanagements in einer abstrakten und reduzierten Form (Abbildungsfunktion, Verkürzungsfunktion). Eine pragmatische Auslegung des Modellbegriffs betont zudem die Zweckorientierung und Funktion, was zu einer Vernachlässigung weiterer, für die Nutzung nicht relevanter Eigenschaften führt. Modelle müssen dabei nicht alle Eigenschaften des Originals abbilden, sondern nur eine nutzungsadäquate Auswahl relevanter Eigenschaften (Pragmatismus, Operationalisierung). Modellen ersetzen in diesem Sinne die komplexen Originale.9
Hinsichtlich Ihrer Funktion werden betriebswirtschaftliche Modelle häufig in Beschreibungs-, Erklärungs-, Prognose- und Entscheidungsmodelle differenziert. Im Vorfeld einer ökonomischen Entscheidung sind insbesondere geeignete Entscheidungsmodelle notwendig, welche methodisch fundiert zu entwickeln sind und welche anschließend in den Investitionsprozess zu integrieren sind. Die weiteren genannten Modell-Typen korrespondieren mit dem Entscheidungsmodell im engeren Sinne. Dabei dienen Beschreibungsmodelle der systematischen Abgrenzung und Beschreibung des betrachteten Gegenstands, sie sind insofern ausschließlich deskriptiv zu sehen (Abgrenzung Aktionsraum, Prozesse, Ziele). Werden darüber hinaus Zusammenhänge (z. B. Ursache-Wirkungs-Ketten) vermutet, nachgewiesen und dokumentiert, so ergeben sich sogenannte Erklärungsmodelle. Beziehen sich diese empirischen Gesetzmäßigkeiten oder wissenschaftlichen Hypothesen auch auf zukünftige Entwicklungen, so erhält man entsprechende Prognosemodelle. Unter Beachtung von Zielstellungen und Entscheidungsprämissen lassen sich komplexe Optimierungs- bzw. Entscheidungsmodelle entwickeln.10
Die inhaltliche und strukturelle Komplexität sowie auch der potenzielle Nutzen (Aussagegehalt, Relevanz) der aufeinander aufbauenden Modelle nehmen dabei stetig zu. Die notwendige Modelldarstellung kann auf verschiedene Weise erfolgen, z. B. verbal, grafisch oder mathematisch. Wichtig ist, dass die gewählten Verfahren wichtige Modellaspekte wie Systemabgrenzung, Reduktion bzw. Abstraktion von Informationen, Dekomposition bzw. Aggregation von Teilelementen und Generalisation von Erkenntnissen unter Gewährleistung einer hohen Transparenz und Verständlichkeit angemessen unterstützen.11 Damit ein Modell nicht nur hypothetischen Charakter, sondern auch praktische Relevanz besitzt, ist eine Komplexitätsreduktion zwingend notwendig. Optionen hierfür sind die Modellzerlegung (in verschiedene, separat anwendbare Partialmodelle), die Modellverdichtung (durch Fixierung bisheriger variabler Parameter) und die Modellvereinfachung (durch Verringerung des Anspruchsniveaus, z. B. Verzicht auf bestimmte Sonderfälle). Eine Mehrfachanwendung bekannter Modelle ist bei einer ausreichenden Generalisation möglich.
Abbildung 2: Funktionen eines immobilienökonomischen Entscheidungsmodells
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Steinmann12
Speziell der Aspekt der Generalisation (Abbildung des Allgemeinen, Allgemeingültigkeit durch Vermeidung individueller Spezifika) führt zu einem Mehrwert der Modellbildung. Während reine Beschreibungsmodelle (z. B. ein Statusbericht, ein Marktbericht) primär auf die Abbildung eines singulären, beobachtbaren Objektes oder Marktes zielen, eignen sich generalisierte Entscheidungs- und Prognosemodelle für eine breite und flexible Anwendung im Bereich immobilienökonomischer Investitionsentscheidungen. Notwendigerweise müssen diese Modelle jedoch weitgehend abstrakt formuliert werden. Die Anwendbarkeit wird im konkreten Fall durch Verknüpfung mit vorgelagerten Analysen ermöglicht (Schnittstellenlösung).
Generalisierte Modelle, welche allgemeingültige Aussagen und Algorithmen beinhalten, können Definitionen u. a.
zum Entscheidungsprozess,
zur Abbildung von Entscheidungsalternativen,
zu Messgrößen bzw. Entscheidungskennzahlen sowie
zu relevanten Einflussfaktoren und Datenmodellen beinhalten.
1.2 Immobilienökonomisch relevante Modelle der Entscheidungsunterstützung
Unter dem Begriff der Entscheidungsunterstützung kann eine größere Menge an Analysemodellen, Softwarelösungen oder auch Beratungsleistungen subsumiert werden. Die Basis bilden bestimmte, noch relativ abstrakte ökonomische Grundmodelle. Diese sind für eine Bewertung zu systematisieren, womit sich Gruppen und Untergruppen ergeben, die jeweils typische gemeinsame Merkmale aufweisen und die sich gegenüber anderen Gruppen unterscheiden. Für immobilienwirtschaftliche Anwendungszwecke können bereits über eine Deduktion diverse Modelle ausgeschlossen werden (zwingende Beachtung der Langfristigkeit von Immobilieninvestitionen sowie der Heterogenität von Immobilienmärkten).
Für die Unterstützung ökonomischer Entscheidungssituationen eigenen sich Modelle, die durch die Analyse und Aufbereitung von Daten die jeweiligen Entscheidungsalternativen exakt bewerten und eindeutig priorisieren. Auf der Grundlage von Kennzahlen, Rangfolgen oder Klassifizierungen ist es somit möglich, die Entscheidung rational und nachvollziehbar zu treffen. Nach der Anzahl der entscheidungsrelevanten Kriterien lassen sich monokriterielle (z. B. Renditevergleich), bikriterielle (z. B. Rendite-Risiko-Optimierungen) sowie multikriterielle Entscheidungsmodelle (z. B. Outranking) unterscheiden.
Abbildung 3: Systematisierung potenzieller Modelle zur Entscheidungsunterstützung
Quelle: Metzner, Immobilienökonomische Entscheidungsunterstützung13
In der Praxis werden vor allem Wirtschaftlichkeits- und Investitionsrechnungen zur Identifikation der besten Investitionsalternativen herangezogen. Bei den statischen Investitionsrechnungen finden primär Kalkulationen auf Basis von Anfangs- oder Durchschnittsrenditen und häufig Kosten- und Gewinnvergleichsrechnungen Anwendung. Bei den dynamischen Verfahren werden vorrangig DCF-Kalkulationen sowie die Kapitalwertmethode und der interne Zinsfuß verwendet. Diese Methoden sind in der Praxis weitgehend akzeptiert und verbreitet.14 Diese Gruppe von Berechnungsmethoden kann den monokriteriellen Entscheidungsunterstützungsverfahren zugeordnet werden. Daneben existieren Verfahren, die die renditeorientierte Entscheidungsgrundlage um eine Risikokomponente erweitern. Entgegen den Erwartungen werden performanceorientierte Ratio-Kennzahlen und Kennzahl zur Risikoquantifizierung in der immobilienwirtschaftlichen Praxis noch wenig verwendet. Bei den multikriteriellen Verfahren sind primär Checklisten und Scoring-Modelle zu finden.15 Die Akzeptanz und weite Verbreitung von Scoring-Modellen in der Immobilienbranche ist auf die vergleichsweise einfache Anwendung zurückzuführen.16
Eine Praxisrelevanz kann somit nur für einen Bruchteil der Menge theoretischer Entscheidungsmodelle festgestellt werden. Interessant sind die Gründe, die eine immobilienwirtschaftliche Anwendung von Entscheidungsmodellen bisher (und ggf. auch zukünftig) verhindern. Die im Folgenden integrierte empirische Erhebung liefert hierfür einige Indikatoren, welche hinsichtlich ihrer Aussage teilweise konträr zum objektiven Bedarf an weiterführenden analytischen Modellen ausfallen. In den Bewertungsprozess werden theoretische und praxisbezogene Aspekte einbezogen. Ziel ist es, eine reduzierte Menge weniger, immobilienökonomisch geeigneter Entscheidungsmodelle auszuweisen. Dazu sind geeignete Kriterien zu definieren und für die Modelle zu bewerten. Insgesamt entsteht ein mehrstufiger Filter welcher qualitative (z. B. Erkenntnisgewinn) und pragmatische Aspekten (z. B. Datenverfügbarkeit) berücksichtigt.
Abbildung 4: Bewertungskriterien für potenzielle Modelle zur Entscheidungsunterstützung
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Schuh17
Parallel zur theoretischen Aufbereitung des Themas fanden im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Universität Leipzig mehrere empirische Erhebungen zu Modellen der Entscheidungsunterstützung und Planung statt, an der sich zahlreiche Experten der Immobilienbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligten. Die Erhebung erfolgte über ein Online-Portal, zu dem ausgewählte Experten mittels persönlicher Zuschrift (individualisierter Link per Email) eingeladen wurden (auswertbare Datensätze: N=204). Mehrfachantworten konnten technisch ausgeschlossen werden. Abgebrochene Befragungen wurden entfernt.
Die Teilnehmer wurden u. a. nach ihrem persönlichen Erfahrungshintergrund bezogen auf immobilienökonomische Bewertungs- und Entscheidungsmodelle befragt. Die Tätigkeitsfelder bzw. Einsatzgebiete waren dabei wie folgt:
Abbildung 5: Tätigkeitsgebiet des Teilnehmers (Mehrfachantworten möglich)
Quelle: Branchenumfrage Immobilienwirtschaft 2011/2012)
Die Angabe der Tätigkeit war ein Pflichtfeld. Im jeweiligen Unternehmen ggf. anders bezeichnete Stellen mit ähnlicher Funktion waren entsprechend zuzuordnen (ggf. nach Rückfrage oder über Zusatztexte unter „Sonstige“). Beispielsweise wurden in vielen Unternehmen in jüngerer Zeit Stellen für „Risikoanalyse/-management“ geschaffen, welche je nach tatsächlichem Aufgabengebiet den klassischen Bereichen Asset Management bzw. Portfoliomanagement zuzuordnen waren. Gleiches galt für entsprechende Controlling- und Analyse-Stellen. Im Ergebnis ordnen sich die meisten Teilnehmer der Gruppe der Immobilienbewertung zu, wobei es sich hierbei sowohl um selbständige Gutachter als auch um Angestellte größerer Immobilien- und Bewertungsunternehmen bzw. entsprechender Fachabteilungen mit eigener Bewertungskompetenz handelt (je ca. 50%).
Ziel der Expertenbefragung war an dieser Stelle die Aufarbeitung des Akzeptanzproblems, da dieses die Umsetzung theoretisch empfohlener Modelle weitgehend verhindern kann. Tatsächlich anwendbare Modelle setzen die Vereinbarkeit von theoretischer Qualität und praktischer Umsetzbarkeit (inkl. Akzeptanz) voraus.
1.3 Monokriterielle Entscheidungsmodelle auf Basis der Rendite- bzw. Wertmaximierung
Monokriterielle (eindimensionale) Entscheidungsmodelle basieren auf genau einer Zielkennzahl. Die auf eine Zahl komprimierten Bewertungsergebnisse sind für verschiedene Handlungsalternativen eindeutig vergleichbar. Diese Fokussierung des Entscheidungsproblems blendet weitere Entscheidungskriterien komplett aus oder behandelt sie nachgeordnet. Dies setzt voraus, dass die Kennzahl tatsächlich das jeweilige Entscheidungsproblem repräsentiert. Die meist finanziellen Eingangsdaten monokriterieller Entscheidungsmodelle sind häufig gut messbar bzw. ohnehin im Rechnungswesen vorhanden. Modellbezogen kommen überwiegend Investitionsrechnungen zum Einsatz, welche sich in statische und dynamische Modelle unterscheiden lassen.
1.3.1 Investitionsrechnung mit statischen Methoden
Statische Methoden der Investitionsrechnung realisieren den Alternativenvergleich anhand des Mitteleinsatzes (Kostenvergleich), des absoluten finanziellen Überschusses (Gewinnvergleich), des relativen finanziellen Ergebnisses (Renditevergleich) oder der Dauer der Mittelfreisetzung (Amortisation).
Die Methoden sind in der Praxis weithin bekannt und akzeptiert. Üblich sind insbesondere Kalküle auf Basis der Anfangs- oder Durchschnittsrendite. Dagegen haben – anders als beispielsweise in der Industrie – Amortisationsrechnungen eine geringere Bedeutung.
Abbildung 6: Kenntnis und Anwendung statischer Modelle der Entscheidungsunterstützung
Quelle: Branchenumfrage Immobilienwirtschaft 2011/2012
Insgesamt basiert die branchenbezogene Akzeptanz einer bestimmten Methodengruppe auf einer Abwägung der (festgestellten bzw. erwarteten) Ergebnisqualität einerseits sowie dem (gemessenen bzw. angenommenen) Ressourceneinsatz andererseits.
Für die Gruppe der statischen Methoden der Entscheidungsunterstützung liegen die entsprechenden Werte eher im positiven Bereich. Hinsichtlich des abgefragten Erhebungsaufwandes kann dies auch aus theoretischer Sicht nachvollzogen werden. Bezogen auf die Ergebnisqualität in der Analyse langfristiger Investitionen gelten statische Modelle in der klassischen Investitionsliteratur dagegen als theoretisch weniger gut geeignet. Die Ursache für die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis kann in einem teilweise noch vorhandenen Informations- und Ausbildungsdefizit oder aber in praktischen Anwendungsvorteilen schneller und einfacher Rechnungen vermutet werden.
Generell beanspruchen die statischen Methoden der Alternativenbewertung bzw. Investitionsrechnung nur ein Minimum an Ressourcen. Inhaltlich beruht dieser Vorteil auf einem relativ geringen Bedarf an Eingangsdaten. Personell gesehen sind die wenigen Rechenschritte sowie der überschaubare Einarbeitungsaufwand vorteilhaft. Insgesamt führt dies auch zu minimalen Kosten im Analyseprozess, wobei die Kalkulationsmodelle i. d. R. intern erstellt werden können und keine aufwändige Software oder Beratungsleistung erfordern.
Diesen Vorteilen auf der Aufwandseite ist die Ergebnisqualität im Sinne der beabsichtigten Alternativenbewertung und Investitionsentscheidung gegenüberzustellen. Die Restriktionen statischer Methoden ergeben sich zum einen aus dem sehr vereinfachten Bewertungsansatz und zum anderen aus einer häufig ungenügenden Datenqualität. Letztere entsteht aufgrund zahlreicher Pauschalierungen und unscharfer Definitionen. So sind eine durchschnittliche Ertragsangabe und deren Risiko davon abhängig, welcher Zeithorizont angesetzt wird,18 wie Ertragsverläufe prognostiziert bzw. impliziert werden und wie weitergehende Fragen wie Inflation oder Wechselkursänderungen berücksichtigt sind. Durch zu einfache Annahmen oder subjektive Einschätzungen leidet die Exaktheit der Verfahren gerade im Bereich mehrjähriger, komplexer Immobilieninvestitionen.
Geeignet sind die statischen Kalkulationen für Analysen mit kurzfristigem Zeithorizont und untergeordneter Bedeutung, beispielsweise für kleinere Modernisierungsmaßnahmen. Fallweise ist ein Einsatz statischer Methoden auch denkbar, wenn die konstante bzw. gleichmäßige Entwicklung von Erträgen angenommen werden kann. Die Ergebnisse aus Durchschnittswerten oder Anfangsgrößen weisen hierbei gegenüber aufwändigen dynamischen Kalkulationen meist nur geringe Abweichungen auf.
1.3.2 Investitionsrechnung mit dynamischen Methoden
Als gemeinsame Merkmale aller dynamischen Methoden der Investitionsanalyse gelten insbesondere der Zahlungsbezug, die dynamische Betrachtung über eine gewisse Laufzeit sowie der Barwertansatz, der eine Ab- bzw. Aufzinsung von Zahlungen beinhaltet.19
Grundsätzlich werden zunächst pro Planungsperiode die entsprechenden Zahlungsbeträge (bzw. fallweise auch andere Erfolgsgrößen) prognostiziert. Anschließend fließen diese Zwischenergebnisse in das jeweilige dynamische Modell ein und werden zur Berechnung der entsprechenden Ergebniskennzahl genutzt. Der Zahlungsbezug und deren notwendige Planungen sind wichtige Prämissen aller dynamischen Methoden.
In der Gruppe der dynamischen Investitionsanalyse finden sich zahlreiche spezifische Methoden. Die theoretische Grundlage bilden gängige Modelle wie Discounted Cash Flow (DCF), der Kapitalwert, der interne Zinsfuß (IRR) und der vollständige Finanzplan (VoFi). Das Spektrum der Lösungen beginnt bei einfachen Kalkulationen auf Basis einer einzelnen Zahlungsreihe, was nur zu einem geringen Mehraufwand gegenüber statischen Rechnungen führt. Höhere Ausbaustufen im Bereich der Vollständigen Finanzpläne sind zwar grundsätzlich sehr leistungsfähig, können aber abhängig vom betrachteten Projekt sehr komplex werden und die Analyse damit auch fehleranfällig gestalten. Die dynamischen Methoden der Investitionsrechnung und Wirtschaftlichkeitsanalyse sind weithin bekannt und akzeptiert. Insbesondere DCF-Kalkulationen finden für die Beurteilung langfristiger Investments breite Beachtung. Der Discounted Cash Flow stellt häufig die primäre Methode der Entscheidungsunterstützung dar. Dagegen werden detaillierte Varianten wie der Vollständige Finanzplan nur untergeordnet gesehen.
Abbildung 7: Kenntnis und Anwendung dynamischer Modelle der Entscheidungsunterstützung
Quelle: Branchenumfrage Immobilienwirtschaft 2011/2012
Für die Gruppe der dynamischen Methoden der Entscheidungsunterstützung liegen die abgefragten Qualitätsbewertungen überwiegend im positiven Bereich. Dagegen wird der Ermittlungsaufwand häufig als Problem gesehen, das die Anwendung erschweren oder auch verhindern kann. Diese Einschätzung der Praxis deckt sich grundsätzlich mit den theoretischen Überlegungen, wobei die Problematisierung des Erhebungsaufwands mit einer zunehmend verbesserten Transparenz und Datenstruktur zukünftig noch weiter zurückgehen sollte. Der Ermittlungsaufwand kann daher nicht als Ausschlusskriterium gesehen werden.