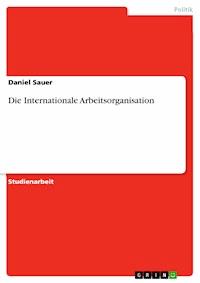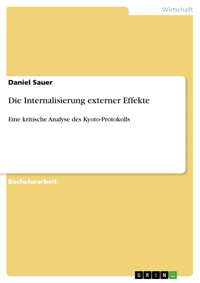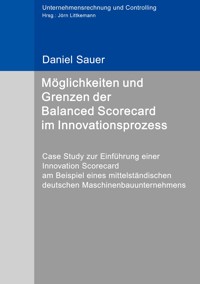
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Unternehmensrechnung und Controlling
- Sprache: Deutsch
Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung ist, dass die Verwendung von Performance Measurement sowohl in der Theorie als auch in der Praxis bislang als problematisch angesehen wird. Dieses bezieht sich aber in erster Linie auf das Kostencontrolling, weniger auf die Prozess- und Organisationsdimension des Innovationsprozesses. So besteht die Unterstützungsfunktion des Innovationscontrollings nicht nur darin, die Reduzierung der Innovationskosten sowie die Erhöhung der Qualität von Innovation zu messen und damit managen zu können, sondern darüber hinaus Instrumente für die Steuerung des Innovationsprozesses in der Organisationskultur zu verankern, damit diese überhaupt wirksam werden. Neuere Studien zeigen, dass dem Controlling sogar eine innovationsfördernde Wirkung zukommt, da es durch das Sammeln und Verteilen von Informationen die Koordinationsfähigkeit des Unternehmens erhöhen kann. Da die erfolgreiche Steuerung von Innovationen auf der Erhebung und Auswertung sowohl quantitativer und qualitativer Daten beruht, bietet sich hier grundsätzlich der Einsatz einer für Innovationen modifizierten Balanced Scorecard an. Hier setzt vorliegende Dissertationsschrift an und analysiert fördernde und hemmende Rahmenbedingungen bei der Implementierung eines Performance Measurement-Instruments in Form einer Innovation Scorecard (ISC) am Beispiel eines Implementierungsprojekts in einem familiengeführten deutschen mittelständischen Unternehmen untersucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unternehmensrechnung und Controlling, Band 19
Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Jörn Littkemann
Buchreihe
In der vorliegenden Buchreihe werden die zentralen Forschungsergebnisse (vor allem Promotionen und Habilitationen) des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensrechnung und Controlling an der FernUniversität in Hagen veröffentlicht. Dabei sind die Forschungsprojekte oftmals empirisch ausgerichtet. Im Vordergrund steht die theoriegeleitete Hypothesenprüfung praxisrelevanter Forschungsfragen in den – zumeist großzahligen – Erhebungen. Zudem wird in den Forschungsarbeiten Wert auf die Berücksichtigung wissenschaftlich bedeutender Publikationen und die Anwendung anspruchsvoller statistischer Verfahren gelegt. Daneben werden Einzelprojekte ggf. in Kooperation mit der Unternehmenspraxis durchgeführt. Ziel ist dabei, problemorientierte Controllingkonzepte zu entwickeln und entsprechende Controllinginstrumente in die Praxis zu transferieren. Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten werden überdies laufend auf wissenschaftlichen Konferenzen bzw. Fachtagungen vorgestellt und darüber hinaus in den regelmäßig erscheinenden Tätigkeitsberichten des Lehrstuhls dokumentiert.
Herausgeber
Univ.-Prof. Dr. Jörn Littkemann
Jörn Littkemann ist Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensrechnung und Controlling an der FernUniversität in Hagen. Davor war er als Wissenschaftlicher Assistent und anschließend als Akademischer Rat am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Organisation, Personal und Innovation an der Westfälischen Wilhems-Universität in Münster tätig. Nach einer Ausbildung zum Fachangestellten in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen und dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel promovierte er zum Dr. sc. pol. mit der Arbeit „Rechnungswesen und Innovationsmanagement“. Anschließend erfolgte die Habilitation im Fach Betriebswirtschaftslehre mit der Schrift „Organisation des Beteiligungscontrolling“.
Prof. Dr. Littkemann ist Autor einer Vielzahl von Büchern und Aufsätzen in in- und ausländischen Fachzeitschriften. Die Schwerpunkte seiner Forschung konzentrieren sich auf folgende Gebiete: Digitale Bildung, Gestaltung von Controllinginstrumenten und -systemen, Beteiligungs- und Konzerncontrolling, Projekt- und Innovationscontrolling, Sportmanagement und -controlling sowie ausgewählte Aspekte zur Organisation und Unternehmensführung. Ferner ist er Partner des digitalen Bildungsunternehmens APP Academic Product Partner GmbH in Emsdetten, Mitglied des Aufsichtsrats der Volksbank Münsterland Nord eG in Münster sowie als Gutachter u. a. für die Studienstiftung des deutschen Volkes, für die Einführung von Bachelor-/ Masterstudiengängen an deutschen Hochschulen, für mehrere namhafte Fachzeitschriften und für die Unternehmenspraxis tätig. In der universitären Weiterbildung engagiert er sich vor allem bei den Hagener Instituten für Managementstudien (HIMS) und für wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Weiterbildung (IWW).
Korrespondenzanschrift:
Prof. Dr. Jörn Littkemann
FernUniversität in Hagen
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,
insbes. Unternehmensrechnung und Controlling
Universitätsstraße 41 (Geb. 7)
D-58097 Hagen
Fon: +49-2331-987-4753
Fax: +49-2331-987-4865
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.fernuni-hagen.de/controlling
Geleitwort
Herr Sauer untersucht in seiner Dissertationsschrift fördernde und hemmende Rahmenbedingungen bei der Implementierung eines Performance Measurement-Instruments in Form einer Innovation Scorecard (ISC) am Beispiel des Implementierungsprojekts in einem familiengeführten deutschen mittelständischen Unternehmen.
Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist, dass die Verwendung von Performance Measurement sowohl in der Theorie als auch in der Praxis bislang als problematisch angesehen wird. Dieses bezieht sich aber in erster Linie auf das Kostencontrolling, weniger auf die Prozess- und Organisationsdimension des Innovationsprozesses. So besteht die Unterstützungsfunktion des Innovationscontrollings nicht nur darin, die Reduzierung der Innovationskosten sowie die Erhöhung der Qualität von Innovation zu messen und damit managen zu können, sondern darüber hinaus Instrumente für die Steuerung des Innovationsprozesses in der Organisationskultur zu verankern, damit diese überhaupt wirksam werden. Neuere Studien zeigen, dass dem Controlling sogar eine innovationsfördernde Wirkung zukommt, da es durch das Sammeln und Verteilen von Informationen die Koordinationsfähigkeit des Unternehmens erhöhen kann. Da die erfolgreiche Steuerung von Innovationen auf der Erhebung und Auswertung sowohl quantitativer und qualitativer Daten beruht, bietet sich hier grundsätzlich der Einsatz einer für Innovationen modifizierten Balanced Scorecard an.
Zur Beantwortung seiner Forschungsfragen wählt Herr Sauer einen empirischen Ansatz und platziert seine Schrift damit in den Bereich der erklärenden, am real existierenden Erkenntnisobjekt eines Unternehmens ausgerichteten Betriebswirtschaftslehre. Die Arbeit ist schwerpunktmäßig in die Teildisziplinen Innovationsmanagement und (Innovations-) Controlling einzuordnen, wobei – wie für fächerübergreifende Querschnittsdisziplinen wie die beiden genannten typisch – auf Ansätze, Theorien und Forschungsmethoden aus anderen betriebswirtschaftlichen Fachgebieten zurückgegriffen wird. So wählt der Verfasser für seine empirische Untersuchung einen primär aus der Organisationsforschung stammenden Fallstudienansatz, der als qualitative Forschungsmethode besonders gut für komplexe Zusammenhänge wie bei der hier zugrunde liegenden Thematik geeignet ist. Grundlage seiner Analyse der Implementierung der ISC ist vor dem Hintergrund der Theorie des geplanten Verhaltens die Befragung von 53 Projektleitern und -verantwortlichen des betrachteten Unternehmens.
Folgende maßgebende Erkenntnisse lassen sich aus der Befragung festhalten:
Je mehr persönliche extrinsische Motivatoren wahrgenommen werden, desto positiver ist die Einstellung zur Unterstützung der Einführung der Scorecard.
Je mehr persönliche intrinsische Motivatoren wahrgenommen werden, desto positiver ist die Einstellung zur Unterstützung der Einführung der Scorecard.
Die Intention zur Unterstützung der Einführung der Scorecard ist umso stärker, je positiver die Einstellung zur Unterstützung der Einführung der Scorecard ist.
Die Intention zur Unterstützung der Einführung der Scorecard ist umso stärker, je stärker die subjektiv wahrgenommene soziale Norm ist.
Die Intention zur Unterstützung der Einführung der Scorecard ist umso stärker, je stärker die wahrgenommene Verhaltenskontrolle ist.
Aus der ex post-Analyse, die vier Jahre nach Einführung der ISC mit fünf Führungskräften anhand jeweils einstündiger Experteninterviews durchgeführt wurde, lassen sich folgende zentrale Ergebnisse ableiten:
Partizipation in der Zielfindung, Definition konkreter und spezifischer Ziele sowie Zielakzeptanz und Zielidentifikation erweisen sich als wichtige Erfolgsfaktoren bei der Einführung der ISC.
Eine gute Dokumentation ermöglicht eine autodidaktische Einarbeitung von Mitarbeitenden, die nicht am Entwicklungsprozess beteiligt waren und ggf. erst danach in das Unternehmen kommen.
Die erfolgreiche Entwicklung und Einführung der ISC ist stark von Promotoren abhängig, die sich für das Projekt einsetzen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Herr Sauer eine gute Forschungsarbeit vorlegt, die sowohl die Forschung als auch die Unternehmenspraxis im Bereich des Innovationscontrollings befruchtet und wichtige Befunde für den Implementierungsprozess von neuen Controllinginstrumenten liefert.
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der FernUniversität in Hagen hat diese Arbeit im Jahr 2023 als Dissertation angenommen.
Hagen, im März 2023
Jörn Littkemann
Für Lissy & Luana
Vorwort
„Nicht alles, was man zählen kann, zählt auch. Und nicht alles, was zählt, kann man zählen.“ – Albert Einstein.
In Bezug auf das Thema dieser Studie, die Möglichkeiten und Grenzen bei der Einführung eines Performance-Measurement-Systems zum Management des Innovationsprozess zu untersuchen, bedeutet das, dass nicht alles, was für den Innovationsprozess erfolgsrelevant ist, gemessen werden kann, und nicht alles, was gemessen werden kann, auch erfolgsrelevant ist. Unabhängig davon ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor einer Innovation Scorecard, ebenso wie bei allen Controlling- und Steuerungsinstrumenten, der routinierte Einsatz des Instruments. Es kommt also – wie so oft im Leben – auf Erfahrungswerte und Wiederholungszahlen an. Als jahrelanger Profisportler kann ich dieses Zitat nur unterstreichen. Wie oft habe ich mich im täglichen Training über meine Trainer aufgeregt, weil ich als Einzelner oder wir als Team einzelne Übungen wieder und wieder wiederholen mussten, bis sie endlich perfekt funktionierten? Mit etwas Abstand waren diese Wiederholungen ein großer Erfolgsfaktor. Und ebenso ist dieses Dogma auf das „normale“ Leben wie auf viele berufliche Situationen und schlussendlich auch auf meine Dissertation zu übertragen. Es bedurfte einiges an Übung, Erfahrungen und Wiederholungszahlen, bis es sich schließlich zu vorliegendem Buch formte. Die Herausforderung in all den Jahren war immer, Möglichkeiten und Grenzen der Balanced Scorecard im Rahmen des Innovationsprozesses zu gewinnen. Und diese hat mich auch schon während meiner Zeit als Profisportler fasziniert: schon beim Handballbundesligisten HBW Balingen-Weilstetten, für den ich acht Jahre aktiv war, durfte ich zur Verfolgung unserer Ziele die Balanced Scorecard einführen und nutzen. Während und nach meiner Karriere durfte ich dann an der Balanced Scorecard in einem beruflichen und wissenschaftlichen Umfeld weiterforschen und so wichtige Erkenntnisse für Wissenschaft und Praxis ableiten – ein Prozess, der mir immer sehr viel Spaß gemacht, mich äußerst motiviert hat und nun zum Abschluss gebracht werden konnte.
Allein hätte ich diesen langjährigen und intensiven Prozess niemals zu Ende bringen können: eine Vielzahl an Menschen und langjährigen Begleitern haben einen großen Teil dazu beigetragen, das Projekt erfolgreich abzuschließen. Besonderer Dank gilt hier zuvorderst meinem Doktorvater Herrn Univ.-Prof. Dr. Jörn Littkemann, der mein Forschungsprojekt mit großem Interesse und seiner großen Expertise in allen Phasen intensiv unterstützt und begleitet hat. Ebenso habe ich Herrn Univ.-Prof. Dr. Rainer Olbrich für die Übernahme des Zweitgutachtens und die damit verbundenen wertvollen Hinweise sowie die konstruktive Kritik zu danken. Auch Herrn Univ.-Prof. Dr. Stephan Meyering gilt mein Dank, der als Drittprüfer meiner Disputation beiwohnte und somit ein wichtiger Teil meines finalen Tags an der FernUniversität in Hagen darstellte.
Weiterer Dank gilt vor allem auch meinen externen und internen Kollegen am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensrechnung und Controlling an der FernUniversität in Hagen. Durch Eure Anmerkungen und Eure Kritik in den Doktorandenseminaren habt ihr die Arbeit entscheidend vorangebracht. In diesem Zusammenhang möchte ich mich herzlich bei Herrn PD Dr. Klaus Derfuß, Herrn Dr. Michael Holtrup, Herrn Christian Geyer, Frau Janina Matern, Herrn Kristopher Pantani, Herrn Matthias Pfister, Frau Anja Holtrup, Herrn Carsten Baums, Frau Sarah Maïzi, Herrn Marko Schwarz, Frau Shaereh Shalchi, Herrn Dr. Axel Fietz, Herrn Dr. Thomas Hahn, Herrn Dr. Claudio Kasper, Herrn Dr. Stephan Körner, Herrn Dr. Tim Fronholt, Herrn Dr. Florian Oldenburg-Tietjen, Herrn Prof. Dr. Philipp Reinbacher, Herrn Dr. Axel Schröder, Frau Dr. Sonia Schwarzer und Frau Dr. Antje Tramm für die fachlichen Diskusionen, aber auch für die Abendessen und Bierrunden in Hagen und Schwerte bedanken. Ich habe mich bei Euch am Lehrstuhl immer sehr wohl gefühlt und bin von Beginn an herzlich aufgenommen worden – eine wichtige Grundlage für das Entstehen dieser Arbeit. Als extern Promovierender konnte ich die theoretischen Inhalte meines Forschungsprojektes täglich in meine praktische Arbeit einfließen lassen. Dieser Austausch mit meinen Kollegen und Kolleginnen im untersuchten Unternehmen war zu jeder Zeit von großer Offenheit und spannenden Diskussionen geprägt. Hierfür möchte ich allen am Projekt beteiligten mein großes Dankeschön aussprechen.
Einer meiner Vorgänger schrieb in seinem Vorwort: „Die Basis für all das wurde in einer glücklichen Kindheit gelegt.“ Diesen Satz möchte ich hier gerne wiederholen: denn ohne diese schöne Zeit wäre all das wohl nicht entstanden. Meinen Eltern Dr. Waltraud und Roland Sauer habe ich alles zu verdanken, was mich bis zum Abschluss meiner Dissertation gebracht hat: meinen Fleiß und meine Zielstrebigkeit habe ich neben all den anderen Dingen im Leben durch Euch gelernt. Darüber hinaus habt ihr mich immer unterstützt! Dafür bin ich Euch auf ewig dankbar! Auch meinem Bruder Julian mit seiner Frau Nadine und meinem kleinen, süßen Neffen Noah habe ich zu danken für die vielen Stunden der Abwechslung sowie die Unterstützung, z.B. beim Babysitten, wenn meine Frau Lissy und vor allem ich mal eine Auszeit brauchten. Das gleiche gilt für meine liebe Schwiegermama Maria Friedrich. Vielen Dank Euch allen! Ohne Euch würde dieses Buch nicht existieren.
Das Beste kommt wie immer zum Schluss. Widmen möchte ich dieses Buch meiner wunderbaren, kleinen DaLiLu-Familie, die ich über alles liebe: meiner Frau Lissy und unserer gemeinsamen Tochter Luana! Ihr macht mich zum glücklichsten und reichsten Menschen auf der Welt, ihr wart und seid immer für mich da – in guten wie in schlechten Zeiten! Durch die gemeinsame Familienzeit habe ich immer wieder Kraft und Energie gefunden, meinen Akku durch Eure lachenden Augen und Eure Liebe aufzutanken. Das ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Ich liebe Euch über alles und bin Euch für immer dankbar!
Würzburg, im März 2023 Daniel Sauer
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
1. Ausgangslage und Problemstellung
2. Zielsetzung der Arbeit
3. Forschungsansatz und Methoden der Datenerhebung
4. Gang der Untersuchung und Aufbau der Arbeit
Begriffliche und theoretische Grundlagen
1. Vorbemerkung
2. Innovationsbegriff und Innovationstypologien
2.1 Produkt- und Dienstleistungsinnovation
2.2 Unternehmensorientierte Innovation
2.3 Geschäftsmodellinnovation
2.4 Unterscheidung von Innovationen nach Innovationsgrad
3. Innovationsprozess und Innovationsmanagement
3.1 Innovationsprozessmodell
3.2 Innovationsmanagement
3.3 Innovationsmanager
4. Innovationsbarrieren
4.1 Personenbedingte Innovationsbarrieren
4.2 Organisationale Innovationsbarrieren
4.3 Barriereeffekte und Überwindungsoptionen
5. Innovationscontrolling
5.1 Controllingfunktion, Steuerungssysteme und Kennzahlen
5.2 Inhalt, Zweck und Einführung einer Balanced Scorecard
5.3 Innovation Scorecard
6. Schlussfolgerungen für das Forschungsdesign
Forschungsdesign und Forschungsmethoden
1. Vorbemerkung
2. Hypothesenbildung
2.1 Theorie des geplanten Verhaltens als Basis der Hypothesenbildung
2.2 Ableitung der Forschungshypothesen
3. Forschungsprozess
3.1 Aktionsforschung als Forschungsansatz
3.2 Rahmenbedingungen des Fallstudienansatzes
4. Angewandte Methoden
4.1 Ex-ante- und Ex-post-Experteninterviews
4.2 Quantitative Datenerhebung zu Einflussfaktoren der Implementierung
Projektbeschreibung
1. Vorbemerkung
2. Unternehmensprofil
3. Projektorganisation
3.1 Ablauf des Projekts
3.2 Ausgangssituation des Projekts
4. Entwicklung und Einführung der Innovation Scorecard
4.1 Schritt 1: Bedarfsermittlung
4.2 Schritte 2 und 3: Anforderungsidentifikation
4.3 Schritt 4: Festlegung der Scorecard-Struktur
4.4 Schritt 5: Kennzahlenentwicklung für die Scorecard-Dimensionen
4.5 Schritte 7 bis 11: Fixierung der Scorecard und Einführung
Befunde
1. Vorbemerkung
2. Aufbau und Ablauf der Befragung
3. Auswertung der Befragung
3.1 Deskriptive Statistik
3.2 Bivariate Zusammenhänge
3.3 Pfadanalyse und Strukturmodell
3.4 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
4. Ex-post-Projektevaluation
Schlussbetrachtung
1. Vorbemerkung
2. Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse
2.1 Analyse der Unternehmensdokumente und Projektstartinterviews
2.2 Entwicklungsprozess und Mitarbeiterbefragung
2.3 Ex-post-Projektevaluation
3. Schlussfolgerungen und Ausblick
3.1 Empfehlungen für Implementierung und Innovationsmanagement
3.2 Limitationen und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Anhang I: Ex-ante-Experteninterviews
Anhang II: Fragebogen
Anhang III: Variablenset
Anhang IV: Deskriptive Auswertung des Fragebogens zu Rahmenbedingungen und Einführungshindernissen
Anhang V: Variablenset und Auswertungen zur Faktoranalyse
Anhang VI: Interviews der Ex-post-Projektevaluation
Anhang VI: Deskriptive Auswertung der personenbezogenen Daten (Fragen bis 27)
Anhang VII: Gütemesskriterien des Gesamtmodells
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Basismodell des Innovationsprozesses
Abbildung 2: Prozessmodell der Innovation
Abbildung 3: Geschäftsmodellkonzept von Clement und Schreiber
Abbildung 4: Geschäftsmodellkonzept von Wirtz
Abbildung 5: Geschäftsmodellkonzept von Osterwalder/Pigneur
Abbildung 6: Technologie-, F&E- und Innovationsmanagement
Abbildung 7: Wirkungsmodell von Innovationsbarrieren
Abbildung 8. Struktur einer Balanced Scorecard
Abbildung 9: Innovationsmanagement-Prozess im BSC-Schema
Abbildung 10: Basismodell der Theorie des überlegten Handelns
Abbildung 11: Basismodell der Theorie des geplanten Verhaltens
Abbildung 12: Hintergrundfaktoren in der Theorie des geplanten Verhaltens
Abbildung 13: Kernmodell des geplanten innovativen Verhaltens (Pundt et al.)
Abbildung 14: Kernmodell der vorliegenden Studie
Abbildung 15: Untersuchungsmpodell im TPB-Kontext
Abbildung 16: Wirkungsfaktoren bei der Einführung einer BSC
Abbildung 17: Ablaufdiagramm des PLS-Schätzalgorithmus
Abbildung 18: Umsatzentwicklung der ZIB-Gruppe
Abbildung 19: Mission Statement von
Abbildung 20: Projektphasen
Abbildung 21: Konkretisierung der Mission und Entwicklung eines strategischen Rahmens
Abbildung 22: Innovationsprozess vor der ISC-Einführung
Abbildung 23: Struktur des Innovationsprozesses: Phasen und Tasks
Abbildung 24: Steuerungsverantwortung im Zeitverlauf
Abbildung 25: Finale ISC nach Freigabe durch Geschäftsführung
Abbildung 26: Latente Variablen hinsichtlich der Einstellung zur Unterstützung der ISC-Einführung
Abbildung 27: Zwischenmodell mit allen Items
Abbildung 28: Angepasstes Modell nach Ausschluss der Items F4T1 und F4T9
Abbildung 29: smartPLS-Auswertung der Hypothesentests
Abbildung 30: Finales Modell der Pfadanalyse
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Übersicht zur Struktur des Forschungsprozesses
Tabelle 2: Beispiel für strategische Ziele und Kennzahlen einer ISC
Tabelle 3: Beispiele für die TPB-Prädiktoren-Operationalisierung
Tabelle 4: Traditionelle Forschung und Aktionsforschung im Vergleich
Tabelle 5: Operationalisierung der intrinsischen und extrinischen Motivatoren
Tabelle 6: Operationalisierung der Implementierungsbarrieren
Tabelle 7: Operationalisierung der implementierungsfördernden Maßnahmen
Tabelle 8: Operationalisierung personenbezogener Faktoren
Tabelle 9: Detaillierte Struktur des Forschungsprozesses
Tabelle 10: SWOT-Analyse für den Innovationsprozess bei ZIB
Tabelle 11: Phasen des Implementierungsprojekts
Tabelle 12: Weiterentwickelte SWOT-Analyse des Innovationsprozesses
Tabelle 13: Ablauf der Kennzahlenbestimmung für die ISC-Dimensionen
Tabelle 14: Ergebnistabelle zur ISC-Dimension Finanzen
Tabelle 15: Ergebnistabelle zur ISC-Dimension Prozess
Tabelle 16: Ergebnistabelle zur ISC-Dimension Technik
Tabelle 17: Ergebnistabelle zur ISC-Dimension Markt
Tabelle 18: Harman’s One-Factor Test
Tabelle 19: Statistik zu extrinsischen und intrinsischen Motivatoren
Tabelle 20: Statistik zu projekt- und instrumentenbezogenen Hindernissen
Tabelle 21: Statistik zu personen- und unternehmensbezogenen Hindernissen
Tabelle 22: Statistik zu projekt- und instrumentenbezogenen Förderbedingungen
Tabelle 23: Statistik zu fördernden personen- und unternehmensbezogenen Bedingungen
Tabelle 24: Statistik zu den Items der Theorie des geplanten Verhaltens
Tabelle 25: Antworten zu den Fragen 4 bis 13 mit eindeutigen Tendenzen
Tabelle 26: Gütemaße des Strukturgleichungsmodells
Tabelle 27: Pfadkoeffizienten, t-Werte und f2-Werte der „Einstellung“
Tabelle 28: Pfadkoeffizienten, t-Werte und f2-Werte der „Intention“
Abkürzungsverzeichnis
AVE
Average Variance Extracted
BSC
Balanced Scorecard
CEO
Chief Executive Officer
CFO
Chief Financial Officer
CINO
Chief Innovation Officer
CIO
Chief Information Officer
CSO
Chief Sales Officer
CTO
Chief Technology Officer
DEV
Durchschnittlich erfasste Varianz
EBIT
Earnings before interest and taxes
EFQM
European Foundation für Quality Management
EVA
Economic Value-added
F&E
Forschung und Entwicklung
FF
Forschungsfrage
GF
Geschäftsführung
H
2
Cross-Validated Redundancy
HR
Human Resources
ISC
Innovation Scorecard
ISO
International Organization for Standardization
KPI
Key Performance Indicator
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
p
Signifikanzwert
PL
Projektleiter
PO
Produktorganisation
r
Korrelationskoeffizient
PLS
Partial-Least-Squares
R
2
Bestimmtheitsmaße
RL
Rentabilität-Liquidität
ROI
Return on Investment
ROS
Return on Sales
SOP
Start Of Production
SWOT
Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats
TPB
Theory of Planned Behavior
USP
Unique Selling Proposition
VHB
Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft
VIF
Variance Inflation Factor
A. Einleitung
1. Ausgangslage und Problemstellung
Das heutige Umfeld von Industrieunternehmen ist durch schnellen Wandel geprägt. Sie sind gezwungen, durch Innovation auf den Kunden zugeschnittene Produkte zu entwickeln, um so die Voraussetzungen für nachhaltigen Unternehmenserfolg zu sichern.1 Wenn es um die Realisierung von Entscheidungen geht, wird jedoch sowohl in der Forschung als auch in der Praxis kritisiert, dass es an Systemen und Instrumenten für eine ganzheitliche Unternehmensplanung und -steuerung mangelt. Insbesondere im Bereich der Innovation sowie der Steuerung von Innovationsprozessen seien diese jedoch die Voraussetzung dafür, in der aktuellen Wissens- und Informationsgesellschaft weiterhin Wettbewerbsvorteile zu erlangen bzw. zu behalten.2 Ergänzend belegen aktuelle Untersuchungen wie die von Speckbacher/ Wabnegg, dass Unternehmen durchaus Leistungsmessung und Anreize in Bereichen einsetzen, die Kreativität erfordern.3 Hierunter lassen sich Innovationsprozesse eindeutig subsumieren.
Die genaue Definition einer Innovation wurde und wird in der Literatur kontrovers diskutiert.4 Die Abgrenzungsversuche haben im Allgemeinen gemeinsam, dass es sich bei Innovationen vorrangig um neuartige Produkte oder Prozesse handelt, die am Markt eingeführt (Produktinnovation) oder in der Fertigung verwendet werden (Prozessinnovation).5 Aufgrund der Globalisierung und der sich daraus ergebenden Zunahme der Wettbewerbsintensität ist davon auszugehen, dass forcierte und kontinuierliche Innovation nicht mehr nur eine Option der Geschäftsentwicklung ist, sondern zu einem Imperativ der Unternehmensführung geworden ist. Unabhängig von Branchen und Märkten gewinnt die Steuerung des Innovationsprozesses somit wachsende Bedeutung für den Unternehmenserfolg.6 Diese Bedeutung ist auch heute noch vorherrschend und nicht abschließend untersucht: Finckh und Mendel beschrieben erst im August 2021 in ihrem Artikel, dass eine rein kostenbasierte Steuerung von F&E-Prozessen für Unternehmen bei Weitem nicht ausreicht, um nachhaltig Innovationserfolge zu erzielen. Hierfür ist vielmehr ein solides F&E-Performance-Managementsystem nötig.7 Und an eben diesen praktikablen Verfahren für das Controlling von Innovation mangelt es, was dazu führt, dass die Innovationsfähigkeit – also das Hervorbringen von neuen Produkten, Prozessen oder Organisationslösungen – nur selten systematisch analysiert, geplant und gesteuert wird.8
Aus diesem Grund steht der Prozess der Innovation und dessen Controlling im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Die Unternehmensfunktion Forschung und Entwicklung (F&E) ist Ausgangspunkt und Teil des Innovationsprozesses, der zunächst zur Invention, also zu einer Erfindung, führt.9 Diese ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Innovation. Hat die Invention Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg, müssen Investitionen in Produktion und Marketing getätigt werden, damit die Einführung in den Markt bzw. die Nutzung im innerbetrieblichen Zusammenspiel gelingt. Erst dann wird von einer Innovation im engeren Sinne gesprochen. Im weiteren Verlauf wird eine Verbreitung der Innovation angestrebt, die sogenannte Diffusion. Wenn Konkurrenten dies wahrnehmen, können sie versuchen, den Diffusionsprozess durch Imitation zu ihren Gunsten zu nutzen. Diese Aktivitäten und ihre Ergebnisse ergeben zusammen den Innovationsprozess (Innovation im weiteren Sinne).10 Nach einem gewissen Zeitraum hat sich das Produkt bzw. der Prozess etabliert und der Innovationsprozess ist abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt setzt der laufende Verwertungsprozess ein, wobei die Innovation den üblichen Produktlebenszyklus mit den Phasen Wachstum, Reife und Degeneration durchläuft.11 Insgesamt ergeben sich dadurch komplexe Prozessabläufe, die eine effektive Steuerung der unternehmerischen Aktivitäten im Bereich Innovation erforderlich machen.
Innovationen sind immaterielle Investitionen, die einerseits große Risiken beinhalten, andererseits aber auch erhebliche Chancen auf überdurchschnittlich hohe Renditen eröffnen.12 Daher ist das Management des Innovationsprozesses von erheblicher Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Das Innovationsmanagement soll dabei „durch Informationsbeschaffung, Entscheidungshilfen und Koordination unter Berücksichtigung der zeit- und kostenoptimierten Planung und Realisierung des Innovationsprogramms oder konkreter Innovationsprojekte“13 vom Innovationscontrolling unterstützt werden. Allgemein bezeichnet Controlling „die Planung und Kontrolle (im Sinne einer koordinierten Steuerung) der typischen Betriebs- und Geschäftsprozesse im Unternehmen“.14 entscheidend sind somit einerseits die überlegte Auswahl der geeigneten Instrumente aus dem Rechnungswesen und andererseits die umsichtige Verknüpfung der Aufgaben der Informationsgewinnung sowie -bearbeitung mit den beteiligten Stellen bzw. Instanzen.15
Die Forderung nach einem Innovationscontrolling gewann erstmals Anfang der 1980er-Jahre aufgrund der steigenden F&E-Aufwendungen an Bedeutung. Um die immer wichtiger werdenden Forschungsaktivitäten zielgerichtet zu steuern, sollte die Effizienz des Managements bezüglich der Koordination des Innovationsprozesses erhöht werden.16 Dennoch besteht weiterhin großer Forschungsbedarf im Controlling von F&E und Innovation. Schön kam 2001 in einer Literaturanalyse zum Schluss, dass die bisherigen Arbeiten zwar gute Lösungsansätze böten, es aber unter anderem an der Bereitstellung von Messgrößen mangele, um die Effektivität und Effizienz innovativer Prozesse im Unternehmen zu beurteilen.17 In einer ganz aktuellen Studie aus dem Jahre 2021, bei der 695 forschungsintensiven Unternehmen in Europa und Nordamerika befragt wurden, stellten Müller-Stewens und Möller zudem fest, dass Controlling Innovation sogar fördern würde, da es durch das Sammeln und Verteilen von Informationen die Koordinationsfähigkeit des Unternehmens erhöht.18
In der Controlling-Literatur gibt es zwar mittlerweile eine größere Menge an Kennzahlen bzw. Indikatoren, die das Innovationscontrolling unterstützen. Diese Messgrößen wurden bisher aber kaum praxisorientiert in ein Performance-Measurement-System für das Innovationscontrolling zusammengeführt.19 Anders als traditionelle Kennzahlensysteme, die nur vergangenheits- und periodenbezogen sowie mittels monetärer Größen über die Unternehmung berichteten, soll Performance Measurement die „Effektivität und Effizienz unternehmerischer Maßnahmen und Handlungen“20 quantifizieren. Ziel ist es, laufend und nicht rückblickend über die Zielerreichung von Maßnahmen zu informieren.21 Damit dient das Controlling unmittelbar der Überprüfung der Effektivität und Effizienz unternehmerischer Leistungen, der operativen Umsetzung der Unternehmensstrategie sowie der Planung und Steuerung des Ressourceneinsatzes.22
Aufgrund des Wandels im Bereich der Unternehmenssteuerung wurde in den letzten Jahren eine Vielzahl von Konzeptionen zur Planung und Steuerung entwickelt, die ein ausgeglichenes Verhältnis von finanziellen23 und nicht-finanziellen24 Kennzahlen anstreben. Das wohl bekannteste und in der Praxis am weitesten verbreitete Performance-Measurement-System ist die von Robert S. Kaplan und David P. Norton entwickelte Balanced Scorecard (BSC).25 Dennoch sieht z. B. Schreyer bei der Entwicklung und Implementierung von Performance-Measurement-Systemen weiteren Forschungsbedarf.26 Auch in der Unternehmenspraxis gilt die Verwendung von Performance Measurement im Bereich Innovation als problematisch. Zwar zwingt der steigende Kosten- und Zeitdruck im F&E-Bereich Unternehmen dazu, diese Möglichkeit zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung von Innovationsaktivitäten zu nutzen. Die Frage, wie das Management von Innovationsprojekten sowie Projektmanagement und Rechnungswesen sinnvoll zusammenarbeiten können, ist bisher jedoch nur unbefriedigend gelöst.27
Entscheidend ist, dass das Innovationscontrolling den Innovationsprozess nicht zu sehr hinsichtlich der nötigen Kreativität einschränkt, andererseits aber die Wirtschaftlichkeit laufend kontrolliert wird, um zu hohe Entwicklungskosten zu vermeiden.28 Diese Steuerung durch das Innovationscontrolling muss vom betrieblichen Rechnungswesen unterstützt werden. Aber gerade bezüglich der korrekten Abbildung von Innovationen bestehen dort aktuell noch erhebliche Mängel, die in naher Zukunft aufzuarbeiten sind.29 So herrscht nicht einmal auf der Ebene der Kostenplanung und -rechnung Konsens, wie die Innovationsrechnung erfolgen soll.30
Im Bereich des Innovationscontrollings bestehen somit zwar erste Ansätze für die Steuerung des Innovationsprozesses.31 Diese beziehen sich aber in erster Linie auf das Kostencontrolling, nicht auf die Prozess- und Organisationsdimension des Innovationsprozesses, die in zunehmendem Maße als erfolgsrelevant angesehen wird.32 Die Unterstützungsfunktion des Innovationscontrollings für das Innovationsmanagement besteht nämlich nicht nur darin, die Reduzierung der Innovationskosten sowie die Erhöhung der Qualität von Innovationen zu messen und damit zu managen, sondern insgesamt Instrumente für die Steuerung des Innovationsprozesses in der Organisationskultur zu verankern, damit diese überhaupt wirksam werden. Bei der näheren Betrachtung von Performance Measurement Systemen nennen Chenhall/Moers 2015 die BSC, wenn es um die wichtigsten Fortschritte bei der Einbeziehung komplexerer Konzepte, wenn es um Steuerung und Kontrolle von Innovationen geht, zuvorderst die BSC.33 Hier setzt die vorliegende Arbeit an, indem die Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung einer Balanced Scorecard im Innovationsprozess anhand einer Fallstudie untersucht werden.
1 Vgl. Friedag, 2005, S. 1.
2 Vgl. Schreyer, 2007, S. 1.
3 Vgl. Speckbacher, G./ Wabnegg, M., 2020.
4 Für einen Überblick über die verschiedenen Definitionen vgl. Hauschildt/Salomo, 2011, S. 4.
5 Bei der Definition von Innovation ist zudem die Frage nach den Dimensionen wichtig, um zu entscheiden, ob etwas innovativ ist oder nicht. Hier wird nach Inhalt (was ist neu?), Intensität (wie neu?), Subjektivität (neu für wen?), Prozess (wo beginnt, wo endet die Neuerung?) sowie Normativität (ist neu gleich erfolgreich?) gefragt. Vgl. Hauschildt/Salomo, 2011, S. 7-31.
6 Vgl. Leonard/Straus, 1998, S. 27.
7 Vgl. Finckh/Mendel, 2021, S.1.
8 Vgl. Bischof, 2020, S. 50.
9 Vgl. Brockhoff, 1999, S. 35-38.
10 Vgl. Brockhoff, 1999, S. 35-38.
11 Vgl. Bösch, 2007, S. 29.
12 Vgl. Littkemann, 2005, S. 14.
13 Alisch et al., 2004, S. 1497.
14 Littkemann, 2005, S. 12. Hervorhebung im Original.
15 Vgl. Littkemann, 2005, S. 12.
16 Vgl. Schön, 2001, S. 72-87; Bösch, 2007, S. 233 f.
17 Vgl. Schön, 2001, S. 87.
18 Vgl. Müller-Stewens/ Möller, 2021, S. 18; Müller-Stewens et. al, 2020.
19 Vgl. Bösch, 2007, S. 109, 214-228.
20 Schreyer, 2007, S. 28.
21 Vgl. Hauber, 2002, S. 58.
22 Einen Überblick über die Ziele sowie eine kurze Erläuterung gibt Schreyer, 2007, S. 31-34.
23 Als Kategorien sind hier Gewinn (z. B. Betriebsergebnis), Liquidität, Rendite (z. B. Return on Investment, ROI) und Wert zu nennen. Vgl. Schreyer, 2007, S. 43.
24 Hierunter fallen u. a. Qualität (z. B. Ausschussquote), Produktivität, Markt (z. B. Marktanteil) oder Kunden (z. B. Kundenzufriedenheit). Vgl. Schreyer, 2007, S. 43.
25 Vgl. Klingebiel, 2001, S. 69. Weitere verbreitete Performance-Measurement-Systeme erläutern Grüning, 2002, S. 21-66, sowie Schreyer, 2007, S. 44-60.
26 Vgl. Schreyer, 2007, S. 289 f.
27 Von rund 100 F&E-Manager, die Epstein 2002 interviewte, konnten die meisten keine Auskunft über den möglichen Erfolg ihrer Innovationstätigkeiten geben. Vgl. Bösch, 2007, S. 112.
28 Innovationen werden als Projekte angesehen, folglich ist zur Steuerung des Innovationsprozesses ein Projektteam zu bestimmen, das die Steuerung des Prozesses übernimmt. Vgl. Littkemann, 1997, S. 13091331; Littkemann, 2005, S. 11; Gemünden/Littkemann, 2007, S. 18.
29 Vgl. Granig, 2007, S. 222.
30 Wenn ein Unternehmen keine separate Innovationsabrechnung verwendete, wird dies als eigener Typ interpretiert.
31 Vgl. Lange, 1994, S. 102.
32 Vgl. Schmelzer, 1992, S. 36 f.
33 Vgl. Chenhall/Moers (2015), S. 6.
2. Zielsetzung der Arbeit
Im Zentrum dieses Forschungsprojekts steht die Analyse fördernder und hemmender Rahmenbedingungen bei der Implementierung eines Performance-Management-Instruments in Form einer Innovation Scorecard (ISC) am Beispiel des Innovationsmanagements eines familiengeführten deutschen mittelständischen Unternehmens. Die Untersuchung beruht auf einem Implementierungsprojekt, das der Verfasser begleitet, wissenschaftlich erfasst und bearbeitet hat. Dadurch war es möglich, Primärdaten zu erheben und die in mehreren Phasen des Projekts gesammelten Daten wissenschaftlich zu analysieren.
Beim Untersuchungsgegenstand handelt es sich um eine Organisationsinnovation im Bereich des Innovationsmanagements. Die zuvor erläuterte Differenzierung zwischen Invention und Innovation ist auch auf diesen Prozess anzuwenden. Die Entwicklung eines Performance-Management-Systems in Form einer Innovation Scorecard ist in ihrer ersten Phase ebenfalls zunächst eine Invention. Die erfolgreiche Einführung ist hingegen die eigentliche Innovation, für welche die in der Innovationsforschung identifizierten Innovationsbarrieren ebenfalls ihre Gültigkeit haben. Die Balanced Scorecard ist kein reines Controllinginstrument, sondern ein Instrument der Organisationsentwicklung und des Performance-Managements auf Basis einer Stakeholder-orientierten Entwicklung. Das Konzept geht insofern über ein klassisches Controllinginstrument hinaus, dass die Balanced Scorecard nicht vom Controlling oder der Unternehmensführung vorgegeben wird, sondern in einem Kommunikationsprozess zwischen Topmanagement, Controlling und Abteilungsmitarbeitenden bzw. Mitarbeitenden der Business Unit gemeinsam entwickelt wird. Folglich ist die Invention in Form der Erstellung der Scorecard bereits ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Einführung (Innovation).
Primär handelt es sich bei dieser Studie um eine umfangreiche Fallstudie, für die qualitative und quantitative Daten erhoben und analysiert werden. Im empirischen Teil werden zunächst mittels qualitativer Interviews mit Entscheidern (Experteninterviews) sowie der Auswertung unternehmensinterner Unterlagen Intentionen und Gründe für die Einführung eines spezifischen Innovationscontrollingsystems dargestellt und analysiert. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Identifikation messrelevanter Faktoren und die Entwicklung einer Steuerungslogik, die der konkreten Balanced Scorecard des Unternehmens zugrunde liegen soll. In der Folge wird die Einführung einer Innovation Scorecard als Performance-Management-Instrument mittels statistischer Verfahren der Datenanalyse kausal-analytisch untersucht. Abschließend wird eine Ex-post-Evaluation in Form von Experteninterviews nach der Einführung des Performance-Management-Instruments genutzt, um die Ergebnisse der vorangegangen Datenanalyse zu triangulieren.
Erkenntnisziel dieser Arbeit ist es, praxisrelevante Erkenntnisse bezüglich der Möglichkeiten und Grenzen einer Balanced Scorecard im Innovationsprozess zu gewinnen. Entsprechende Forschungsziele sind die Identifikation von
möglichen Potenzialen und Grenzen eines Balanced-Scorecard-Projekts,
Mitteln, um Grenzen bzw. Barrieren überwinden zu können, sodass die Potenziale einer Balanced Scorecard als Performance-Management-Instrument im Innovationsprozess besser genutzt werden können, und
positiven Effekten des Instruments Innovation Scorecard auf den Innovationsprozess an sich.
Ausgehend vom Thema und den Erkenntnis- und Forschungszielen dieser Dissertation ergeben sich – sozusagen generisch – drei Forschungsfragen. Die erste Frage zielt auf die Identifizierung von potenziellen Hindernissen und Grenzen eines Scorecard-Projekts und einer Innovation Scorecard ab:
FF1: Welche Probleme und Hindernisse entstehen bei der Einführung einer Balanced Scorecard im Innovationsprozess (Innovation Scorecard)?
Die zweite Frage fokussiert Möglichkeiten, Grenzen bzw. Barrieren zu überwinden, um die Potenziale der Innovation Scorecard als Instrument für das Performance-Management im Innovationsprozess besser auszuschöpfen:
FF2: Wie können Implementierungsbarrieren beseitigt werden?
Die Antwort auf die Forschungsfrage FF1 ermöglicht es, potenzielle Hindernisse eines Scorecard-Projekts sowie Grenzen des Instruments Innovation Scorecard zu identifizieren, während die Antwort auf Forschungsfrage FF2 eine Einschätzung erlaubt, ob und mit welchen Mitteln diese Grenzen bzw. Barrieren überwunden werden können. Dadurch ergibt sich letztlich die dritte Forschungsfrage:
FF3: Welche positiven Effekte einer Innovation Scorecard als Spezialfall einer Balanced Scorecard auf die Führung des Innovationsprozesses im Bereich des Innovationsmanagements sind möglich?
Die Antworten auf diese drei Forschungsfragen gestatten es, die Erfolgsfaktoren für die Entwicklung und Einführung einer Innovation Scorecard zu identifizieren, damit den Einführungsprozess besser steuerbar zu machen und schließlich den Effekt auf den Innovationsprozess vorab abzuschätzen. Daraus ergibt sich als übergeordnetes Erkenntnisziel dieser Arbeit die Frage, wie die Potenziale einer Innovation Scorecard für das Innovationsmanagement zu bewerten sind.
Dem Case-Study-Ansatz entsprechend hat diese Studie einen explorativen Charakter, wobei die Ergebnisse zum Untersuchungsgegenstand nicht repräsentativ sind. Hinzu kommt, dass die Einführung einer Balanced Scorecard immer zu einem unternehmens- bzw. abteilungsspezifischen Ergebnis führt, das sich in genau dieser Form in keinem anderen Unternehmen ergeben dürfte. Darüber hinaus ermöglicht dieses Vorgehen jedoch praxisrelevante Erkenntnisse, die nur schwer mittels eines quantitativ-empirischen Vorgehens erzielt werden könnten. Die Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung sorgt für eine Detailtiefe, die bei der Untersuchung größerer Samples nicht möglich ist. Nur durch dieses Forschungsdesign lässt sich die Frage beantworten, welche organisationalen Herausforderungen das Innovationscontrolling jenseits der Entwicklung von Messgrößen und einer Steuerungssystematik bewältigen muss. Das gilt insbesondere im Hinblick auf Implementierungs- bzw. Innovationsbarrieren, aber auch bezüglich der Wirkung eines spezifischen Performance-Management-Instruments, wie es der Philosophie einer Balanced Scorecard entspricht.
3. Forschungsansatz und Methoden der Datenerhebung
Hauschildt identifiziert drei theoretische Perspektiven der Managementforschung im Bereich Innovation. Bei einer führungsbezogenen Sichtweise wird der Innovationsprozess als ein Entscheidungs- und Umsetzungsprozess beobachtet und beschrieben. Eine ressourcenbezogene Perspektive sieht den Innovationsprozess dagegen als eine spezifische Kombination von Produktionsfaktoren bzw. unternehmensspezifischen Ressourcen. Eine diffusionsbezogene Sichtweise beinhaltet wiederum, dass der Innovationsprozess als Verwertungsprozess innerhalb und außerhalb der etablierten Wertschöpfungskette betrachtet wird.36
Diese drei Perspektiven sind grundsätzlich nur schwer zu trennen. So kann z. B. eine führungsbezogene Perspektive kaum auf ressourcenbezogene Überlegungen verzichten, wenn das Ziel von Führung darin gesehen wird, auf Menschen einzuwirken, um einen Organisationszweck zu erfüllen. Auch stellt sich die Frage, inwiefern Führungsziele von diffusionsbezogenen Aspekten abhängen, da davon auszugehen ist, dass betriebliche Prozesse andere Führungsinstrumente und anderes Führungshandeln brauchen als eine marktorientiere Innovation. Unabhängig davon hat Führung im Innovationsprozess aber immer Innovationsbarrieren zu überwinden. Deshalb kommt in diesem Forschungsfeld personen-, organisations- und führungsbedingten Innovationshemmnissen eine besondere Bedeutung zu.37 Das gilt umso mehr, wenn der Innovationsprozess selbst Gegenstand einer Prozessinnovation wird, wie im Fall dieser Studie, welche die Einführung von Performance-Management-Systemen im Innovationsprozess untersucht, um struktur-, personen- und führungsbedingte Innovationsbarrieren zu überwinden. Daher wählt diese Studie zwar grundsätzlich eine führungsbezogene Perspektive auf den Innovationsprozess, bezieht aber auch eine ressourcenbezogene Sichtweise auf das Innovationsmanagement mit ein.
Diese Verknüpfung ergibt sich nicht zuletzt aus dem Fallstudienansatz, welcher den Kern dieser Arbeit bildet. Der sogenannte Case Study Approach, der auf die Untersuchung schwer abgrenzbarer Untersuchungsobjekte abzielt, ist als qualitativ-empirische Methodik besonders für komplexe Zusammenhänge geeignet. Diese lassen sich nur schwer über einen rein quantitativen Zugang auf der Basis von gleichartigen Daten aus vielen Untersuchungsobjekten erschließen, in diesem Fall etwa die Analyse von Innovationsprozessen in einer großen Zahl an Unternehmen. Dieses Problem ergibt sich insbesondere bei der Diskussion der Innovationsbarrieren mit ihrer Vielzahl verschiedener Perspektiven.
Gleichzeitig versteht sich diese Studie als Beitrag zur Managementforschung, deren explizites Ziel die Förderung der Praxis mit wissenschaftlichen Mitteln ist.38 Aufgrund der Tatsache, dass das Forschungsprojekt als Teil eines Praxisprojekts realisiert wurde, ist es methodologisch als eine Form der Aktionsforschung (Action Research) zu sehen, die Wissenschaft und praktische Umsetzung verknüpft. Der Ansatz ist bereits seit Langem eine grundlegende Methode der Management- und Organisationsforschung.39 Dazu werden Zusammenhänge in der betriebswirtschaftlichen Realität beobachtet und auf der Basis von Modellen und Theorien Daten erhoben. Die Erkenntnisse aus der Beobachtung werden analysiert und die Effekte der Intervention des Forschers dann gemessen. Für diese Studie bedeutet das, dass in der ersten Phase des Projekts Experteninterviews zur Einführung der Innovation Scorecard geführt werden und diese zusammen mit relevanten Dokumenten qualitativ analysiert werden. Ziel ist es, praktische Schlussfolgerungen für die Entwicklung der Innovation Scorecard abzuleiten und diese in einem partizipativen Prozess im Unternehmen zu finalisieren.
Die Aktionsforschung unterscheidet sich von klassischen empirischen Ansätzen dadurch, dass der Forscher Teil des zu beobachtenden Prozesses ist und in diesen wissenschaftlich basiert eingreift. Insofern beruht Aktionsforschung letztlich immer auf einer Fallstudie. Die Aktionsforschung ist ein konstruktionsorientierter Ansatz mit dem Ziel, Lösungen für Praxisprobleme an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis zu generieren.40 In der Regel werden mehrere Analyse-, Aktions- und Evaluationsschritte durchlaufen, um zu einer empirisch begründeten Theorie (Grounded Theory) oder wenigstens einem Modell zu gelangen. Dabei erfolgt eine iterativ-reflexive wissenschaftliche Intervention in soziale Prozesse.41 Damit verbunden ist, dass der Wissenschaftler zum Akteur wird, also in die beobachteten Zusammenhänge punktuell eingreift.42 Daraus ergibt sich die Kritik, dass dies dem Wesen der Sozialwissenschaften widerspricht, das grundsätzlich in der werturteilsfreien Beobachtung der Wirklichkeit besteht, die nicht durch Eingriffe des Beobachters verändert werden soll.43 Ziel dieses Forschungsprojekts ist es jedoch, mit wissenschaftlichen Mitteln einen anwendungsorientierten Beitrag zur Managementforschung zu liefern. Resultat soll also nicht ein ausschließlich theoretischer Beitrag z. B. zur Überprüfung eines Modells oder einer Theorie sein, wenngleich das Ergebnis der empirischen Forschung auch in einem Wirkungsmodell und dessen Rückbindung an die Theorie besteht. Gleichzeitig grenzt sich die Studie explizit von Lösungen ab, die sich auf dem Unternehmensberatungsmarkt etabliert haben, z. B. die Innovation Scorecard der Unternehmensberatung Arthur D. Little. Das marktgängige Produkt wurde nicht erkennbar auf Basis eines wissenschaftlich methodischen Vorgehens entwickelt.44
Im Sinne der Aktionsforschung wird im hier dokumentierten Fall eine Innovation Scorecard in einem Unternehmen eingeführt. Im Laufe der Implementierung werden die Projekt-Stakeholder befragt, und zwar insbesondere hinsichtlich der Entscheidungsgründe für die Einführung der Scorecard, der Einstellungen der Mitarbeitenden zur gemeinsam entwickelten Scorecard sowie der längerfristigen Wirkung der Scorecard im Innovationsprozess. Letzteres kann dabei erst mit zeitlichem Abstand nach Abschluss des Aktionsforschungsprojekts und der betriebspraktischen Nutzung der Scorecard erhoben werden. Zudem wird die Entstehung der Innovation Scorecard dokumentiert und analysiert. Bisher liegen nur geringe Erkenntnisse über die Erfolgsfaktoren der Einführung einer Balanced Scorecard bzw. einer Innovation Scorecard vor.45 Daher folgt diese Arbeit dem Grounded-Theory-Ansatz und nutzt im Feld erhobene Daten über die Einstellungen und das Verhalten der Akteure, um einen theoretischen Ansatz für die Einführung einer Innovation Scorecard zu entwickeln.
Die genutzten Instrumente der Datenerhebung sind die Befragung, das Experteninterview und die Inhaltsanalyse von in den Aktionsforschungsphasen generierten Unternehmensdokumenten. Diese sind im Rahmen der Entwicklung und Einführung der Innovation Scorecard im gegebenen Unternehmen entstanden. Neben Projektbeschreibungen, Workshop-Unterlagen und verschiedenen Entwurfsstadien der Innovation Scorecard gehören dazu auch weitere Unternehmensdokumente wie die Unternehmensstrategie oder das Handbuch zum vorherrschenden Innovationsprozess. Eine weitere Primärdatenquelle ist die Befragung von Stakeholdern des Implementierungsprojekts, also der Geschäftsführung sowie der Mitarbeitenden des Innovationsteams eines Geschäftsbereichs des Unternehmens. Als Analyseverfahren ergeben sich damit die Deskription und Interpretation der Inhalte von Unternehmensdokumenten und Experteninterviews sowie die statistische Analyse der Befragung mittels standardisierter Fragebögen.
Wissenschaftliche Basis der Befragung ist die Theorie des geplanten Verhaltens (Theory of Planned Behavior, TPB). Jardali et al. schlagen vor, die Nutzung und den Effekt von Informationssystemen auf dieser Grundlage zu untersuchen. Die Theorie des geplanten Verhaltens sehen sie als geeignet an, weil das Management mit Instrumenten wie der Balanced Scorecard direkt auf das Verhalten von Mitarbeitern einwirkt, die Verhaltenswirkungen bisher allerdings kaum untersucht wurden.46 Die von Icek Ajzen entwickelte Theorie fokussiert auf das Verhalten von Personen gegenüber einem Einstellungsobjekt, in diesem Fall also gegenüber der Einführung eines Instruments zur Innovationssteuerung. Ziel des Ansatzes ist die Prognose von Verhalten, wenn die Einstellungen gegenüber dem Einstellungsobjekt bekannt sind, um so die Bereitschaft zu einer Verhaltensänderung und auch die Faktoren, die zu einer Verhaltensänderung führen, zu ermitteln.47 Basierend auf diesem Ansatz wird für die standardisierte Befragung ein Fragebogen mit dem Ziel entwickelt, die Einstellung der Mitarbeitenden zu quantifizieren. Besonders im Fokus stehen dabei fördernde und hemmende Faktoren bei einer Organisationsinnovation wie der Innovation Scorecard. Eine Recherche in Datenbanken wie ScienceDirect, Scopus, Emerald Insight, Web of Science und Taylor & Francis nach in Academic Journals publizierten empirischen Studien, welche eine Balanced Scorecard auf Basis der Theorie des geplanten Verhaltens untersuchen, führte zum Zeitpunkt der Literaturrecherche für diese Dissertation zu keinen Treffern.48 Insofern stellt auch diese theoretische Fundierung eine Innovation dar.
4. Gang der Untersuchung und Aufbau der Arbeit
Die Forschungsarbeit für die vorliegende Studie lässt sich in drei Teile einteilen, denen jeweils unterschiedliche Ansätze bzw. Methoden zugrunde liegen. Zunächst ist eine Erhebung des Stands der Forschung im Bereich Innovationsforschung und Balanced Scorecard mittels Literaturanalyse erforderlich. Ziel muss es sein, die Struktur von Innovationsprozessen, Innovationsbarrieren und Instrumente zur empirischen Analyse und Steuerung des Innovationsmanagements zu identifizieren, wobei die Theorie des geplanten Verhaltens sowie die Innovation Scorecard im Mittelpunkt stehen. Zweitens erfolgt die Umsetzung des Implementierungsprojekts auf Basis der Erkenntnisse aus der Literatur im Sinne des Aktionsforschungsansatzes. Damit ist schließlich drittens die dreistufige Datenerhebung verknüpft, die den Forschungsprozess strukturiert (siehe Tabelle 1). Im Rahmen des Implementierungsprojekts werden dazu Daten in Form einer Dokumentensammlung, einer quantitativen und zweier qualitativer Befragungen gesammelt:
(1) Vor Beginn des Implementierungsprojekts werden die Geschäftsführer zu den Problemen im Innovationsprozess und im Innovationsmanagement befragt (Experteninterviews).
(2) Nach gemeinschaftlicher Entwicklung durch Geschäftsführung, weiteren leitenden Angestellten und Mitarbeitenden aus dem F&E-Bereich werden die zukünftigen Nutzenden (Mitarbeitende der Innovationsteams) mittels standardisierter Fragebögen zu ihrem geplanten Verhalten bei der Einführung der Innovation Scorecard sowie zu den von den Befragten erwarteten Hindernissen und fördernden Faktoren befragt.
(3) Als zweite qualitative Befragung werden vier Jahre nach Projektumsetzung Experteninterviews mit Mitgliedern des Managementteams durchgeführt. Untersucht werden Effekte und Barrieren im Rahmen der Einführung der Innovation Scorecard sowie deren Relevanz als Managementinstrument für die Verbesserung des Innovationsprozesses.
Stufe des Forschungsprozesses
Ansatz
Aktionen
Ziel
Stufe 1
Entwicklung ISC
Aktionsforschung, qualitative Befragung (Experteninterviews), Dokumentensammlung und -analyse
Entwicklung und Einführung einer ISC mittels Interaktion zwischen Forscher und Organisationsmitgliedern
Ziel des Projekts auf der Ebene der Organisation; gleichzeitig die Fallstudie für die Beantwortung der Forschungsfragen und der Ausgangspunkt der Datenerhebung
Stufe 2
Analyse der Möglichkeiten und Grenzen
Quantitative Interviews und statistische Datenanalyse
Datenerhebung durch Befragung, statistische Auswertung
Überprüfung der Hypothesen zur Bestimmung der Barrieren und Erfolgsfaktoren für die Einführung einer ISC
Stufe 3
Projekt-Evaluation
Qualitative Interviews
Interviews und qualitative Datenanalyse
Ex-post-Evaluation der Wirksamkeit der ISC-Einführung
Tabelle 1: Übersicht zur Struktur des Forschungsprozesses49
Die Datenauswertung erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Dokumente und Experteninterviews) sowie statistischer Datenanalyse (standardisierte Befragung). Die Dokumente, die vor dem Implementierungsprozess vorlagen, sowie die Dokumente, die im Laufe des Implementierungsprojekts entstanden sind, werden qualitativ-deskriptiv analysiert, ebenso die Ergebnisse der Expertenbefragung. Die quantitativen Daten aus den standardisierten Fragebögen werden statistisch ausgewertet (deskriptive Statistik, Korrelationsanalyse sowie Pfadanalyse), sodass sich hier Aussagen über kausale Zusammenhänge ergeben. Die Stufen 1 und 2 der Datenerhebung führen zu Antworten auf die Forschungsfragen FF1, FF2 und teilweise auch FF3. Sie beziehen sich also auf Probleme und Hindernisse sowie Möglichkeiten der Überwindung von Implementierungsbarrieren bei der Einführung einer Innovation Scorecard. Gleichzeitig werden die durch die Befragten angenommenen positiven Effekte zum Zeitpunkt der Einführung des speziellen Anwendungsfalls einer BSC erfasst. Stufe 3 dagegen fokussiert die positiven Effekte der Innovation Scorecard zu einem Zeitpunkt deutlich nach deren Einführung. Grundlage ist das Wissen der Geschäftsführung als Experten im Sinne des Experteninterviewansatzes. Stufe 3 ermöglicht somit die erweiterte Beantwortung der Forschungsfrage FF3.
Aus der Struktur des Forschungsprozesses ergibt sich zugleich die formale Gliederung der Arbeit in sechs Teile. Nach dieser Einleitung wird in Teil B zunächst in die mittlerweile umfangreich entwickelten Typologien der Innovationsforschung eingeführt, indem verschiedene Arten von Innovation dargestellt und differenziert werden. Die nachfolgenden Kapitel beschäftigen sich mit der Forschung zum Innovationsprozess und zum Innovationsmanagement. Kapitel 3 diskutiert die verschiedenen Phasen des Innovationsprozesses, der unabhängig vom Innovationstyp abläuft, und fasst ergänzend dazu die Literatur zum Innnovationsmanagement zusammen. Kapitel 4