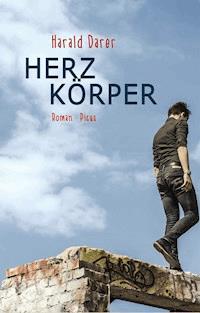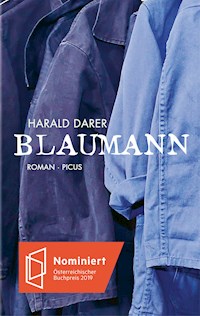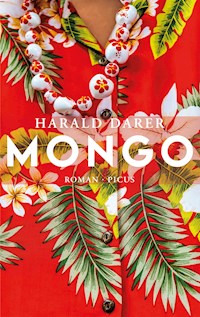
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Katja ist schwanger. Doch richtige Vorfreude will sich bei ihr und ihrem Mann so schnell nicht einstellen, fürchten sie doch, ihr Ungeborenes könnte wie Katjas Bruder Markus mit Trisomie 21 geboren werden. Was tun, wenn die Untersuchungen diese Befürchtungen bestätigten? Auf der Suche nach Antworten erinnert sich Harry zurück an Begegnungen mit Menschen, für die in unserer Gesellschaft kein Platz vorgesehen ist, vor allem aber erzählt er von der Beziehung zu seinem Schwager Markus, die geprägt ist von bizarren Erlebnissen und liebenswerten Momenten. Am Ende erkennt Harry, dass er keine Antworten finden wird, weil seine Fragen von Anfang an die falschen waren. Kraftvoll, pointiert und herzerwärmend erzählt Harald Darer von einem Lebensweg, der trotz aller Schwierigkeiten erfolgreich ist und zeigt: Glück ist fast immer möglich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Copyright © 2022 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien
Umschlagabbildung: © Wiliam Perry / Alamy Stock Photo
ISBN 978-3-7117-2119-8
eISBN 978-3-7117-5463-9
Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
HARALD DARER
MONGO
ROMAN
PICUS VERLAG WIEN
[Mongo, Schimpfwort];
abgeleitet vom Begriff Mongolismus.
Ursprünglich nur als Beleidigung für Menschen, die mit dem Down-Syndrom geboren wurden. Später vor allem in der Jugendsprache allgemein als Synonym für Idiot verwendet.
[Mongolismus, veraltet];
Abwertung von Menschen mit Down-Syndrom als vermeintlich minderwertiges, nicht voll Mensch gewordenes Sein.
Zugleich eine rassistische Herabsetzung der ethnischen Gruppe der Mongolen. Wurde und wird ebenfalls in rassistischem Kontext gebraucht.
Man kann nicht nie leben.
Inhalt
1 NOCH NICHTS
2 WAS WEISST DU SCHON
3 ES WIRD SCHON WERDEN
4 DIE RIESIGE GALEERE
5 ABWARTEN ALSO
6 WARUM MACHST DU SO WAS NUR?
7 DER MITTWOCHSORT
8 DER KAUGUMMIAUTOMATEN-GÜLLEKOLOGE
9 ICH HABE EINEN MONGO?
10 DIE ZUGFAHRT
11 WO LIEGT MEIN GEFÜHL?
12 NEUN MONATE
13 HARTHEIM
14 DAS ZEBRA IST EIGENTLICH EINE ILLUSION
15 WAS IST, WENN MAN SELBST NICHT MEHR IST
16 SPIELREGELN
17 AUSSICHT
1NOCH NICHTS
Ich hob ab, obwohl ich während der Arbeitszeit ungern abhebe. Normalerweise rufe ich ohnehin innerhalb von fünfzehn Minuten zurück, vor allem wenn Katja anruft, weil wir uns das so ausgemacht haben. Aber was gilt Ausgemachtes schon, seit es Handys gibt. Diesmal hob ich ab. Natürlich nicht beim ersten Mal, beim ersten Mal hebe ich nie ab, noch dazu, wenn Katja anruft, weil wir, wie gesagt, ausgemacht haben, dass ich so schnell wie möglich zurückrufe, spätestens aber nach fünfzehn Minuten. Beim zweiten Mal hob ich auch noch nicht ab, erst beim dritten Mal. Beim dritten Mal läuten, dachte ich, wird es wohl etwas Dringenderes sein, als dass sie mir sagen muss, ich soll noch Eier, Butter und Milch einkaufen, bevor ich heimfahre, oder ähnliches, das locker fünfzehn Minuten hätte warten können.
Ja, bitte?, sagte ich.
Ich hörte Katja nur schluchzen.
Was ist los?, sagte ich.
Kommst du bitte heim?, sagte sie nach einer kurzen Pause.
Jetzt gleich? Ist was passiert?, sagte ich, und, als sie mir darauf keine Antwort gab, mit etwas Nachdruck: Was ist passiert?
Ich versuchte trotz des Nachdrucks leise und gelangweilt zu reden und auch so zu wirken, um die Aufmerksamkeit und Neugierde der Arbeitskollegen nicht auf mich zu lenken.
Noch nichts, sagte Katja.
Wie bitte, sagte ich.
Noch ist nichts passiert, sagte sie, und jetzt komm!
Sie legte auf.
2WAS WEISST DU SCHON
Weißt du noch, wie ich dich damals in der Firma angerufen und darauf bestanden habe, dass du sofort heimkommst?, fragte Katja beim Frühstück, während sie vorsichtig ein pochiertes Ei auf das vor ihr auf einem Teller liegende mit Lachs belegte Brot legte.
Ja, als wäre es gestern gewesen, kaum zu glauben, dass es schon über zehn Jahre her ist, sagte ich. Wie kommst du jetzt darauf? Weil ich, als Papa vor einem Monat gestorben ist, auf einmal wieder die gleiche Panik bekommen habe wie damals.
Wegen Markus?
Sie nickte.
Aber warum wegen Markus? Ich dachte, dein Vater hat schon lange vorher alles geregelt gehabt?, sagte ich.
Trotzdem habe ich jetzt die Verantwortung, die ich nie haben wollte, und gleichzeitig schäme ich mich dafür, dass ich sie nie haben wollte, sagte sie. Damals habe ich sie nicht gewollt und jetzt auch nicht. Es hat sich nichts geändert. Noch dazu habe ich ihm damals, als ich davon erfahren habe, die Schuld dafür gegeben, dass ich mich überhaupt nicht richtig habe freuen können, sondern wegen ihm nur die Angst vor der Verantwortung gehabt habe, die möglicherweise auf mich zukommt, obwohl die Wahrscheinlichkeit äußerst gering war, wie alle Ärzte gesagt haben, aber was heißt das schon, du weißt ja, wie alt Mama war, da ist die Wahrscheinlichkeit auch äußerst gering gewesen. So wie ich ihm jetzt, wie Papa gestorben ist, die Schuld dafür gegeben habe, dass ich überhaupt nicht richtig habe trauern können, sondern wegen ihm wieder nur die Angst vor der Verantwortung gehabt habe, obwohl Papa, wie du gesagt hast, schon lange vorher alles geregelt hat.
Es wird schon werden, sagte ich und legte meine Hand auf ihre, so wie ich vor über zehn Jahren meine Hand auf ihre gelegt und gesagt hatte: Es wird schon werden. Wie man es halt so sagt, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, weil man eigentlich weiß, dass es genauso gut sein kann, dass es nicht werden wird und die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht werden wird, gar nicht mal so klein ist. Noch dazu, wenn man, wie Katja, grundsätzlich davon ausgeht, dass es bei allen Angelegenheiten, die mit Menschen und dem Menschlichen zu tun haben, nur eine Frage der Zeit ist, bis es nicht mehr werden wird. Im gleichen Moment, wie ich gesagt habe, dass es schon werden wird, habe ich gemerkt, dass sie es ebenfalls ganz genau gemerkt hat, dass ich nicht gewusst habe, was ich sagen soll, und dass es ihr lieber gewesen wäre, ich hätte gar nichts gesagt, zumindest nicht: Es wird schon werden.
Was weißt du schon, sagte sie, du hast ja keine Ahnung, was diese Verantwortung bedeutet. Aber das stimmte nicht mehr. Damals schon, damals stimmte es noch, aber heute stimmte es nicht mehr.
3ES WIRD SCHON WERDEN
Was weißt du schon, du hast ja keine Ahnung, was diese Verantwortung bedeutet, sagte Katja damals, als ich gesagt habe, dass es schon werden wird, und es stimmte ja auch, wie gesagt, ich wusste nichts und hatte keine Ahnung von der Verantwortung und davon, was auf uns würde zukommen können. Aber ich hatte nach ihrem Anruf auch mit etwas – für mich – viel Schlimmerem gerechnet. Einem Todesfall in ihrer Familie zum Beispiel. Oder etwas weniger Dramatischem wie einer Zyste auf der Gebärmutter, oder dass sie gekündigt worden war, ohne vorher etwaige Zeichen von ihrem Chef wahrgenommen zu haben, oder einem Autounfall mit lediglichem Blechschaden oder sonst irgendetwas in der Richtung. Etwas, was einen aus dem Alltag etwas hinausschmeißt, aber doch nicht so weit hinausschmeißt, dass man nicht mehr zurück hineinkommen würde können. Am Ende hatte es doch mit der Gebärmutter zu tun. Abseits sexueller Belange setzt man sich als Mann mit dem Unterleib der Frau ja kaum auseinander. Maximal setzt man sich als Mann mit den Monatszyklen der Frau auseinander, was natürlich indirekt wieder mit sexuellen Belangen zu tun hat. Auf den Gedanken mit der Zyste auf der Gebärmutter bin ich im zweiten Moment, als ich abgehoben habe, ja nur gekommen, weil Katja schon einmal wegen einer Zyste an der Gebärmutter operiert worden war und sie damals auch geschluchzt hatte, als sie mir davon erzählte.
Hast du mich angerufen, um mir zu sagen, dass ich Eier, Butter und Milch einkaufen soll?, rief ich vom Vorzimmer aus ins Wohnzimmer, nachdem ich gleich nach ihrem Anruf nach Hause gefahren war.
Sie fand das mit den Eiern undsoweiter nicht lustig, sagte nichts, sondern deutete mir mit der rechten Hand, in der sie ein mit Rotz und Tränen eingeweichtes Taschentuch knetete, mich an den Tisch zu setzen. Ich setzte mich also gegenüber von ihr hin.
Was ist los, was ist passiert?, sagte ich.
Noch nichts, sagte sie.
Das hast du mir schon am Telefon gesagt, sagte ich, also?
Sie fing wieder zu heulen an, schnäuzte sich immer wieder und sog dazwischen ruckartig Luft in ihre Lungen, wie es kleine Kinder tun, wenn sie in einem Wutanfall außer sich geraten.
Willst du einen Kaffee?, sagte ich.
Sie nickte.
Ich ging in die Küche und schaltete die Espressomaschine ein. Während sie sich durchspülte, holte ich die Schafmilch aus dem Kühlschrank. Seit Kurzem nahm sie zum Kaffee nur mehr Schafmilch. Milch sei ja grundsätzlich ungesund für den Darm und wegen der Wachstumshormone, die ja mutmaßlich krebserregend seien. Überhaupt herrsche in den heutigen Lebensmitteln geradezu eine Krebsübererregung, man könne eigentlich schon fast überhaupt nichts mehr essen und trinken, sagte sie immer. Aber die Schafmilch gehe, die Schafmilch habe im Gegensatz zur Kuhmilch mehr kurz- und mittelkettige Fettsäuren, dafür weniger langkettige wie die Kuhmilch und sei deshalb besser zu verdauen als die Kuhmilch. Also deshalb jetzt immer Schafmilch zum Kaffee anstatt der Kuhmilch. Ganz ohne Milch heißt es ja schließlich auch nichts, sagte sie immer, Krebserregung hin oder her. Die klassische österreichische Lösung, wie so oft, dachte ich mir. Ich drückte ihr einen Kaffee in ihre Tasse runter und füllte sie mit der guten Schafmilch auf, bis er hellbraun war. Ich ging zurück ins Wohnzimmer und stellte ihr den Kaffee hin. Bitteschön, sagte ich.
Danke, sagte sie.
Sie hatte sich wieder gefangen. Ihre Augen glänzten noch etwas und die Haut unter ihren Nasenlöchern war rot vom vielen Schnäuzen. Ich setzte mich wieder gegenüber von ihr hin und wartete.
Also?, sagte ich.
Die Regel ist mir ausgeblieben, sagte sie.
Okay, dachte ich, also doch wieder eine Zyste. Nein, es musste etwas Ernsteres sein als eine Zyste, wegen einer Zyste auf der Gebärmutter würde sie sicher nicht so ein Tamtam machen, dachte ich. Hat sie Krebs? Mir wurde ein bisschen schlecht. Oder einen Tumor vielleicht? Ihre Mutter hatte auch Gebärmutterhalskrebs, soweit ich mich erinnern konnte. Oder war es Brustkrebs? Ich wurde nervös.
Okay?, sagte ich, und weiter?
Ich bin schwanger, sagte sie.
Schwanger?, sagte ich. Ich war verblüfft. Aber auch erleichtert und irritiert zugleich. Mit dem hätte ich nicht gerechnet. Sicher, unter anderen Umständen hätte ich nach ihrer Aussage, dass ihr die Regel ausgeblieben sei, natürlich damit gerechnet, dass sie als Nächstes sagen würde, sie sei schwanger, das schon, wer hätte das denn nicht? Nur ihre Reaktion passte nicht dazu, weil sie doch sowieso immer Kinder haben wollte, dachte ich. Irgendwie war ich auch verärgert, weil ich mich aufgrund ihrer Reaktion gar nicht auf meine eigene Reaktion konzentrieren konnte. Also auf die Reaktion, wenn einem gesagt wird, dass man Vater wird. Schließlich war mir das vorher noch nie gesagt worden und das ist auch normalerweise ein Moment, den man nicht so schnell vergisst, beziehungsweise ein Moment, an den man sich immer wieder zurückerinnern würde, wie ich jetzt im Nachhinein auch bestätigen kann. Und in meiner Erinnerung kann ich kein für diese Situation übliches Gefühl wie Freude, Schock, Übelkeit, Frust, Angst, Sorge undsoweiter abrufen, sondern nur ein diffuses Gefühl von Rat- und Hilflosigkeit.
Aber das ist ja eine gute Nachricht, oder?, sagte ich trotzdem und vorsichtig. Ich freue mich! Obwohl, wie gesagt, von Freude meinerseits nicht die Rede sein konnte, weil ich mich nicht auf die Tatsache, dass sie schwanger war, hatte konzentrieren können, sondern nur auf ihre seltsame Reaktion darauf.
Oder ist es nicht von mir?, sagte ich zum Spaß, beziehungsweise in der Hoffnung, dass es auch tatsächlich ein Spaß und nicht wirklich wahr war.
Du spinnst, sagte sie zum Glück und lachte.
Was ist es denn dann?, sagte ich, innerlich erleichtert, ohne mir die Erleichterung anmerken zu lassen. Es passt doch eigentlich ganz gut momentan. Und den perfekten Zeitpunkt gibt es sowieso nie, oder? Irgendwas ist ja immer. Und wenn man vorher wüsste, was einen nachher erwartet, würde sowieso keiner Kinder kriegen, oder?
Darum geht es ja auch gar nicht, sagte sie.
Nicht?
Nein.
Um was geht es denn dann?, sagte ich.
Ich kann mich nicht freuen, sagte sie. Ich weiß, ich sollte mich freuen, zumindest erwarten alle von mir, dass ich mich freue, aber ich freue mich nicht, sosehr ich auch versuche mich zu freuen, sosehr ich auch versuche, mich in eine Frau, die gerade erfahren hat, dass sie schwanger ist und die sich darüber freut, hineinzuversetzen, ich schaffe es nicht. Nicht einmal die Nachahmung einer schwangeren Frau, die sich darüber freut, gerade erfahren zu haben schwanger zu sein, schaffe ich. Im Gegenteil fühle ich mich so, als hätte ich von einem Todesfall in der Familie erfahren. So als wäre die beste Freundin gestorben. Ich sollte mich schämen, oder?, sagte sie.
Es ist doch normal, dass einem in so einer Situation die Gefühle durchgehen, sagte ich.
Ich habe Angst, sagte sie.
Das ist doch auch ganz normal, sagte ich. Ich würde auch Angst haben, wenn in meinem Körper auf einmal noch ein Körper wachsen würde. Das ist irgendwie grauslich, findest du nicht auch? Wie in einem Science-Fiction-Film, Alien zum Beispiel.
Deswegen habe ich keine Angst, sagte sie, zumindest noch nicht.
Was ist es dann, sagte ich?
Es ist wegen Markus, sagte sie.
Wegen Markus?, sagte ich. Du hast Angst, das Kind könnte werden wie Markus?
Markus ist Katjas Bruder.
Sie nickte.
Aber du hast mir doch schon einmal erklärt, dass das nicht vererbbar ist, oder? Dass das bei der Zeugung passiert, und meistens auch bei älteren Frauen, nicht wahr?
Ja, das stimmt ja auch, sagte sie, aber … aber Mama war achtzehn Jahre alt, als sie mit Markus schwanger geworden ist. Da kann man wohl nicht von einer älteren Frau reden, oder?, sagte sie.
Nein, da kann man wohl nur von Pech reden, sagte ich und versuchte, sie etwas aufzuheitern.
Pech, Pech, was heißt hier Pech!, sagte sie. Soll ich mich darauf verlassen, dass ich kein Pech haben werde? Soll ich mich auf mein Glück verlassen?, oder auf Gottes Willen, oder was?, sagte sie. Außerdem, von Pech kann man reden, wenn man den Bus verpasst, und nicht wenn man ein behindertes Kind kriegt!, sagte sie.
Es tut mir leid, sagte ich, ich habe es nicht so gemeint.
Ja, mir tut es auch leid!, sagte sie. Wie hast du es denn gemeint? Mir hat es auch leidgetan, dass ich eine von den wenigen war, die Markus auch bei seinem Namen genannt haben. Als Kind habe ich zuerst geglaubt, er hat viele unterschiedliche Namen. Das war etwas Besonderes für mich, weil die anderen Kinder, die ich gekannt habe, nur einen oder maximal zwei Namen gehabt haben. Erst später bin ich draufgekommen, dass es gar nicht seine Namen gewesen sind, die ihm die Kinder nachgerufen haben. Mongo, Mongo!, haben sie gerufen, oder, Spasti, Spasti!, oder Psycho, Psycho!, und manchmal: Dillo, Dillo! Die haben es auch alle nicht so gemeint, wie sie mir später versichert haben. Noch heute zucke ich innerlich zusammen, wenn ich jemanden sagen höre: Du bist behindert!, oder Bist du behindert? Da geht mein Puls gleich wieder rauf, wenn ich nur daran denke! Aber heute stelle ich mich ja nicht mehr hin zu denen, um zu fragen, was sie denn für ein Problem haben, weil ich mich meine ganze Kindheit habe hinstellen müssen für meinen Bruder, wenn sie uns auf der Straße Hirni!, Hirnederl!, Missgeburt! oder Gestörter!, nachgerufen haben. Irgendwann bin ich müde geworden, mich für ihn hinzustellen, verstehst du? Ich wollte mich nicht mehr hinstellen, ich wollte meine Ruhe haben. Ich habe es überhört, obwohl ich es jedes einzelne Mal ganz genau gehört habe, manchmal habe ich sogar mitgelacht und so getan, als wäre er nicht mein Bruder, kannst du dir das vorstellen? Ich war zornig, er ist mir so auf die Nerven gegangen, wenn er zum zehnten Mal am Tag zu mir gesagt hat: AH, ICH WEISS SO WELCHES, MEINE BESTE SCHWESTER! DU BIST SO SCHÖN!, und mir dabei zärtlich den Kopf gestreichelt hat. Immer hat er mir zärtlich den Kopf gestreichelt. Hör endlich damit auf, mir den Kopf zu streicheln!, habe ich immer gesagt, noch dazu so zärtlich! Aber er hat nie damit aufgehört, mir den Kopf zu streicheln. Er hat einen Kopfstreichelzwang. Heute noch streichelt er mir den Kopf. In den unangemessensten Situationen streichelt er mir den Kopf, das weißt du ja selber, dir streichelt er ihn ja auch immer, nicht wahr? Aber dir macht es nichts aus, ich weiß, du findest das witzig, rührend oder süß und entzückend, aber dir wurde auch nicht vorher dein ganzes Leben grundlos zärtlich der Kopf gestreichelt. Durch seinen Kopfstreichelzwang habe ich eine Kopfstreichelphobie entwickelt, eine generelle Streichelphobie habe ich aufgerissen deswegen. Du weißt ja, wie unrund ich werde, wenn du mich streichelst, oder? Sofort steigt mein Puls, wenn du mich streichelst, und ich muss deine Hand nehmen und zur Seite legen, sonst müsste ich zu schreien anfangen. Obwohl ich immer wieder versuche, mich zusammenzureißen. Immer wieder denke ich mir: Lass ihn mich doch streicheln! Streicheln ist schließlich was Schönes, was Angenehmes, was Normales! Oxytocin, das Streichelhormon, soll angeblich ausgeschüttet werden dabei, aber nicht bei mir, bei mir wird im Gegenteil Adrenalin ausgeschüttet … er mag mich, darum streichelt er mich!, denke ich mir, wenn du mich streichelst, um eine zärtliche, romantische Situation herzustellen oder mich einfach zu beruhigen, streichelt er mich halt, denke ich mir, sagte sie. Ich konzentriere mich sogar auf diesen Gedanken, und trotzdem steigt das Bedürfnis in mir auf, in deine mich streichelnde Hand eine Gabel hineinzustechen oder eine Zigarette auf deinem Handrücken auszudämpfen und das, obwohl ich nicht einmal mehr rauche! Sofort würde ich am liebsten wieder zu rauchen anfangen in diesem Moment, nur um dir eine Zigarette auf dem Handrücken ausdämpfen zu können! Oder ich denke mir: Er streichelt mich, weil es ihn beruhigt, weil es ihm ein gutes Gefühl gibt, oder einfach nur aus Gewohnheit streichelt er mich, einfach beiläufig, wie man eine Katze streichelt, die sich einem unerwartet auf den Schoß setzt. Ist doch auch nichts Schlimmes daran, denke ich mir, während du mich streichelst, sagte sie. Hast du schon jemals gehört, dass sich jemand solche Dinge denkt, während er gestreichelt wird? Natürlich nicht, oder?
Ich wollte was sagen, aber sie merkte es gar nicht und redete über mich drüber.
Und die Erwachsenen haben ihn Rauschkind gerufen und meine Mutter beim Einkaufen an der Kassa gefragt, ob sie ihn zu heiß gebadet hat oder sie ihn vom Wickeltisch fallen hat lassen. Irgendwas wird sie ja wohl falsch gemacht haben, meine Mutter, weil so was passiert einem ja nicht einfach so, nicht wahr? Das kann ja nicht einfach nur ein Pech gewesen sein, oder? Gott würfelt schließlich nicht!, sagte sie, so sagt man doch, stimmt’s? Haben die es auch nicht so gemeint? Hm?
Es wird schon werden, sagte ich und legte meine Hand auf ihre, vermied es aber, sie zu streicheln, was ich sonst bestimmt getan hätte.
Was weißt du schon!, du hast ja keine Ahnung, was diese Verantwortung bedeutet, sagte sie.
Ich sagte nichts und schüttelte nur den Kopf. Ich wusste natürlich, dass ich nichts davon wusste. Wie auch?
Nach einer kurzen Pause sagte sie: Ich weiß ja, dass du es nur gut meinst, aber ich will kein Risiko eingehen, weißt du. Zumindest möchte ich mir sicher sein, dass es werden wird, sagte sie.
Es gibt Menschen, bei denen wird es fast immer, und es gibt welche, bei denen wird es fast nie, dachte ich. Ich gehöre zu denen, bei denen es fast immer wird. Ich habe keine Ahnung warum. Man könnte sagen, ich bin ein Glückskind. Du hast ja immer Glück im Leben gehabt, hat Katja immer zu mir gesagt. Es gibt andere, die nicht so viel Glück haben, die sich doppelt so viel anstrengen müssen, nur um die Hälfte von dem Glück zu haben wie du, hat sie gesagt, dachte ich. Das stimmte wahrscheinlich, ich konnte jedenfalls spontan nichts dagegen sagen. Zumindest hatte ich bis dahin noch nicht darüber nachgedacht, was natürlich auch ein Grund für ein gefühltes Glück beziehungsweise ein gefühltes Unglück in seinem Leben sein kann. Auf alle Fälle wollte sie sich in diesem Fall nicht darauf verlassen, dass es schon werden wird, das sagte sie ganz klar. Sie wollte alle medizinischen Möglichkeiten ausschöpfen, wie man so schön sagt, alle Eventualitäten berücksichtigen. Nur, was mich beschäftigte, was ich sie aber an diesem Tag nicht gefragt hatte, war: Was machen wir, oder besser, was macht sie, wenn alles medizinisch Mögliche ausgeschöpft war, alle Eventualitäten berücksichtigt worden sind und die Prognose trotzdem lautet, dass es nicht werden wird beziehungsweise es nicht so werden wird, wie sie es sich vorstellt? Was dann? Es wird ganz sicher nicht reichen, dass ich dann meine Hand auf ihre lege und sage: Es wird schon werden. Dann würde sie, würden wir eine Entscheidung treffen müssen, und die wollte ich nur treffen, wenn ich zumindest eine Ahnung hatte, was diese Verantwortung bedeutet. Natürlich, mehr als eine Ahnung konnte es nicht sein, aber diese Ahnung wollte ich untermauern, ich wollte möglichst viele Sichtweisen berücksichtigen, um meine eigene Sichtweise zu überprüfen und zu hinterfragen, damit ich was in der Hand hätte, bevor die Untersuchungen anfingen, ein Vergleichswerkzeug, eine Liste. Eine Liste mit zwei Seiten, Plus und Minus, Soll und Haben, Für und Wider. Und damit wollte ich als Erstes anfangen: mit meiner eigenen Sichtweise. Das würde nicht so schwierig sein, dachte ich, seine eigene Sichtweise kennt man ja schließlich, oder?
4DIE RIESIGE GALEERE
Ich muss sagen, bevor ich Katjas Bruder kennengelernt habe, waren meine Erfahrungen mit behinderten Menschen und Menschen, bei denen man sich gleich einmal fragt, ob mit ihnen irgendetwas nicht stimmt, beschränkt. Und hätte ich ihren Bruder nicht kennengelernt, zwangsläufig, dann wäre das wohl auch so geblieben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man bei Begegnungen mit diesen Leuten immer etwas irritiert ist, beziehungsweise dass ich es gewesen und ihnen deshalb, so gut es ging, aus dem Weg gegangen bin. Das ist doch normal, oder? Man weiß ja nie, wie die reagieren. Ich war sowieso schon von Haus aus schüchtern, da war mir der Gedanke, es könnte mich so jemand grundlos ansprechen, ein Horror. Was hätte ich dann sagen sollen? Ja, es war mir einfach peinlich. Geändert hat sich das erst, nachdem ich Markus kennengelernt habe, aber so weit sind wir noch nicht, ich möchte von vorne anfangen, ich möchte mich soweit zurückerinnern wie möglich … Zum Glück waren diese Situationen, in denen ich einem von ihnen begegnet bin, selten, weil die Leute, die behinderte Kinder hatten, sie von der Öffentlichkeit fernhielten. Um sie vor den Normalen und der sogenannten Welt da draußen zu schützen, oder um sie vor sich selbst zu schützen, oder weil sie sich für sie schämten, das wusste ich nicht so genau. Die erste Erinnerung, die ich von einem behinderten Menschen habe, ist von einem Kind, beziehungsweise ist es angeblich ein Kind in meinem Alter damals gewesen. Das wusste ich nur aus Erzählungen von meiner Mutter und den anderen Kindern aus der Nachbarschaft vom sogenannten Hörensagen. Die Familie wohnte in einem großen Einfamilienhaus, einer riesigen Galeere, wie meine Mutter immer dazu gesagt hat, etwas abseits von der Mehrfamilienhaussiedlung, in der wir wohnten. Die Frau kannten wir von ihren gelegentlichen, hastigen Spaziergängen, von Begegnungen beim Einkaufen und unseren Aufenthalten vor ihrem Haus. Den Mann sahen wir nur, wenn er mit seinem Auto zur Arbeit oder zurück fuhr. Er war Ingenieur in höherer Position, wie die Mutter gesagt hat, in einem der Schwerindustrie-Betriebe in der Gegend. Ein schrecklicher Mensch, wie sie sagte, ein richtiger Patriot, meinte aber Patriarch. Diese Verwechslung sollte später bei mir noch oft für Verwirrung sorgen, wenn sich Leute in meiner Gegenwart, oder in den Medien, als stolze Patrioten bezeichneten. Auf jeden Fall soll dieser richtige Patriot, den Erzählungen meiner Mutter nach, seine Frau sehr schlecht behandelt haben. Ein jähzorniger Pedant sei er gewesen, ein sogenannter Itüpftelreiter, der die Frau an der kurzen Leine gehalten habe. Er starb dann auch wirklich verdient an einem Herzanschlag, wie meine Mutter gesagt hat. Wir bekamen ihn selten zu Gesicht. Meistens dann, wenn er mit seinem weißen Mitsubishi Galant mit überhöhter Geschwindigkeit, wie man so schön sagt, aus der abschüssigen Ausfahrt bog, die mit einem schweren schmiedeeisernen Tor versperrt war, den die Frau nur unter größter Anstrengung zur Seite schieben konnte, während der Mann derweil ungeduldig im Auto wartete und sie so lange mit der Lichthupe anfeuerte und antrieb, bis sie es geschafft hatte. Als er bei uns vorbeirauschte, pendelte der schwarz glänzende Rosenkranz mit dem wuchtigen Kreuz, der am Rückspiegel befestigt war, wild hin und her, sodass er sich seitlich wegducken musste, weil er mit dem Kopf immer knapp an der Windschutzscheibe fuhr. Den Garten und den Rasen musste die Frau in Schuss halten. Alles war sehr gepflegt. Die Thujen waren aus akkurat geschnittenen Quadersäulen zu einer blickdichten Wand zusammengewachsen, die Buchs-Sträucher zu verschieden großen Kugeln getrimmt und der Rasen war kurz und dicht. Einmal sahen wir, als wir wieder mal vor dem Haus herumlungerten, in der Hoffnung, einen Blick auf das behinderte Kind erhaschen zu können, wie sie mit einem Haarkamm die Reste des Rasenschnitts aus dem Rasen kämmte und in einer Tupper-Jausenbox einsammelte. Den Inhalt leerte sie dann auf einen quadratisch mit Maschendraht eingezäunten Rasenschnitthaufen. Sie trug fast immer aufgesteckte Haare, einen Rock, der über die Knie reichte, eine Kleiderschürze und gelbe Gummihandschuhe an den Händen, mit denen sie ununterbrochen an den Pflanzen, Blumen und Sträuchern abgestorbene Blätter entfernte und, dabei auf dem Boden kniend, Unkraut aus dem Rasen zupfte und in der besagten Tupper-Jausenbox einsammelte. Vor dem Fenster, hinter dem wir das behinderte Kind vermuteten, war ein kleiner Balkon, auf dem sie in mehreren Töpfen dicht nebeneinander Sonnenblumen gepflanzt hatte, die uns leider, wenn wir in den langen und langweiligen Sommerferiennachmittagen vor dem Haus herumlungerten, die Sicht auf das eigentlich große Panoramafenster und somit auf das behinderte Kind verdeckten. Mit einer großen orangenen Plastikgießkanne, an der ein Aufkleber einer Sonnenblume angebracht war und die immer an derselben Stelle des Balkons stand, sahen wir ihr von der Straße aus zu, wie sie regelmäßig die Sonnenblumen goss. Hin und wieder winkte sie uns zu, dann winkten wir zurück und täuschten irgendeine Beschäftigung vor, wie Tempelhüpfen, Völkerball oder Verstecken spielen. Andere Kinder aus anderen Siedlungen trafen einander an diesen langen und langweiligen Sommerferiennachmittagen tatsächlich zum Tempelhüpfen, Völkerball oder Versteckenspielen, wir trafen einander bei der riesigen Galeere immer nur, um diese Spiele vorzutäuschen und dadurch womöglich einen Blick auf das behinderte Kind zu erhaschen, und ich kann mich auch nach noch so anstrengendem Nachdenken nicht mehr sicher erinnern, ob wir das behinderte Kind auch wirklich einmal zu Gesicht bekommen haben. Ich kann mich nur mehr daran erinnern, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Erinnern kann ich mich nur mehr an das Gefühl, das ich hatte, als wir an diesen langen und langweiligen Sommerferiennachmittagen vor dem Sonnenblumenbalkonfenster der riesigen Galeere herumlungerten, um einen Blick auf das behinderte Kind zu erhaschen, und wie wir uns gegenseitig ausmalten, wie es wohl aussähe, das Kind, und wie verkrüppelt und verkümmert seine Gliedmaßen wohl wären oder wie verzerrt sein Mund vermutlich war, aus dem, so stellten wir uns vor, der Speichel heraustropfte, und wie weiß seine Haut sein musste, direkt durchsichtig musste sie sein, dass man den Verlauf der darunter liegenden Adern in blauen Linien am ganzen Körper sehen können musste, mutmaßten wir, weil das Kind statt Sonne ja nur Sonnenblumen gesehen hatte sein Lebtag, und dass die Haut, käme sie einmal an die Sonne, augenblicklich von ihren Strahlen verbrannt werden würde, und etliche andere Details stellten wir uns vor, während wir vor der Ausfahrt unsere Fahrräder umdrehten, um die Kette zu spannen oder zu schmieren, obwohl das gar nicht nötig gewesen war. An das Gefühl von Mitleid und aufregendem Grusel kann ich mich erinnern, die einem die Angst vor dem Unbekannten beschert. Geendet haben die Lauereinsätze vor dem Sonnenblumenbalkonfenster der riesigen Galeere, kurz nachdem der Mann den von der Mutter so genannten Herzanschlag erlitten hatte und verstarb. Und zwar an einem der ersten warmen Nachmittage im April, an dem wir wieder mal vor dem Balkon, diesmal ohne Sonnenblumen – es war noch zu früh dafür – herumlungerten. Ich erinnere mich genau an den Jauchegestank, der seit Tagen in der Luft hing, weil die Bauern, wie jedes Frühjahr, auf die angrenzenden Felder ihre Jauche ausspritzten und der mich in dem Moment besonders irritierte, in dem zwei Männer des Roten Kreuzes in ihren roten Uniformhosen und weißen Polohemden einen leeren Rollstuhl aus dem Haus trugen, in ihrem Krankenwagen verstauten und nach einem kurzen Wortwechsel mit der Frau einstiegen und wegfuhren. Mühsam schloss die Frau das schmiedeeiserne Tor zur Auffahrt, das sie seitdem auch nie wieder aufgemacht hatte.
Im Großen und Ganzen musste ich sagen, dass die Erinnerungen um und an das unsichtbare behinderte Kind in der riesigen Galeere keine schönen Erinnerungen waren, beziehungsweise waren es Erinnerungen, die keine angenehmen Gefühle bei mir auslösten, sondern nur weitere Fragen aufwarfen, auf die damals wie heute niemand eine Antwort für mich hatte, beziehungsweise für die sich damals wie heute keiner wirklich interessierte, und dass ich für meine Liste in diesem Fall keine brauchbaren Daten verwerten konnte, die mir bei der Entscheidungsfindung hätten helfen können, außer die bemerkenswerte Unsichtbarkeit einer Existenz, falls sie überhaupt wirklich existiert hatte. Zumindest waren sie mir zu dem Zeitpunkt, an dem ich ganz am Anfang meiner Recherchen stand, nicht aufgefallen.
5ABWARTEN ALSO
Um Katja nicht noch mehr aufzuregen, sagte ich ihr einmal nichts zu meinen Nachforschungen und meinem Plan mit der Liste. Sie hätte sowieso abgeblockt und nichts davon wissen wollen. Es fiel ihr vorher schon schwer darüber zu reden, zumindest mit mir, da wollte ich sie in der momentanen Situation nicht zusätzlich sekkieren. Außerdem hatte sie, im Gegensatz zu mir, schon ihr ganzes Leben Zeit gehabt, sich ihre Meinung zu diesem Thema zu bilden. Zeit hätte ich auch gehabt, interessiert hat es mich nur nicht. Ich beschloss einmal abzuwarten und sie im geeigneten Moment in ein Gespräch zu verwickeln, um ganz nebenbei Genaueres zu ihrer Sichtweise über ihr Leben mit ihrem behinderten Bruder zu erfahren. Sie schien die Schwangerschaft generell auszublenden und erst gewillt, sie voll zu akzeptieren, wenn sie schlussendlich von jemandem die gewünschte Gewissheit, nämlich, dass alles werden wird, ausgesprochen bekam. So kam es mir zumindest vor. Abwarten also.
6WARUM MACHST DU SO WAS NUR?
Zum Glück waren diese Situationen, in denen ich einem von ihnen begegnet bin, selten, habe ich geschrieben, oder? Beim Durchlesen meiner Notizen fällt mir gerade auf, dass das gar nicht stimmt! Man muss nur lange genug nachdenken und in sich hineingraben, um das Passende, irgendwann vorher wegen vermeintlicher Unbrauchbarkeit in einem Vergrabene, wieder auszugraben. Hat nicht meine Mutter immer gesagt: Was du weißt, habe ich schon längst wieder vergessen?, und müsste es nicht heißen: Was ich weiß, habe ich schon längst wieder vergessen? Oft natürlich zum Glück und der eigenen Gesundheit zuliebe. Auf jeden Fall habe ich plötzlich den Namen Albert in mir ausgegraben. Eigentlich musste ich ihn gar nicht ausgraben, im Gegenteil, er war die ganze Zeit da gewesen, fast täglich habe ich an ihn gedacht, an was ich nicht mehr gedacht habe, was verschüttet gewesen ist, war die Verbindung zu dem Namen, die Person, die den Namen gehabt und die ihn zu dem gemacht hat, was er für mich, sosehr ich mich auch dagegen sträube, immer noch ist: Ein Schimpfwort. Man wurde damit beschimpft und war somit ein Albert. Immer, wenn ich jemanden mit dem Namen Albert getroffen habe, war ich sofort peinlich berührt und die Frage Was, du heißt Albert?, beziehungsweise Was, du bist ein Albert? lag mir auf der Zunge, wie man so schön sagt, und ich musste sie mit Gewalt wieder hinunterschlucken und an etwas anderes als den Namen Albert denken. Wenn die Schulverderber einen beim Nachhauseweg in die Mangel genommen haben, hat man ein paar Arschtritte kassiert und ist dann mit dem Ratschlag: Verschwinde du Albert, sonst hagelt es Genickwatschen undsoweiter verscheucht worden. Der Name Albert Einstein als sogenannter Inbegriff für das menschliche Genie war für mich immer unpassend und unbegreiflich. Ein Albert konnte kein Genie sein. Der Name Albert war von Kind auf besetzt mit Zurückgebliebenheit, Ausgrenzung und Scham, dachte ich. Der mit dem Namen als Schimpfwort für mich so für immer in Verbindung gebrachte und leibhaftige Albert war, soweit ich weiß und was mir meine Mutter erzählt hat, der einzige Down-Syndrom-Mensch in unserem Dorf und der erste, den ich persönlich kennengelernt habe. Natürlich benutze ich erst jetzt das Wort Down-Syndrom-Mensch, weil damals weder ich, meine Familie, noch sonst jemand in meinem Freundes- und Bekanntenkreis den Begriff Down-Syndrom, geschweige denn die Bezeichnung Trisomie 21 für die mutmaßliche Krankheit kannte. Er hieß einfach der Albert oder das Mongerl. Damit wusste jeder Bescheid. Ach so, der Albert oder: wer? Das Mongerl?, undsoweiter hat es immer geheißen, wenn von ihm die Rede war. Für uns war er ein Geburtsschaden, ein Kuriosum, ein Auslachobjekt, eine kostenlose Zirkusattraktion. Aber er war auch jemand, dem man nichts antun und den man nicht hänseln durfte, weil er ja nichts dafürkonnte, wie der Vater immer gesagt hat, dachte ich. Lasst den Albert in Ruhe, oder, lasst das Mongerl in Frieden, er, beziehungsweise es, kann ja nichts dafür, hat er gesagt. So wie man keine unschuldigen Tiere quälen oder Regenwürmer und Schnecken nur so zum Spaß zusammentreten durfte.
Dass ich da ja nichts zu hören kriege!, hat er gesagt. Leider hat er was zu hören gekriegt. An das, was er zu hören gekriegt hat, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, beziehungsweise hat es mir mein Vater nie gesagt, ich kann mir aber schon vorstellen, was es gewesen ist. Gut erinnern kann ich mich auf alle Fälle an den Sonntagnachmittag, an dem es an der Tür geläutet hat. Schon allein deswegen, weil an unserer Tür selten jemand läutete. Und wenn einmal jemand läutete, gab es meistens einen Tumult in der Wohnung, weil sich mein Vater immer darüber aufregte, dass jemand, unabhängig davon, wie spät es war, um diese Uhrzeit bei uns anläutete. Wer läutet denn um diese Uhrzeit an!, oder, wer ruft denn um diese Uhrzeit an!, schrie er laut durch die Wohnung, meistens dabei in der Unterhose auf der Couch liegend und den Kopf hinter einer Zeitung versteckt. Die Mutter ist dann immer blitzartig aus ihrem Ohrensessel aufgesprungen oder aus der Küche in Richtung Haustür gerannt und hat, meinen Vater damit beschwichtigen wollend, dabei vor-sich-hin-ge-PSCHT und zusätzlich kalmierende Gesten mit Händen und Armen gemacht. PSCHT!, PSCHT!, PSCHT!, hat sie gemacht und gleichzeitig mit den Armen geflattert wie eine auf dem Boden tollpatschig dahinhüpfende Taube mit ihren Flügeln, weil sie sich wegen der künstlichen Aufregung des Vaters vor dem Anläuter beziehungsweise der Anläuterin oder den Nachbarn im Allgemeinen geschämt hat. Schnell wurden alle offenen Fenster von ihr geschlossen, um ein Hinausdringen des privaten Tumults in die Öffentlichkeit zu verhindern. Ich konnte nie herausfinden, welche Uhrzeit eine passende und welche Uhrzeit eine unpassende war, auf alle Fälle war es, wie es mir vorkam, jederzeit eine Frechheit, um diese Uhrzeit anzuläuten beziehungsweise um diese Uhrzeit anzurufen. An diesem Sonntagnachmittag, als es geläutet hatte, war meine Mutter gerade im Garten vor dem Mehrfamilienhaus, in dem wir wohnten, um Rhabarber für ein Rhabarberkompott zu schneiden, weshalb mein Vater genötigt war, selbst von der Couch aufzustehen, um dem Anläuter oder der Anläuterin die Tür aufzumachen, beziehungsweise dem Anläuter oder der Anläuterin die Frechheit des sonntäglichen Anläutens, noch dazu um diese Uhrzeit, möglichst unfreundlich mitzuteilen. Mit den Worten Wer läutet denn am Sonntag um diese Uhrzeit