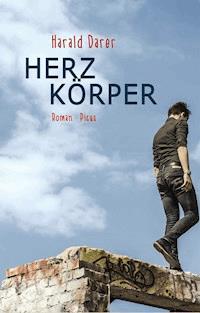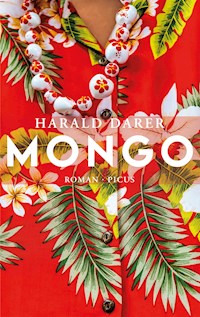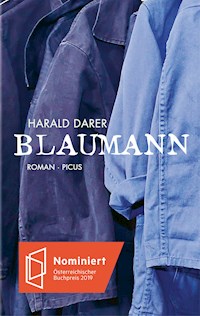18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Brüder haben in derselben Nacht Autounfälle, die ganz unterschiedlich ausgehen: Während der eine mit einem Blechschaden davonkommt, wird der andere schwer verletzt. Eine Einladung nach Indien stellt all das Zauberhafte, Magische in Aussicht, was man sich von einer Reise auf den Subkontinent erwartet: doch nichts davon wird erfüllt: Die Reise stellt sich als Aneinanderreihung von kleinen Katastrophen heraus, aus denen man eigentlich nichts lernen kann, die aber das eigene Leben grundlegend auf den Prüfstand stellen. Immer sind es Momente, deren Bedeutung sich erst im Nachhinein manifestiert, die aber prägend für das weitere Leben der Protagonisten sind. Harald Darer versteht es, den Blick auf diese Momente zu fokussieren und daraus ein Universum zu schaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Copyright © 2025 Picus Verlag Ges.m.b.H.
Friedrich-Schmidt-Platz 4/7, 1080 Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien
Umschlagabbildung: © La Cassette Bleue / iStockphoto
ISBN 978-3-7117-2164-8
eISBN 978-3-7117-5536-0
Informationen über das aktuelle Programm
des Picus Verlags und Veranstaltungen unter
www.picus.at
Harald Darer
Makula
Erzählungen
Picus Verlag Wien
Inhalt
Arbeitet in deiner Firma ein Zahnarzt?
Plunderkind
Sonnenfinsternis
Rinderwahn
Als ich mich einmal in die Pornodarstellerin August Ames verliebte
Party in Belgrad
In der Mitte der Netzhaut gibt es
einen Bereich, in dem die Sehzellen
besonders dicht angeordnet sind: die
Makula. Hier befindet sich, so heißt
es, der Bereich des schärfsten Sehens.
Arbeitet in deiner Firmaein Zahnarzt?
Du weißt aber schon, dass sie für morgen Regen angesagt haben, sagte mein Vater. Ich schätze, er wird Mitte vierzig gewesen sein, wie er das zu mir an diesem Freitagabend im Juli gesagt hatte. Ich achtzehn. Er war in dem Alter, in dem man sich jeden Abend die Wettervorhersage für den nächsten Tag anschaut, obwohl man nichts vorhat, und ich war in dem Alter, in dem man sich die Wettervorhersage nie anschaut, auch wenn man was vorhat.
Das ist ein schönes Beispiel für den mit dem Alter einhergehenden Verlust der gedankenlosen Unbeschwertheit, denke ich. Jetzt, wo ich ungefähr in dem Alter bin wie mein Vater damals, fällt mir auf, dass ich mir, wenn sonst schon nichts anderes, auch wirklich zumindest die Wettervorhersage für den nächsten Tag anschaue, obwohl ich nichts vorhabe.
Ich zuckte mit den Schultern, wie immer, wenn mir mein Vater die Wettervorhersage für den nächsten Tag ansagte, im gleichen Ton wie der Wetteransager aus dem Fernsehen, so, als wäre er selbst der Wetteransager, und zwar deswegen, weil ich etwas vorhatte. Tom hatte mich überredet, mit ihm fischen zu gehen, obwohl ich eigentlich kein Fischer war und nur sehr selten zum Fischen ging, aber seine üblichen Fischerkollegen hatten alle keine Zeit an diesem Samstag, also ließ ich mich überreden. Als um drei Uhr in der Früh mein Wecker läutete, bereute ich sofort, zugesagt zu haben, und wollte auch schon darauf pfeifen, schaffte es aber doch irgendwie, aufzustehen. Ich zog die Jalousien hoch und schaute aus dem Fenster. Ich konnte nicht viel erkennen, es war noch stockfinster. Nur die Regentropfen, die vom Wind gegen die Scheiben geweht wurden, und das Prasseln auf der blechernen Fensterbank konnte ich durch das geschlossene Fenster hören. Ich ließ die Jalousien wieder runterrasseln, schaltete zuerst einmal nur die Nachttischlampe ein und setzte mich auf den Bettrand, die Ellbogen auf die Knie gestützt, das Gesicht in beide Handflächen gelegt. Immer schon war mein erster Gedanke in der Früh in dem Moment, in dem der Wecker läutete: Bitte erschießt mich! Schon als Volksschulkind dachte ich mir, wie meine Mutter ins Zimmer hereingekommen war, absichtlich laut die Tür und das Fenster aufgerissen, die kalte Luft hereingelassen und mir mit ihren Fingern die Haare zerzaust hatte, deren Haut vom andauernden Waschen und Putzen ganz rau war, dass sich einzelne Haare darin verfingen und aus meiner Kopfhaut gezupft wurden, weil der Kopf das Einzige war, das aus der Tuchent herausschaute, unter der es angenehm warm und heimelig war: Bitte erschießt mich. Ich hasste meine Mutter jeden Morgen dafür, dass sie mich aus meiner heimeligen Welt herausgerissen und in die andere, feuchtkalte, mit der ich nichts zu tun haben wollte, hineinschupfte, so wie mich heute meine Kinder hassen, wenn ich sie in der Früh immer für sie viel zu früh aufwecke und aus ihrer heimeligen Welt herausreiße, obwohl ich versuche, es so sanft wie möglich zu tun, und nicht wie meine Mutter noch dazu mit den ewig gleichen Worten: Auf, auf, ihr müden Hasen, hört ihr nicht den Jäger blasen! Erst nach circa einer halben Stunde und nachdem ich meinen Kakao getrunken und mein Honigbrot gegessen hatte, das sie mir jeden Tag herrichtete, ging es langsam wieder, und ich war dann doch froh, dass niemand gekommen war, um mich zu erschießen, und ich weiterleben konnte. Zumindest bis zum nächsten Tag in der Früh, wo ich mir wieder dachte: Bitte erschießt mich! Das soll mein ganzes Leben so weitergehen?, dachte ich. Jeden Morgen der Wecker und ich: Bitte erschießt mich? Heute weiß ich: Leider ja, es ging so weiter. Schule, Lehre, Bundesheer, Beruf, Kindererziehung, überall und immer hatte man in der Früh aufzustehen. Und deshalb auch an diesem Morgen wieder der Gedanke: Bitte erschießt mich! Nur dass mir diesmal niemand einen Kakao und ein Honigbrot hergerichtet hatte. Ich stand auf und ging ins Bad. Ich zog mir mein Schlaf-T-Shirt aus und stellte mich vor den an der Wand montierten Heizstrahler. Ein massives Teil aus den siebziger Jahren mit einer fetten Glühwendel. Er leuchtete mir im dunklen Badezimmer rot ins Gesicht. Ich hielt es so lange davor hin, bis mir die Augenlider brannten. Dann erst schaltete ich das Licht am Badezimmerspiegel ein. Obwohl ich achtzehn Jahre alt war und ich meiner Mutter am Vorabend gesagt hatte, dass sie es mir nicht herzurichten brauchte, ich sei alt genug, es mir selbst herzurichten, hatte sie mir mein Gewand natürlich hergerichtet gehabt, so, wie sie beim Frühstück immer darauf bestand, die Butter und den Honig auf mein Brot zu schmieren, obwohl, oder wahrscheinlich gerade deswegen, weil ich immer sagte, sie soll mich doch bitte mein Brot selbst schmieren lassen, ich sei achtzehn Jahre alt, vor allem, wenn ein Freund oder, noch schlimmer, ein Mädchen dabei war, das bei mir übernachtet hatte. Nicht selten kam es zu Rangeleien um das Buttermesser, an dem meine Mutter mit einer Hand eisern festhielt und mit der anderen, die sie dadurch ebenfalls verkrampfte, dabei fast den Teebutterziegel zerquetschte, während ich versuchte, das Messer durch das einzelne Auf- und Zurückbiegen ihrer Finger aus ihrer Hand zu kriegen. An diese Brotschmierdiskussionen und Buttermesserrangeleien musste ich denken, als ich mein Gewand, gebügelt und zusammengelegt, auf der Waschmaschine liegen sah. Einmal werde ich weggezogen oder meine Mutter wird gestorben sein, dachte ich, während ich mir das nach ihrem speziellen Weichspüler riechende und mich dadurch immer an sie erinnern werdende Gewand anzog. Erst dann werden die Brotschmierdiskussionen und Buttermesserrangeleien aufhören, dachte ich.
Ich zog mir Socken an, darüber noch dicke Wollstutzen, und stieg in die klobigen, mit Dreck verkrusteten Bergschuhe. Der eingetrocknete Dreck musste schon einige Jahre alt sein, dachte ich, weil ich genauso oft wandern ging wie fischen. In meinen Rucksack packte ich ein Victorinox-Taschenmesser, Brot, eine Stange Dürre (Braunschweiger), zwei Paradeiser, drei Dosen Gösser-Bier, einen Blumentopfhut und eine rote Regenpelerine. Ich schulterte den Rucksack, ging, so leise wie mit den klobigen Bergschuhen möglich, die zwei Stockwerke hinunter ins Erdgeschoss, stellte den Rucksack neben der Stiegenhaustür ab und ging noch einen Stock weiter hinunter in den Keller, wo meine Eltern ein Kellerabteil hatten, in dem, so hoffte ich, meine Angel, die ich zu meinem Geburtstag, ich glaube, es war mein zwölfter, von meinem Vater geschenkt bekommen hatte, von meiner Mutter verstaut worden war, wie alle meine Kindheitsreliquien, die sie in dem Kellerabteil hortete. Das Kindheitsreliquienkellerabteil meiner Eltern lag neben dem Kellerabteil ihres eitrigen Nachbarn, wie sie ihn nannten, weil das Weiß seiner Augen aufgrund einer Hepatitis-C-Erkrankung ganz gelb war. Gelbsucht, wie meine Mutter immer sagte und aber gleichzeitig eine Bewegung mit der Hand machte, die ein Nippen andeutete. Einen Leberschaden bekam man ihrer Meinung nach in erster Linie vom Saufen und war also grundsätzlich selbst verschuldet. Ich schaltete das Licht ein. Die Leuchtstofflampe brauchte ein paar Anläufe, bis sie startete, und gab, auch als sie nach sekundenlangem Flackern endlich gestartet war, nur wenig Licht durch die über die Jahre vergilbte und mit Spinnweben überwucherte Kunststoffabdeckung ab. Es fiel mit einem eine traurige Vergeblichkeit in mir auslösenden Gefühl auf den auf einem vollgerammelten Tisch über viele Jahre zusammengeläpperten Haufen von Dingen. In dem Moment kam mir der Gedanke, wahrscheinlich auch, weil ich mir vorher auf der Bettkante sitzend gedacht hatte, dass man mich bitte erschießen soll: Was weiß ich schon vom Sterben? Den Großteil des Tisches nahm der von meinem Vater selbst gebaute und mit einem Gleichstrommotor inklusive stufenlos einstellbarer Drehzahlregelung ausgestattete Fleischwolf ein. Auf dem rot lackierten Gehäuse klebte eine dicke Staubschicht. In diesem Fleischwolf wurden früher vierteljährlich die Reste der vom humpelnden, immer lachenden und rotbackigen Fleischhacker Augustin in der dem Kellerabteil angrenzenden Waschküche zerlegten Sau faschiert. Unter Beaufsichtigung meines Vaters durfte ich die groben Fleischstücke und Schwarten mit einem Holzknüppel in die Öffnung des Fleischwolfs drücken und je nach Bedarf die Drehzahl rauf oder runter regeln. An der Vorderseite wurde das Fleisch durch ein Rohr und eine Art Sieb in Form von Spaghetti in eine große Plastikschüssel gepresst, von wo meine Mutter es heraushob und portionsweise zum Einfrieren in Toppits-Gefrierbeutel mit einem Vakuumgerät einschweißte, während mein Vater die ganze Zeit die Zerlegkünste des Fleischhackers Augustin lobte. Eine Sau so zu zerlegen, sei eine Kunst und der Fleischhacker Augustin ein Zerlegungskünstler, sagte er in einer Tour und so laut, dass es der in der Waschküche werkende Fleischhacker Augustin auch gut hören konnte. Komplimente konnte mein Vater immer nur indirekt aussprechen und einem nie direkt ins Gesicht sagen. Direkt ins Gesicht konnte er einem nur sagen, was ihm nicht passte und was man, seiner Meinung nach, falsch machte, oder aufmunternde Sätze wie: Wie der den Schraubenzieher schon hält!, ich kann gar nicht hinschauen!, oder: So kann das nichts werden! Das Herausdrücken der Fleisch-Spaghetti durch das Sieb des Fleischwolfs hat mir immer gefallen, der Anblick hatte etwas Beruhigendes. Auch den Geruch empfand ich als angenehm. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal einen Sauschädel auf der Arbeitsplatte des Fleischhackers Augustin liegen sah und die Schweineaugen, mit den schönen, langen Wimpern. Danach wollte ich es nicht mehr machen, ich wollte niemanden, der so schöne lange Wimpern besaß, durch einen Fleischwolf drücken. Der Tisch, auf dem der Fleischwolf stand, war mit einer bei mir ebenfalls etliche Kindheitserinnerungen auslösenden Plastiktischdecke bedeckt. Auf diese Plastiktischdecke wurden viele Jahre bei den verschiedensten Festen Köstlichkeiten von meiner Mutter gestellt. Den teuren Küchenholztisch, den meine Eltern beim Einzug in die Wohnung gekauft hatten, habe ich nie zu Gesicht bekommen, weil der immer von diversen Plastiktischdecken abgedeckt war, die abhängig von Jahreszeit oder den verschiedenen Anlässen von meiner Mutter aufgelegt und an den Tischkanten mit metallenen Klipsen befestigt worden waren. Als der Küchentisch später durch einen größeren und im Stil moderneren ausgetauscht wurde, war er quasi neu und mein Vater sagte stolz zu mir: Siehst du, so schauen die Sachen aus, wenn man auf sie aufgepasst hat. Dann verluden wir den Tisch auf den Anhänger und brachten ihn zum Sperrmüll. Auf seinen größeren, moderneren Nachfolger wurde sofort nach der Lieferung von meiner Mutter eine ebenfalls neue Plastiktischdecke gelegt und mit der größten Selbstverständlichkeit und den metallenen Klipsen an den Tischkanten fixiert. Die hellgrüne Plastiktischdecke mit den roten, gelben und blauen Blumenmustern, die Gustav Klimts Farmgarten mit Sonnenblumen nachgeahmt war und auf der jetzt im Keller der Fleischwolf stand, kam immer nur zu festlichen Anlässen zum Einsatz, dachte ich, als ich den ganzen Krempel im Kindheitsreliquienkellerabteil meiner Eltern nach der Angel absuchte. Alte Flaschen Riesling standen in der Ecke, von einem jahrelang zurückliegenden Besuch von Verwandten aus dem Pfälzischen, ein blauer Plastikanker, in dessen Schaft ein Bleizylinder steckte, den mein Vater unzählige Male bei unseren Istrien-Urlauben aus dem Meer herauftauchen hatte müssen, weil er sich verfangen hatte zwischen scharfkantigen Felsen oder einem versenkten Autoreifen und sich nicht mehr herausziehen ließ, ein Billigsdorfer-Kescher, ebenfalls aus einem dieser Istrien-Urlaube, wie sie heute noch an den Strandständen der Urlaubsorte angeboten werden und die normalerweise nach einmaligem Gebrauch wegzuschmeißen weil kaputt sind, alte Schuhe, Arbeitsmäntel und Blaumänner meines Vaters mit dem Logo der Bude an der Brust, in der er noch sein Leben lang arbeiten würde, Arbeitshandschuhe, ein Stapel Trennscheiben für seinen daneben liegenden defekten und zerlegten Flex-Winkelschleifer, Badfliesen im Stil der siebziger Jahre, weil sie wirklich noch aus den siebziger Jahren stammten, Autoreifen ohne Felgen, Radreifen, Schläuche, dazugehöriges Flickzeug, Ventile undsoweiter undsofort.
Ich schaute auf die Uhr. Ich war schon spät dran. Wo war die Scheiß-Angel, verdammt? Dann endlich sah ich sie hinter einem Strauß Plastikblumen hervorstehen. Sie war hinter den Tisch gerutscht. Ich fummelte sie heraus, sie war staubig, sonst fast ungebraucht, weil ich, wie gesagt, sehr selten zum Fischen ging. Daran, wann ich das letzte Mal gewesen war, konnte ich mich nicht mehr erinnern. Der Griff war sogar noch in Cellophan eingeschweißt. Woran ich mich noch erinnerte, war der Tag, an dem ich sie von meinem Vater geschenkt bekommen hatte. Wir schienen beide überrascht, er darüber, warum er sie mir schenkte, und ich darüber, warum ich sie geschenkt bekam. Wir wussten beide nicht den Grund, weil es ja auch keinen gab. Ich hatte mir nichts gewünscht, weil ich die vergangenen Jahre außer Geldgeschenken nichts bekommen hatte, und er hatte mich vorher auch nicht gefragt, ob ich mir etwas anderes als Geldgeschenke wünschte. Warum er mir die Angel gekauft hatte, ist mir bis heute ein Rätsel. Genauso wie die Modelleisenbahn, den Matador-Kasten und das Lego-Technik-Set, die ich zu anderen Anlässen wie Weihnachten und Ostern bekommen hatte. Wahrscheinlich wollte mein Vater mir damit sein persönliches Interesse an mir bekunden, bekundete durch die Geschenke allerdings nur das Interesse an den Dingen, die ihm etwas bedeuteten. Ich interessierte mich für Bücher und Musik, bekundete aber mein Interesse daran anscheinend bei meinem Vater zu wenig, als dass es ihm aufgefallen wäre. Ich nahm die Angel, sperrte das Kellerabteil zu, ging die Stiege wieder rauf, schnappte meinen Rucksack und ging raus. Es regnete noch immer. Ein gerader, unaufgeregter Schnürlregen. Ich lief zum Parkplatz, wo mein Auto stand, ein silberner Mazda 626, Baujahr 84, der schon hundertsechzigtausend Kilometer auf der Uhr hatte, als ich ihn kaufte. Ohne die Geldspritze meines Vaters von ein paar Tausend Schilling, die den größten Teil des Kaufpreises ausgemacht hatte, hätte ich ihn mir aber trotzdem nie leisten können. Ich schmiss mein Zeug in den Kofferraum und stieg ein. Jetzt aber schnell, Tom wartete sicher schon beim Karpfen-Petrus, wie der Fischteich mit angeschlossener Buschenschank hieß. Ich freute mich ja mehr auf den Most danach in der Buschenschank als auf das vorangehende Fischen. Mir taten die Karpfen immer leid, die schon zum x-ten Mal herausgefischt worden waren aus dem Teich und schon mehrere Haken im Maul stecken hatten, weil sich viele Sportfischer nicht die Mühe machten, sie herauszuholen. Die spüren eh nichts, sagte Tom immer, wenn er den Karpfen mit dem Kescher heraushob, den Haken aus dem sich langsam öffnenden und schließenden Karpfenmaul herausmergelte und ihn wieder zurück ins Wasser gleiten ließ.
Trottelfische! Wetten, den Depp erwische ich heute noch mal?, sagte er und lachte.
Ich startete den Motor, reversierte und gab Gas. Die Räder drehten auf dem nassen Asphalt durch. Die Sicht war schlecht, weil der Nebel, wie so oft hier, wie ein nasser Socken im Tal lag. Ich orientierte mich an den Reflektoren der Begrenzungspfosten am Fahrbahnrand der Landstraße. Kurz bevor ich zur Autobahnauffahrt kam, fuhr ein Feuerwehrauto mit Blaulicht und eingeschalteter Sirene an mir vorbei. Für ein paar Sekunden färbte sich die Nebelwand blau und ich konnte sehen, wie der Beifahrer im Moment des Vorbeifahrens in sein Jausenbrot hineinbiss. Dann entfernte sich der Lärm des Folgetonhorns schnell. Ich fuhr links auf die Autobahn auf und hoffte, weil ich nur ein paar Meter sehen konnte, dass mir beim Abbiegen nicht der Notarzt oder die Rettung entgegenkam, die womöglich der Feuerwehr nachfolgten, aber es kam niemand. Die Autobahn war leer, kein Mensch unterwegs am Wochenende um diese Uhrzeit, dachte ich, und dass es mir eigentlich auch lieber wäre, ebenfalls nicht unterwegs sein zu müssen um diese Uhrzeit, und wenn ich schon unterwegs sein müsste um diese Uhrzeit, dann lieber, weil ich wegen einer Sauftour noch wach war und nicht, weil ich wegen des Hobbys eines anderen, dem Fischen, schon wieder wach war. Egal, wach war ich nun mal sowieso schon. Wenigstens hatte ich so mehr vom Tag, dachte ich und musste bei dem Gedanken in mich hineinschmunzeln, weil ich mich über diesen Spruch meiner Mutter immer aufgeregt hatte, wenn ich wieder mal bis in den frühen Nachmittag im Bett gelegen war und sie mich mit den Worten: Du hast ja überhaupt nichts mehr vom Tag!, oder, Dir bleibt ja überhaupt nichts mehr vom Tag übrig! aus dem Bett holte. Wieder so ein Beispiel für den mit dem Alter einhergehenden Verlust der gedankenlosen Unbeschwertheit, denke ich, und dass mir das damals im Auto bestimmt noch nicht aufgefallen ist. Er schleicht sich langsam hinein, der Verlust, tröpfchenweise, eine scheinbar nicht nennenswerte Leckage, und bis man draufkommt, ist sie längst verschwunden, die gedankenlose Unbeschwertheit, aber spätestens ist sie verschwunden, wenn man Kinder hat, oder einem nahestehende Menschen sterben, je nachdem, was vorher eintritt. Ich kramte im Handschuhfach, holte eine Kassette mit der Aufschrift raw, loud, noisy and sexy heraus und steckte sie in den Schlitz des Autoradios. Es war eine Zusammenstellung eines Freundes, die er mir zu meinem Geburtstag gemacht hatte. Ich drehte laut auf. Bis zur Abfahrt waren es noch circa zwanzig Kilometer. Ich hörte gerne laute Musik im Radio. Es entspannte mich, ich verlor mein Zeitgefühl und hatte, wenn ich ankam, nicht das Gefühl, eine lange Autofahrt hinter mir, sondern ein Konzert besucht zu haben, oder, noch besser, selbst auf der Bühne gestanden zu sein. So war es dieses Mal auch. In dem Moment, als John Garcia von der Band Kyuss bei dem Opener Gardenia von dem Album Welcome to Sky Valley mit dem Gesang einsetzte, stand in meiner Vorstellung also ich auf der Bühne und setzte mit dem Gesang ein, dass mir bei dem Gedanken die Gänsehaut aufstieg. Gerade als er, beziehungsweise ich, den Satz One blow till I'll take ya down, I'll take ya down sang, oder besser gesagt schrie, sah ich im Augenwinkel das Ausfahrtschild mit dem Ort, wo ich abfahren musste und den Zusatz zweihundertfünfzig Meter vorbeihuschen. St. Barbara zweihundert Meter, registrierte ich, während ich I'll take ya down schrie. Ich wusste, dass die nächste Abfahrt erst in fünf Kilometern kam, und weil ich sowieso schon spät dran war und ich nicht hinterwärts zum Karpfen-Petrus zuckeln wollte, noch dazu bei dem Nebel, lenkte ich auf die Abbiegespur rüber und stieg auf die Bremse. Nicht zu fest, weil ABS gab es damals noch nicht, doch, gegeben hat es die Technologie damals schon, auch Autos mit integriertem ABS gab es, nur war es meistens sauteuer und wurde nur auf Wunsch verbaut, also hatte ich, besser gesagt, mein Mazda 626 Baujahr 84, kein ABS, darum stieg ich vorsichtig auf die Bremse, weil die Straße durch den Nebel und den Regen schon rein optisch schmierig aussah. Mein Mazda fuhr auch schön und wie auf Schienen in die lang gezogene Rechtskurve hinein, die aber immer enger wurde und am Schluss in eine Haarnadelkurve mündete. Ich spürte, dass ich zu schnell unterwegs war, und hoffte und glaubte auch, dass es sich ausgehen würde. Das geht sich schon aus, das geht sich schon aus, dachte ich und sagte es mir auch laut vor, damit der Wunsch auch wahr werden würde, bis ich unter meinem Hintern spürte, wie das Heck zuerst schwammig wurde und dann ausbrach und ich wusste, dass er nicht wahr geworden war. Ich drehte mich mit meinem Mazda einmal um die Achse, knallte seitlich gegen die Leitschiene und wurde auf die Fahrbahnmitte zurückgeschleudert, wo ich zum Stehen kam. Aus der Stereoanlage kam immer noch Gardenia in voller Lautstärke heraus. Ich fuhr ganz langsam zur Seite und dachte, jetzt ist es zu spät, um langsam zu fahren, und hörte den Satz in meinem Kopf, wie ihn mein Vater zu mir sagen würde. Schon im ersten Schreck hörte ich die Stimme meines Vaters: Jetzt ist es zu spät, um langsam zu fahren, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Ich stellte den Motor ab und es war still im Auto. Ich beugte mich nach vorne, legte meine Stirn ans Lenkrad und ließ meine Arme seitlich hinunterhängen. Ich schloss die Augen und sah sofort die Geldspritze meines Vaters vor mir, die er in Form von ein paar Tausend Schilling auf den wie immer mit einem Plastiktischtuch bespannten Küchentisch meiner Eltern legte. Für dein Auto, hatte er gesagt und die Geldscheine in meine Richtung geschoben. Es wird schon nicht so schlimm sein, dachte ich, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, weil ich zu schnell von der Abfahrt in die Haarnadelkurve hineingefahren war und das, obwohl ich die Haarnadelkurve ja in- und auswendig kannte, weil ich diese Strecke schon Dutzende Male gefahren war. Aber so schnell war ich ja auch wieder nicht unterwegs gewesen, dachte ich andererseits wieder, wie ich in die Leitschiene hineingeknallt bin, und der Winkel, mit dem ich in die Leitschiene geknallt bin, war gar nicht so steil, eher flach, ich bin doch mehr in die Leitschiene hineingerutscht als geknallt, oder?, dachte ich, machte die Tür auf und stieg aus. Es dämmerte schon und ich hörte die Vögel zwitschern, so, als wäre nichts gewesen. Ich hörte ein Auto näherkommen, drehte mich mit dem Rücken zur Straße und tat so, als schiffte ich in den Straßengraben hinein. Das Auto fuhr an mir vorbei. Ich ging von hinten um den Mazda herum und begutachtete den Schaden. Fast die Hälfte der Fahrzeuglänge auf der Fahrerseite hatte was abgekriegt. Ich spürte einen Knoten im Hals und wie mir die Tränen in die Augen schossen. Ich schrie und schmiss den Autoschlüssel auf die Straße, der über den Asphalt schlitterte und in einer Lache liegen blieb. Das Einzige, woran ich denken konnte, war: Wie soll ich das dem Vater sagen? Wie soll ich das nur dem Vater sagen? Das ganze Geld, alles umsonst! Das ganze Geld in einen Totalschaden hineingespritzt!, wird er sagen. Ich ging zum Kotflügel, der am meisten beschädigt und so weit hineingedrückt war, dass er am Rad streifte. Ich zog und riss daran herum, bis das Rad wieder frei war, holte den Schlüssel aus der Lache, setzte mich ins Auto, startete den Motor und fuhr langsam los. Hinterwärts fuhr ich zurück nach Hause und ließ mir dabei so viel Zeit wie möglich. An Tom und den Karpfen-Petrus dachte ich nicht mehr und das Autoradio schaltete ich auch nicht mehr ein.
Als ich zu Hause ankam, bog ich aber nicht in die Gasse ein, sondern fuhr weiter. Um noch etwas Mut zu sammeln, dachte ich. Die Zeit verging, der Mut wurde aber nicht größer, darum drehte ich schließlich doch wieder um. Es blieb mir nichts anderes übrig.
Als ich auf den Parkplatz vor dem Mehrfamilienhaus, in dem meine Eltern wohnten, einbog, hatte sich der Nebel schon verzogen und die Sonne schien prächtig auf meinen demolierten Mazda. Im sogenannten strahlenden Sonnenschein schaute der Schaden noch schlimmer aus. Ich läutete unten beim Stiegenhauseingang. Kurz darauf steckte mein Vater schon seinen Kopf aus dem Küchenfenster im zweiten Stock wie ein Kuckucksuhrkuckuck. Zuerst lächelte er noch, bis er den Schaden bemerkte, dann fing er gleich zu schreien und zu gestikulieren an. Meine Mutter konnte ich nicht sehen, ich wusste aber, dass sie hinter ihm stand und Sätze sagte wie: Hör auf, lass ihn doch, und: Nicht so laut! Ich nahm den Autoschlüssel aus der Hose und wollte ihn schon, wie vorher, auf den Asphalt schmeißen, legte ihn dann aber doch aufs Autodach, drehte mich um und ging weg. Ich konnte meinen Vater noch eine Weile schreien hören, bis ich in die nächste Gasse einbog, dann war es ruhig. Ich hatte wieder den Knödel im Hals gekriegt, den ich immer kriegte, wenn ich die immer gleichen Vorwurfssätze vom Vater zu hören bekam. Die paar Tränen, die ich nicht unterdrücken konnte, und der gleichzeitig aus meiner Nase rinnende Rotz waren gleich von meinem Ärmel aufgetunkt und ich fühlte mich wie der Bub, der ich gewesen war, als ich mir die Knie aufgeschlagen hatte, weil ich mit dem neuen Fahrrad gestürzt war und mein Vater gesagt hatte: Wie oft habe ich dir schon gesagt, undsoweiter, während er mir das mit Arnikaschnaps getränkte Tuch auf die Wunde drückte.