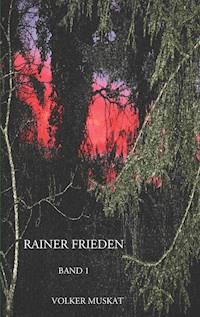Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman behandelt verschiedene Themen - das Lieben mehrerer, ganz verschiedener Menschen - das Zusammenleben mit mehreren Partnern - die Frage nach dem richtigen Geschlecht und Körper. Die gewählten Charaktere in dem Roman sind authentisch und liebenswert. Die Leichtigkeit der Erzählung und der Stil, der heiter und sorglos erscheint, wissen zu überzeugen. Wer auf der Suche nach etwas Neuem ist, findet es in dieser nicht ganz klassischen Liebesgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich danke Charlotte, die mir die Zeit für diese Geschichte geschenkt hat, Arne und Christoph die dafür gesorgt haben, dass der Schreibteufel wenig Einfluss auf mein Geschriebenes hat.
Diese Geschichte widmet sich der Liebe mit ihren unterschiedlichen Facetten. Das Zusammenleben und Lieben mehrerer ganz verschiedener Menschen wird spannend und fantasievoll beschrieben. Eine nicht ganz klassische Liebesgeschichte.
Die Geschichte und alle Namen sind frei erfunden und jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Gegebenheiten, Orten oder Geschehen ist rein zufällig!
Inhaltsverzeichnis
Kai Yvonne Blauton
Die Maskerade
Die Taufe
Der Tag danach
Ein neues Zuhause
Ein Geschenk
Das Erwachen
Geheimisse
Das letzte Geheimnis
Ein Verdacht
Der Abschied
Wieder vereint
Zu Hause
Der Hausbesuch
Die Entscheidung
Die Offenbarung
Die Wahrheit
Eine eigene Wohnung
Kai Yvonne Blauton
Mein Name ist Kai Yvonne Blauton. Aufgewachsen in einer Großstadt, war ich ein Schüler unter vielen; ein Nobody. Nur meiner roten Haarfarbe hatte ich es zu verdanken, dass ich von dem einen oder anderen Menschen überhaupt wahrgenommen wurde. Meine Taten und Talente fanden wenig Beachtung.
Das sollte sich aber bald ändern. Meine Eltern zogen mit uns Kindern, ich hatte zwei Schwestern, von der Großstadt in eine Kleinstadt mit dörflichem Charakter. Zunächst fühlte ich mich gar nicht wohl. In dieser neuen Stadt war eine Ruhe im Umfeld, die mir richtig wehtat.
Wenig Autoverkehr, kein Menschengewühl und überhaupt war in dieser Kleinstadt „Tote Hose“. Für aufgeweckte Kinder, wie ich eines war, war hier nichts bis gar nichts los.
Natürlich musste ich auch hier eine Schule besuchen. Aber zu meiner Freude stellte sich heraus, dass ich den Schulbesuch mit einem Wissensvorsprung startete. Schnell war ich dadurch in fast allen Fächern Klassenbester und bei meinen Klassenkameraden sehr beliebt.
Meine Schulzeit war noch zu jener Zeit, als Mädchen und Jungen getrennt sitzen mussten. An einer langen Tischreihe saßen die Mädchen vor der Fensterfront im Klassenzimmer, und wir Jungen saßen ihnen gegenüber.
Der Schulhof für die Pausen war genau aufgeteilt, links die Mädchen, rechts der Bereich für die Jungen, und die Lehrerschaft achtete peinlich darauf, dass kein fremdes Geschlecht auf der falschen Seite war oder sie versehentlich betrat.
Aus diesem Grunde hatte ich zu meinen Mitschülerinnen wenig Kontakt, aber auch keinen Ehrgeiz, das zu ändern. Denn mit zwölf Jahren wusste ich ja noch nicht, was ich gemeinsam mit Mädchen unternehmen konnte.
Einzige Ausnahme war meine ältere Schwester. Mit der konnte ich prima spielen. Sie las mir immer tolle Geschichten vor und beschützte mich vor meinen Eltern, wenn ich mal was Blödes gemacht hatte. Auch deshalb mochte ich sie sehr.
So plätscherte das erste Jahr in dieser Schule dahin. Ich wurde im Verlauf dieses Jahres der ungekrönte Klassenkönig und gab in vielen Dingen des Schullebens den Ton an. Selbst die Lehrer waren von mir überzeugt und bedachten mich hin und wieder mit Sonderaufgaben, die es mir gestatteten, einen Teil meines Schulalltags selbst zu gestalten.
So war ich rundum zufrieden. Alles war, wie es sein sollte. Ich war gesund und fit, hatte keine Sorgen und konnte der Zukunft gelassen entgegensehen.
Das zweite Jahr an dieser Schule begann so, wie das erste aufhörte. Und dann kam die Karnevalszeit!
Am Montag vor dem Weiberfastnachtstag, der immer an einem Donnerstag stattfindet, bekamen wir einen Zettel für unsere Eltern mit. Auf diesem Blatt war zu lesen, dass wir Schulkinder an Weiberfastnacht kostümiert zur Schule kommen sollten.
Für mich war sofort klar - ich wollte als Cowboy verkleidet zur Schule gehen. Ich hatte nur ein Problem. Mein Vater hasste seit dem Krieg alles, was nach Waffe aussah.
Und ein Cowboy ohne Revolver, hört mal, das geht gar nicht! Was tun??
An dieser Stelle kommt meine Mutter in diese Geschichte. Ich überreichte ihr den Zettel und trug ihr meine Idee eines Kostüms vor.
Bevor ich weiterschreibe, muss ich erwähnen, dass wir nicht mit Reichtümern gesegnet waren.
So war an ein gekauftes Karnevalskostüm erst gar nicht zu denken. Meine Mutter hatte so ihre eigene Vorstellung von dem Kostüm für mich. Nach einem kleinen Moment des Nachdenkens sagte sie es mir.
Als sie mir dann erzählte, als was sie mich verkleiden wollte, habe ich mich mit Worten und allem, was mir sonst möglich war, dagegen gewehrt.
Als Mädchen wollte sie mich verkleiden. Mit Kleidungsstücken von meiner älteren Schwester.
Also bitte, meiner Meinung nach ging das gar nicht. Ich, der größte Cowboy aller Zeiten, als Mädchen, nee wirklich, das ging gar nicht, das wollte ich nicht!
Dann lieber als Ritter oder von mir aus auch als Mönch oder im Schlafanzug. Aber als Mädchen? Nee wirklich, das ging gar nicht, das wollte ich nicht!
Nun kam auch noch mein Vater dazu und spielte seine ganze Macht aus. Deshalb kann, ja muss ich schreiben, ich hatte keine andere Wahl. Der Klügere gab eben nach. Und so kam es, wie es kommen musste.
Die Maskerade
Am Donnerstagmorgen wurden wir Kinder, wie meistens, von unserem Vater geweckt.
Er stürmte dann immer in unser Zimmer, klatschte in seine Hände und rief mit lauter Stimme: „Auf, auf, sprach der Fuchs zum Hase und biss ihn inne Nase.“
Oh, wie ich diesen Spruch hasste, und zu allem Übel brannte er sich auch noch ins Gedächtnis.
Meine Schwestern wurden davon, im Gegensatz zu mir, sofort hellwach und sprangen mit Elan aus ihren Betten.
Ich hingegen drehte mich im Bett noch einmal in eine andere Liegeposition und versuchte, ein wenig weiter zu pennen.
Aber leider, wie immer, erschien mein Vater erneut mit diesem miesen Spruch und zwang mich ebenfalls aufzustehen.
Dieses „inne Nase“ konnte aber auch wirklich den Kreislauf in Schwung bringen. Warum sagte er nicht, „in die Nase“ oder „in seine Nase“? Nein, jeden Morgen dieses blöde „inne Nase.“
Genervt davon stieg ich behäbig aus meinem warmen Bett, steckte meine Füße in die Hauspuschen und schlappte zur Morgentoilette ins Bad.
In dem Raum erblickte ich sofort die Klamotten, die meine Mutter für den Karnevalstag zusammengesucht und sorgfältig auf einen Stuhl abgelegt hatte.
Siedend heiß kam mir die Erleuchtung:
Heute ist der Tag, an dem ich mich als Mädchen rausputzen sollte.
Beim Betrachten dieser Kleidungsstücke wurde mir richtig flau im Magen. Alles lehnte sich innerlich gegen diese Maskerade auf. Wie komme ich aus dieser Nummer raus? Wie war ich nur in diese Situation geraten?
Hiermit beschloss ich, ab sofort den Karneval zu verachten! Ich meinte, was ist Karneval schon? Auf Kommando lustig sein? Blödsinn!
„Am Gescheitesten wäre es wohl, wenn ich wieder in mein warmes Bett zurückgehe und den Tag verschlafe.“, kam mir ein logischer Gedanke. Leider konnte ich diese Überlegung nicht in die Tat umsetzen, denn meine Mutter hatte kurz nach mir den Raum betreten. Mit einem Hinweis auf die Uhrzeit drängte sie nun darauf, dass ich endlich begann, mich anzukleiden.
Aber zuerst ging ich mal unter die Dusche. Hinter dem Duschvorhang konnte ich hören, wie die Finger meiner Mutter nervös auf das Waschbecken trommelten.
Nach dem Abtrocknen zog ich einen frischen Slip an, während meine Mutter den Strumpfgürtel vom Stuhl nahm. Das erste, was ich anziehen sollte, war ein schwarzer breiter Strumpfgürtel mit einem weinroten Spitzenbesatz. Sie half mir beim Anlegen des Gürtels. Denn dieser hatte viele Häkchen und Ösen und alles musste in einander gesteckt werden, was mir alleine nicht gelingen würde, wie sie meinte.
Als der Strumpfhalter dann endlich saß, war ich überrascht, wie gut sich der Gürtel meiner Körperform anpasste, den spürte ich kaum. Daran wurden die dünnen naturfarbenen Nylonstrümpfe befestigt, die ich nun über meine Beine streifen sollte.
Meine Mutter rollte mit geübten Händen den ersten Strumpf zusammen, damit ich mit meinem rechten Fuß einsteigen konnte.
Mit ihren Fingern schob und zupfte sie ein wenig an dem Fußteil des Strumpfes herum, bis der perfekt an meinem Fuß saß. Langsam und vorsichtig zog sie dann den Strumpf über mein Bein auseinander, bis die volle Länge des Nylons erreicht war.
Damit hüllte der Strumpf die ganze Länge meines Beines ein. Meine Mutter zeigte mir, wie der Strumpf an die Halter, für jeden Strumpf gab es zwei, befestigt wurde.
Danach ging sie mit den folgenden Worten aus dem Badezimmer: „Du weißt jetzt, wie du diese Strümpfe anziehen musst, und kannst das nun selber machen. Ich muss mal zu Vati gehen.“
Das alles kam mir mehr als nur peinlich vor. Schließlich war ich kein kleiner Junge mehr, der sich von seiner Mutter anziehen lassen musste. So fühlte ich mich erleichtert, endlich alleine im Raum zu sein.
Mit aller Vorsicht nahm ich den zweiten Strumpf mit meiner rechten Hand auf und war ein wenig überrascht, wie angenehm sich das Material dieses Strumpfes zwischen meinen Fingern anfühlte und wie wenig er wog.
Ich zog ihn auf die gleiche Weise über mein linkes Bein an, wie es mir meine Mutter vorgemacht hatte, und befestigte auch diesen mit Hilfe der Strumpfhalter.
Es war ein merkwürdiges, aber nicht unangenehmes Gefühl, die Nylonstrümpfe anzuhaben und sie an den Beinen zu spüren.
Ich griff nach der Hose, die ich anziehen sollte, und bei der dafür notwendigen Bewegung berührten sich meine bestrumpften Beine und rieben aneinander.
Ein Prickeln kletterte langsam meine Beine hinauf und verursachte ein Wonneschauer. „He“, dachte ich „das fühlt sich aber gar nicht schlecht an.“
Mit voller Absicht rieb ich erneut meine Beine aneinander und erlebte wieder dieses Gefühl. „Das macht aber Spaß“, überlegte ich und fuhr zur Probe mit meiner Hand über ein Bein. Auch das fühlte sich gut an. „Diese Strümpfe sind toll.“, entfuhr es mir. Das hatte ich nicht erwartet.
Meine Haut war von klein auf sehr sensibel, und ich war schon immer für jede Art des Streichelns empfänglich. So ließ ich mir immer gerne von meiner älteren Schwester den Rücken kraulen, während sie mir etwas vorlas. Das war schön und entspannend.
Jetzt nahm ich endgültig die Hose auf. Es war eine grasgrüne, weite, dehnbare und elastische lange Hose mit einem breiten Gummiband unter den Hosenbeinen. Dieses Gummiband wurde unter den Fuß geschoben und getragen und verhinderte so, dass die Hosenbeine hochrutschen konnten.
Nun folgten ein weißes Unterhemd mit Spitzenbesatz am Ausschnitt und darüber eine weiße langärmlige transparente Bluse. Beides stopfte ich mit meinen Händen in die Hose.
Dazu zog ich braune Schuhe mit ein wenig Absatz an. Die Schuhe gehörten meiner Mutter und sie hatte meine Schuhgröße oder ich die ihre.
Trotz des vorangegangenen Gefühls, das die Nylons verursacht hatten, steigerte sich mein Unwohlsein und wollte einfach nicht weichen.
Diese Verkleidung mochte ich nicht, aber es gab kein Entrinnen. Ich musste da durch, ob ich wollte oder nicht! Hilfloser als ich konnte keiner sein. Wenn ich an die kommenden Stunden dachte, wurde mir richtig schlecht.
Was jetzt kam, brachte mich erst recht zum Schwitzen. Aber mein Widerstand war zwecklos. Meine Mutter kehrte zurück und wollte mich jetzt schminken.
„Nicht auch das noch“, wehrte ich mich. Doch meine Mutter blieb hart und sagte: „Das Schminken gehört dazu. Wir wollen doch, dass alles echt aussieht, nicht wahr?“
„Mutti, bitte nicht!“, rief ich in höchster Not. „Sei doch kein Spielverderber, Junge. Es ist doch Karneval und du willst doch gut aussehen, oder nicht?“, fragte sie, „was meinst du, wie dich alle Kinder beneiden werden? So ein perfektes und schönes Kostüm hat keiner, glaube mir.
Nun kamen auch noch meine Schwestern dazu und beteiligten sich mit Freude am folgenden Geschehen.
Im weiteren Verlauf gaben sie meiner Mutter detailliert Auskunft darüber, ob meine Schminke gut aussah oder nicht. Ich bekam zu meinem eigenen Bedauern die volle Packung.
Es ging mit dem Make-up los. Meine Mutter presste davon ein wenig aus einer Tube auf ihre Finger und verteilte es gekonnt in meinem Gesicht und an meinem Hals. Es war einfach nur unangenehm.
Es folgten Augenwimperntusche, das Färben der Augenbrauen, das Auftragen von Rouge auf meine Wangen und Farbe auf den Augenlidern. Meine Mutter malte mit einem Stift die Lippenkonturen langsam und sehr fachmännisch exakt nach.
Dann drehte sie sich zu einer Ablage im Badezimmer um. Sie nahm verschiedene Lippenstifte aus einer Reihe von Stiften in ihre Hand und schaute sich jeweils deren Farbe an.
Sie entschied sich letztendlich für eine Farbe und wandte sich mit diesem erwählten Lippenstift erneut meinem Gesicht zu. Damit wurden zuerst meine Unterlippe und dann meine Oberlippe mit einem dunklen Rot geschmückt.
Den Abschluss dieser Tortur bildete ein Glanzpuder mit einem Hauch von Rosa, das mit einem kräftigen Pinsel über das ganze Gesicht getupft und verteilt wurde.
Häufig hatte ich zusehen dürfen, wenn meine ältere Schwester sich schminkte. Sie war immer mit Ernst bei der Sache und ließ sich dabei von nichts und niemandem stören. Sie schien damit nie aufhören zu wollen. Sprich - es dauerte immer eine Weile, bis sie damit fertig war.
Selbst meine viel jüngere Schwester fing schon an, sich alles Mögliche in ihr Gesicht zu schmieren. Manchmal fanden meine Eltern das sehr lustig und manchmal gab es ein „Donnerwetter“.
Für mich, das konnte ich jetzt feststellen, war das nichts. Verschwendete Zeit, empfand ich. In meinem Spiegelbild konnte ich mich gar nicht mehr erkennen. Etwas Fremdes schaute mir aus dem Spiegel entgegen.
Je länger ich jedoch hinschaute, desto interessanter fand ich mein verändertes Gesicht. Unter anderem wirkten meine Lippen viel voller und meine blauen Augen wurden deudich betont. Es war irgendwie faszinierend, wie das Aussehen mit ein bisschen Farbe verändern werden konnte.
In dem Moment musste ich mir eingestehen, dass mein Gesicht im Spiegel wie ein schönes gemaltes Bild aussah. Ja, meine Mutter verstand etwas davon.
Ich riss mich von diesen Überlegungen los, denn jetzt kam meine große Schwester an die Reihe.
Sie wollte mir unbedingt die Fingernägel lackieren. Das hatte meine Mutter eigentlich nicht vorgesehen, aber meine Schwester meinte, erst mit lackierten Fingernägeln wäre meine Verwandlung komplett.
Meine Meinung spielte überhaupt keine Rolle. Ich wollte keine lackierten Nägel, aber meine Mutter meinte dazu: „Mach doch Deiner Schwester die Freude.“ Ich nahm mich zusammen und tat ihr letztendlich den Gefallen. Was blieb mir anderes übrig?
Mit Konzentration und Hingabe wurden nun meine Fingernägel manikürt. Anschließend lackierte mir meine Schwester die Nägel mit roter Farbe. Dieses Rot passte genau zu dem Rot auf meinen Lippen.
Als ich anschließend meine Fingernägel betrachtete, gefiel mir das nicht mal schlecht. War mal was anderes. Dumm nur, dass ich mit meinen Händen eine Weile nichts anfassen durfte, bis der Nagellack getrocknet war.
Mein Haarschnitt wurde zu dieser Zeit natürlich von meinem Vater bestimmt.
Die Haare endeten zwei Fingerbreit über den Ohren und eine Handbreit über dem Kragen im Nacken. Das sah nicht nach Mädchen aus. Deshalb sollte ein Kopftuch am Ende alles perfekt aussehen lassen.
Endlich mit allem fertig, ging ich zu einem Spiegel. Was ich da erblickte, erschreckte mich sehr. Ich sah wirklich wie ein Mädchen aus - bah!
So sollte ich mich zur Schule trauen? Niemals! Niemals würde ich so die elterliche Wohnung verlassen! Niemals! Ich schämte mich sehr.
Meine Gedanken überschlugen sich. Sie suchten einen Ausweg aus dieser Misere und fanden keinen.
Durch die Aufregung, die durch das Stylen und das Drumherum entstand, musste ich nochmal auf die Toilette und stellte dort fest, wie unpraktisch das Tragen des Strumpfhalters über dem Slip ist. Denn um den Slip ausziehen zu können, mussten erst die Strümpfe vom Halter gelöst werden.
Ich beschloss daher, es zu ändern. Es war, nach meiner Überzeugung, besser den Slip über den Strumpfgürtel zu tragen.
Mit etwas Geduld gelang es mir schließlich, die Strümpfe wieder zu befestigen. Natürlich prüfte ich noch mal nach, ob das Reiben der bestrumpften Beine aneinander immer noch ein angenehmes Gefühl verursachte. Ja, das tat es! Ich verbuchte es als eine interessante Erfahrung!
Nach Verlassen der Toilette quälte ich mich zum Frühstückstisch. Als mein Vater mich erblickte, fing er an zu lachen.
Er schaute meine Mutter an: „Das hast Du aber perfekt hinbekommen. Unser Bengel kommt garantiert überall als Mädchen durch.“
Bei diesen Worten zuckte ich zusammen, während meine Schwestern gleichzeitig riefen: „Pappa, wir haben aber auch mitgeholfen.“ „Das habt Ihr prima gemacht“, erwiderte mein Vater, „Ihr seid eben meine liebsten Mädchen.“
Mit einem Grinsen im Gesicht sagte mein Vater zu mir: „Junge, schau doch nicht so ernst! Ist doch alles ganz lustig! Entspann Dich!“ Ich bemerkte, dass mich meine Mutter traurig anschaute.
Wenn ich an die zwangsläufig kommenden Ereignisse dachte, wollte mir das Frühstücksbrot gar nicht mehr schmecken. Ich wollte das alles nicht und hatte leider keine andere Wahl.
Unsicher blickte ich in die Runde. Meine ältere Schwester beugte den rechten Arm, strecke ihren Daumen zum Himmel und sagte: „Bruderherz, ehrlich, ist perfekt.“ Mein Vater lachte erneut beherzt, und ich wollte vor Scham in den Boden versinken.
Jeden Morgen holte mich ein Schulkamerad an der Haustür ab, so auch an diesem Morgen.
In dem Augenblick, als das Geräusch der Wohnungsklingel ertönte, zuckte ich zusammen. Ohne mein Vater, ging der Rest meiner Familie mit mir zur Wohnungstür, als wollten sie sich vergewissern, dass ich auch wirklich die Wohnung verließ. Die Schritte dahin fielen mir sehr schwer.
Meine große Schwester griff nach ihrem schwarzen Lieblingsmantel und reichte ihn mir. Mit einer schelmischen Miene sagte sie dabei: „Du siehst süß aus, und ich wünsche Dir viel Spaß, Bruderherz.“ Sie gab mir zur Verabschiedung ein Küsschen auf meine linke Wange.
Obwohl ich die Wohnung in diesem Outfit nicht verlassen wollte, schob mich meine Mutter sanft aus der Wohnung und sagte dabei: „Du bist ein hübsches Mädchen geworden.“
Wieder schaute sie mich mit traurigen Augen an! Dann schien ein Ruck durch ihren Körper zu gehen, und sie meinte weiter: „Meine liebe Tochter, äh, Sohn, stell Dich nicht so an! Reiß Dich gefälligst zusammen!“
Plötzlich fühlten sich meine Wangen ganz warm an und meine Hände begannen feucht zu werden. Ja, meine ganze Körpertemperatur schnellte nach oben. Mir wurde in diesem Augenblick sehr deutlich bewusst: Jetzt wird es ernst. Tapfer zog ich den Mantel über.
Dann ging ich mit zittrigen Beinen die wenigen Treppenstufen bis zur Tür herunter, öffnete langsam die Haustür, machte vorsichtig ein Schritt aus dem Haus und begrüßte meinen Abholer mit einem kleinen, leisen und schüchternen: „Guten Morgen, Paul!“
Damit war ich diesem Tag hilflos ausgeliefert. Dass wird wohl der schlimmste Tag meines bisherigen Daseins, das fühlte ich ganz deutlich.
Einige wenige Schritte ging ich an Paul vorbei, blieb dann stehen und wartete darauf, dass er etwas zu mir sagte. Paul hatte wohl meine Stimme erkannt und suchte mich.
Sein Blick streifte mich einen kurzen Moment, um sich dann auf den Hausausgang zu konzentrieren. Mir schoss die Frage durch den Kopf: „Hat er mich nicht gesehen?“, und im gleichen Augenblick wurde mir bewusst: Der erkennt mich nicht. „Paul, ich bin es“, sagte ich deshalb mit lauter Stimme.
Jetzt zuckte Paul sichtlich zusammen und schaute mich verunsichernd an. „Du?“, fragte er und „wie siehst Du denn aus?“ Dann nach einer Gedenkminute: „Mann, Du sieht ja super aus! Du siehst ja aus wie ein Mädchen, klasse!“
Paul hatte als Verkleidung einen Oberlippenbart mit schwarzer Farbe aufgemalt und trug einen albernen, aus meiner Sicht kitschigen schwarzen, spitz zulaufenden Karnevalshut aus Pappe auf seinem Kopf, der mit einem Gummiband unter dem Kinn gehalten wurde.
Paul hatte für mich eine gefühlte Größe von zwei Metern und besaß den doppelten Körperumfang, gemessen an meinem Körperumfang. Seine Schultern glichen in der Breite fast meinem Kleiderschrank. Ich empfand Paul als sehr kräftig und hatte mit ihm eine Abmachung getroffen.
Er übernahm die Rolle meines Beschützers, und als Ausgleich half ich ihm mit meinem Wissen.
Paul war in der deutschen Sprache ein richtiges Talent und verstand von Autos jede Menge.
Wurde ihm eine Automarke genannt, konnte er alles aufzählen, Hubraum, PS, Zylinderzahl und Höchstgeschwindigkeit. Aber mit dem Rest der Schulfächer tat er sich sehr schwer.
Nachdem Paul meine Verkleidung akzeptierte und davon sogar begeistert war, wurde ich ein bisschen sicherer.
So machten wir uns auf den Weg zur Schule.
Unterwegs trafen wir jeden Morgen immer eine Gruppe aus unserer Klasse. Und je näher dieses Treffen kam, umso wackeliger wurde mein Gang.
Beunruhigt legte ich die letzten Meter bis zum Treffpunkt zurück, denn ich wusste nicht, wie die anderen Kinder auf meine Erscheinung reagieren würden.
Zeigten sie mit Fingern auf mich, sobald sie mich sahen? Lachten sie mich vielleicht aus oder wollten nichts mehr mit mir zu tun haben?
Doch ich wurde überrascht mit: „Klasse, Super, Spitze“, und ähnlich euphorischen Zurufen. Alles bezog sich auf meine Verkleidung.
Mit jeder dieser positiven Äußerungen verging mehr von meiner Angst, und es fing langsam an, Spaß zu machen, so herumzulaufen. Gemeinsam gingen wir den Rest des Weges bis zur Schule und liefen schließlich auf dem Schulhof ein.
An diesem Tag gab es auf dem Schulhof keine unsichtbare Trennlinie mehr. Alle Schulkinder durften den ganzen Schulhof benutzen. So kam ich in Berührung mit meinen Mitschülerinnen.
Die Mädchen waren über mein Aussehen hocherfreut, belagerten mich und wollten von mir wissen, wie ich mich fühlte. Sie fanden dieses Karnevalkostüm schön und ästhetisch. „Es sieht wirklich echt aus“, meinten sie.
Und dass mich jeder in diesem Outfit durchaus für ein Mädchen halten konnte, beteuerten alle.
Meine Klassenkameraden hingegen zogen sich ein wenig zurück und wussten wohl nicht genau, wie sie mit mir umgehen sollten.
Mittlerweile fühlte ich mich in dem Zeug, das ich trug, recht wohl. Vor allen Dingen gefiel mir das Tragen der Nylonstrümpfe. Die verursachten ein angenehmes Gefühl an meinen Beinen und umschmeichelten meine Füße. Das war eine schöne Sinnesempfindung. Keine einengenden Socken mehr - herrlich!
Es wurde eine tolle Schulparty. Ich stand bei den Mädels hoch im Kurs und lernte sie näher kennen.
Erstaunlicher Weise hatten wir drei Monikas in der Klasse und die schienen miteinander befreundet zu sein. Denn sie saßen oder standen immer zusammen. Ihre Spitznamen lauteten Mo, Moni und Monika, wie ich erfuhr.
An diesem Tag entdeckte ich, dass Mädels tolle „Kumpels“ sein konnten, und stellte fest, dass ich viel lieber ein Mädchen umarmte oder an die Hand nahm als einen Jungen. Sie fühlten sich besser an und rochen auch viel angenehmer!
Das schönste an dem Tag bedeutete für mich, dass mich jeder, ob Lehrer oder Mitschüler, egal wie ich aussah, akzeptierte und ich nicht in dieser Gemeinschaft isoliert wurde, wie ich befürchtet hatte. Jeder freute sich über mein Aussehen.
Alle scherzten und lachten mit mir. Ich fühlte mich unendlich wohl und von aller Last befreit.
Es störte mich gar nicht, dass meine Klassenkameraden ein wenig Abstand hielten. Mit meinen Mitschülerinnen hatte ich sowieso mehr Spaß.
Ich war überglücklich und ich fühlte: „Ich lebe!“
Die Taufe
Weiberfastnacht ist ein besonderer Tag für die Mädels und überhaupt für Frauen. An diesem Tag durften sie fast alles machen und hatten das Zepter in ihren Händen.
So schlugen die Mädchen aus meiner Klasse vor, die Innenstadt unsicher zu machen und wollten mich unbedingt dabeihaben. Alle redeten auf mich ein: „Du musst mitkommen.“
Mein Kopftuch war mittlerweile verschwunden. Deshalb kam ein Mädchen auf die Idee, mir ihre langhaarige blonde Karnevalsperücke zu geben. Sie half mir sogleich dabei, die Perücke anzuziehen.
Eine meinte, ich müsste unbedingt Ohrringe tragen. Sie hatte in ihrer Handtasche auch ein paar Ohrclips dabei. Gekonnt befestigte sie diese an meinen Ohrläppchen.
Moni trug einen langen, weiten und geblümten Glockenrock. Dazu hatte sie eine weiße Leinenbluse an und trug darüber eine kurzärmelige schwarze Spitzenweste.
Sie zog die Weste aus und hielt sie mir entgegen. „Für dich, ziehe die an. Die steht dir bestimmt gut.“ Sie bemerkte wohl, dass ich ein wenig fror.
Karneval ist bei uns leider nicht im Sommer. Ich nahm die Weste dankbar an und war froh, dass sie mir passte.
Monika, unsere Klassenschönste, kam in einem schwarzen Hexenkostüm auf mich zu und erklärte mit einer Betonung, die keinen Widerspruch duldete: „Deine Farbe an den Lippen ist fast weg, das muss unbedingt erneuert werden!“
Auch sie hatte in ihrer Handtasche den passenden Gegenstand dabei. Sie kramte einen Lippenstift daraus hervor und forderte mich auf: „Mach mal ein Kussmund.“
Das tat ich sofort. Sie fuhr vorsichtig und konzentriert mit dem Lippenstift über meine Lippen. „Meine Lippenstiftfarbe steht dir viel besser“, meinte sie anschließend.
Monika hatte mehrere Halsketten umhängen, nahm eine davon ab und legte sie mir um den Hals. „Für Dich, Kleines“, sprach sie dabei.
Sie streichelte kurz mit dem Handrücken der rechten Hand über meine linke Wange. Dann ging sie ein paar Schritte zurück, fixierte mich und meinte: „Ja, nun siehst Du wieder gut aus!“
„Aber halt, die Haare - das kann so nicht bleiben.“ Sie nahm eine Haarbürste aus ihrer Tasche, kam auf mich zu und fummelte damit an den Strähnen der Perücke herum.
Dann betrachtete sie mich erneut und meinte mit ausgelassener Stimme: „Fast so schön wie ich!“ Sie drehte sich um und rief in die Runde: „Was meint Ihr?“
Mit diesen Worten und ohne auf eine Antwort zu warten, holte sie aus ihrer Handtasche ein kleines Fläschchen.
Daraus ließ sie ein paar Tropfen der darin befindlichen Flüssigkeit auf ihre Fingerkuppen fallen und verteilte es hinter meinen Ohren.
Anschließend schnupperte sie daran und nahm eine Geruchsprobe. Dann meinte sie mit Überzeugung: „Jetzt duftest Du herrlich.“