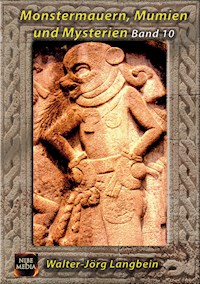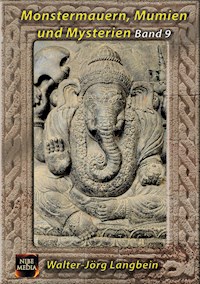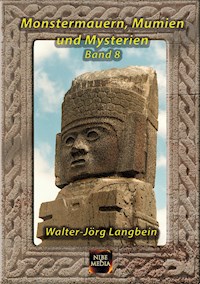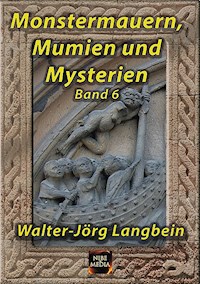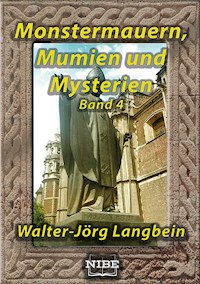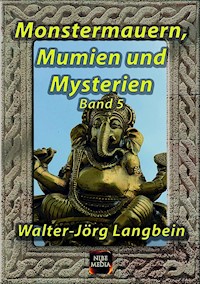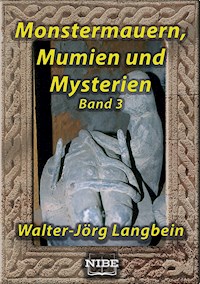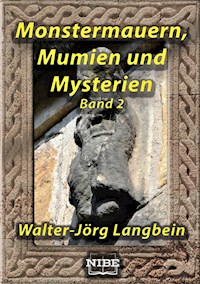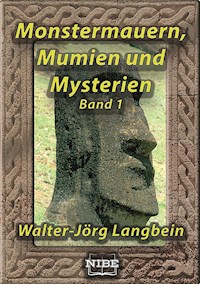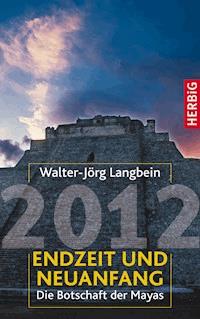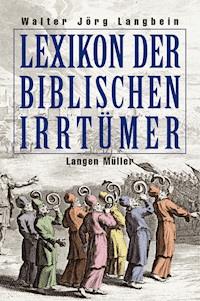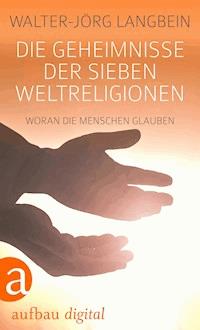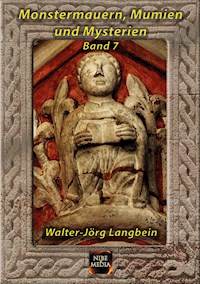
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: NIBE Media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Monstermauern, Mumien und Mysterien
- Sprache: Deutsch
Walter-Jörg Langbein, Jahrgang 1954, bereist seit Jahrzehnten die Welt, um Material für seine erfolgreichen Sachbücher zu sammeln. In "Monstermauern, Mumien und Mysterien 7" bietet er Einblick in das weite Spektrum seiner Forschungsarbeit. In 36 Kapiteln entführt der anerkannte Experte in Sachen Grenzwissenschaften seine Leserinnen und Leser auf eine spannende, abwechslungsreiche Reise durch Raum und Zeit. Auch in Band 7 seiner Buchreihe ist Autor Walter-Jörg Langbein wieder mit seinen Leserinnen und Lesern unterwegs zu faszinierenden Stätten. Wir besuchen zum Beispiel eine geheimnisvolle Keltenburg (Deutschland), den mysteriösen Tempelturm von Tanjore (Indien), die Höhle der Kannibalen (Osterinsel, Chile), das Horrorkabinett von Konarak (Indien), die "unmögliche" runde Pyramide von Cuilcuilco (Mexico), die gespenstischen Ruinen von Tughlaqabad (Indien), die "Schlangenmutter" Wadjet (Ägypten) und das "Drachenmonster Rahab" (Israel, Land der Bibel).Wir entdecken gemeinsam jahrtausendealte Darstellungen von Sauriern in aller Welt, vom Münster zu Hameln (Deutschland) bis zum berühmten Goldmuseum von Lima (Peru), die es gar nicht geben dürfte. Oder haben einst Menschen lebende Saurier gesehen? Gibt es an Orten des Schreckens echte "Spukerscheinungen"?Der Schlüssel zu den großen Geheimnissen unseres Planeten ist die fantastische Vernunft!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter-Jörg Langbein
Monstermauern, Mumien und Mysterien 7
Reisen zu geheimnisvollen Stätten unseres Planeten
Impressum
© NIBE Media © Walter-Jörg Langbein
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags und des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für den Inhalt des Buches ist allein der Autor verantwortlich und er muss nicht der Meinung des Verlags entsprechen.
Created by NIBE Media
Bilder, soweit nicht gekennzeichnet, Archiv Langbein
NIBE Media
Broicher Straße 130
52146 Würselen
Telefon: +49 (0) 2405 4064447
E-Mail: [email protected]
www.nibe-media.de
Walter-Jörg Langbein in Orissa, Indien.
Foto: Ingeborg Diekmann
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort: Rapa Nui ist überall
1. Hermann der Cherusker im Berg gefangen
2. Der Opferschacht von Schanze 2
3. Die Krypta, die Poseidon-Brunnen und der heilige Pfau der Hera
4. Eine Doppelmadonna mit Schlange
5. Maria tritt der Schlange auf den Kopf
6. Maria, die Schlange und die Evangelisten
7. Was kam vor dem »Am Anfang ...«?
8. Wer waren die »prati baziati« und »udumi«?
9. Sphingen am Dom
10. Tresore für die Ewigkeit
11. Eine Mysteriöse Statuette, eine Mondmadonna und zwei Saurier im Kampf
12. Saurier und mehr in der Kirche
13. Spuk in Monstermauern
14. Das Horrorkabinett von Konarak
15. Monsterwesen in Konarak
16. Monstern auf der Spur
17. Der Tempelturm von Tanjore
18. Das Geheimnis der steinernen Kugel
19. Kosmischer Plan und Weltuntergang
20. Das Geheimnis der Kuppelbauten
21. Von Büchern aus Stein
22. Der Vampir von Puri
23. Der Herrscher und der Friseur
24. Die Osterinsel-Connection
25. Von Indien zur Osterinsel
26. Blutspuren
27. Kannibalismus
28. Das Geheimnis der Totenschädel
29. Angst
30. Massenmord auf der Osterinsel
31. Spuk auf der Osterinsel
32. Begegnung auf dem Friedhof
33. Von Tunneln, Höhlen und Jungfrauen
34. Von dicken Jungfrauen und eingesperrten Jünglingen
35. Ein fliegender Gott, Wolkenmenschen und rätselhafte Figuren
36. Abschied von Rapa Nui
Vorwort: Rapa Nui ist überall
»Im Herzen eines jeden Menschen wohnt die Sehnsucht nach dem Wunderbaren!«
Albert Schweitzer (*1875, †1965)
Ein Symbol für das Wunderbare und Geheimnisvolle ist die Osterinsel. Aber glauben Sie mir, liebe Leserinnen und Leser: Rapa Nui, so nennen viele Osterisulaner ihr Eiland, ist überall!
Geheimnisvolles, Rätselhaftes und Mysteriöses gibt es überall auf der Welt: In den »Tresoren für die Ewigkeit«, in der »Hermannsburg«, in Tunneln und Höhlen, im Tempelturm von Tanjore, in so mancher Krypta einheimischer Sakralbauten, an Säulenkapitellen und in alten Sagen und Märchen.
Unser »blauer Planet« ist wie ein gigantisches Museum des Rätselhaften, der fantastischen Geheimnisse und der unbeantworteten Fragen. Auch der 7. Band meiner Buchreihe »Monstermauern, Mumien und Mysterien« ist ein ganz besonderer »Reiseführer« zu scheinbar »unmöglichen« Realitäten, die aber existieren.
»Wir sollten nur danach trachten, die Menschen zum Nachdenken anzuregen, nicht sie zu überzeugen.«, stelle Georges Braque (*1882, †1963), Maler, Grafiker und Bildhauer, Mitbegründer des Kubismus, fest. Das ist auch meine Absicht: Ich möchte niemanden von einer »Weltsicht« überzeugen. Es ist gefährlich, sich auf eine »Weltsicht« festzulegen. Jede »Weltsicht« schränkt das Gesichtsfeld ein. Man sieht nur, was zur »Weltsicht« passt.
Alexander von Humboldt (*1769; †1859) schrieb: »Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, welche die Welt nie angeschaut haben!«
Besuchen wir gemeinsam Geheimnisse und Mysterien unseres Planeten!
1. Hermann der Cherusker im Berg gefangen
Unternehmen wir gemeinsam in Gedanken eine Zeitreise, und zwar in das Jahr 100 vor unserer Zeitrechnung.
Zusammen mit einem bärtigen Kelten erklimmen wir den mehrere Meter hohen Wall der »Keltenschanze«, die man später »Herlingsburg« nennen würde. Es ist ein klarer Frühlingstag, die Sicht ist ausgesprochen gut. Am Horizont sieht man den »Götterberg«, der gut zwei Jahrtausende später den verballhornten Namen »Köterberg« tragen wird. Voller Ehrfurcht, ja durchaus nicht ohne Angst, deutet unser Kelte in Richtung Köterberg, der damals »Götterberg« hieß.
Auch wir blicken zum fernen Berg. »In ferner Zukunft wird man auf diesem Berg ein großes Haus errichten!«, erklären wir dem kriegerischen Kelten. Der nickt zustimmend. »Den Göttern ist nichts unmöglich!« Wir sprechen weiter: »In diesem Haus werden viele, viele Menschen wohnen! Jeder wird ein eigenes Zimmer haben, mit einem Bett, würdig eines Königs. Alle Zimmer sind durch dünne Wände verschlossen, durch die man hindurch blicken kann, die aber den kalten Wind fernhalten!«
Der Kelte wird jetzt etwas nachdenklich. »Auch das mag den Göttern möglich sein!« Wir sprechen weiter, berichten von einer Zaubermaschine, die in bitterster Kälte Wärme schafft, von einem magischen Apparat, der in glühender Sommerhitze für angenehme Kühle sorgt, von einer auf Wunsch sofort sprudelnden Quelle, die sauberstes Wasser liefert, von einem seltsamen Thron, auf dem man nicht ruht, sondern seine Toilette erledigt und der die Hinterlassenschaften mit sprudelndem, glasklaren Wasser verschwinden lässt.
Auch das alles mag »unser« Kelte den Göttern noch zutrauen. Wie aber mag er reagieren, wenn wir von einem Kasten sprechen, der uns lebende Bilder zeigt, aus aller Welt, von Menschen in fernsten Erdteilen, deren Stimmen wir aber deutlich vernehmen. Und was wird er sagen, wenn wir von einem riesigen Turm auf dem »Götterberg« fabulieren, der Bilder aus aller Welt einfängt und im Zauberkasten nebst Tonzauber erscheinen lässt? Ob er das seinen Göttern zutraut? Kehren wir in die Gegenwart zurück. Wir stehen im Sommer 2019 auf dem Rest eines Walls der »Keltenschanze«. Am Horizont sehen wir ganz deutlich das Hotel auf dem Berg, in dessen Zimmern jene märchenhaften Dinge zur Verfügung stehen, die dem Kelten vor 2.100 Jahren wie göttliches Zauberwerk erschienen wären. Daneben ragt der Fernsehturm empor nicht gerade ein Schmuckstück in der Natur.
Der Turm auf dem »Götterberg« (heute »Köterberg«)
Für uns heute sind Fernsehapparat, Klimaanlage, Heizung, Fensterscheibe, Waschbecken und WC alles andere als Wunderwerke, sondern Alltag. Vor 2.100 Jahren mag ein Kelte derlei »Zauberei« selbst den Göttern vom Berg nicht zugetraut haben. Andererseits waren für »unseren« Kelten Sagengestalten und Märchenwelten feste Bestandteile der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit der einen mag anderen als fantastische Fantasie erscheinen! Und umgekehrt! Beim Studium unserer Vergangenheit habe ich gelernt, Fantastisch-Märchenhafte nicht voreilig als Hirngespinste abzutun. Wir verhalten uns womöglich dem überlieferten Wissen unserer Vorfahren nicht anders gegenüber als ein Kelte, dem 100 v. Chr. moderne Jahren heutiger Alltagstechnologie begegnen würde.
Bei meiner Wanderung um die Herlingsburg genoss ich den Blick ins Tal. Auf dem künstlich angelegten Schiedersee zog ein Schaufelraddampfer gemächlich seine Runden zog. In der Ferne ging ein Specht hämmernd seinem anstrengenden Tagwerk nach. Die Atmosphäre? Zauberhaft.
Die märchenhafte Stille – erholsam in unserer hektischen Zeit.
Nicolaus Schaten, ein Theologe und Historiker, vermeldet im 17. Jahrhundert, Karl der Große Höchstselbst habe die Herlingsburg besichtigt. Man habe ihm versichert, Hermann der Cherusker habe einst die Burg genutzt. Einer alten Sage zufolge, die vor Ort bei der Herlingsburg auf eine Schautafel nachgelesen werden kann, zogen sich Hermann alias Arminius und seine Kampfgefährten nach dem glorreichen Sieg über die Römer auf die Herlingsburg zurück.
Wirklich Ruhe fand Hermann dort allerdings nicht! Schuld daran sollen die Zwerge gewesen sein, die damals im Berg hausten. Sie hüteten, wie ihre Artgenossen im Nibelungenlied, einen herrlichen Schatz.
Ich zitiere die Schautafel von der Herlingsburg: »Eines Nachts bei Vollmond öffnete sich der Berg einen schmalen Spalt, gerade so weit, dass ein Mensch hindurch schlüpfen konnte. Im Mondlicht schimmerten Perlen, goldene Äpfel und viele andere Schätze. Hermann starrte gebannt auf die funkelnde Öffnung. Wie von fremder Hand gesteuert schlüpfte er durch den Spalt in den Berg hinein. So einen Schatz hatte er noch nie zu Gesicht bekommen: In den unterirdischen Gärten blühten Lilien aus Silber und Rosen aus Gold. Glitzernde Diamanten und rotglühende Rubine lagen fein säuberlich aufgeschichtet an den Wänden der Höhlen.
Hermann der Cherusker soll in der Hermannsburg gefangen sein Berauscht wandelte Hermann durch die Gänge und vergaß, dass der Eingang sich wieder schließen könnte. Und so geschah es. Im Morgengrauen ließ ein Zauber der Zwerge die Öffnung verschwinden. Für eine unendlich lange Zeit.
Aber wer zur rechten Stunde genau an dieser Stelle steht, dem wird sich der Berg auftun. Er darf hinuntersteigen und sich von den Schätzen so viel nehmen, wie er mag. Und wer weiß: Vielleicht begegnet er dabei dem alten Hermann, der auf seine Rückkehr wartet.«
Wie sich doch die Bilder gleichen. Hermann, der Cherusker, kletterte in den Berg der Herlingsburg und wurde darin eingeschlossen, von gewaltigen Schätzen förmlich hypnotisiert. Im Inneren des Köterberg sollen, so haben es die Gebrüder Grimm überliefert, riesige Schätze lagern. Eine »Jungfrau in königlicher Tracht« soll einst einen braven Schäfer ins Innere des Köterbergs geführt haben. Am Ende eines Ganges zeigte sie ihm eine schwere Eisentür. Mit Hilfe einer magischen Springwurz konnte der Schäfer die massive Tür öffnen. Tief im Bergschoß saßen zwei weitere Jungfrauen an Spinnrädern. Damit war eine »Jungfrauentriade« komplett, die uns an die uralten Göttinnen-Triaden erinnert. Der Schäfer durfte so viel Gold und Geschmeide aus dem Berg schleppen wie er konnte. Er möge aber das Kostbarste nicht vergessen. Das genau aber tat der Schäfer. Er stopfte sich die Taschen voll mit Gold und Silber, ließ aber die Springwurz bei den drei Jungfrauen auf dem Tisch liegen. Somit konnte er, nachdem er mit Kostbarkeiten den Berg verlassen hatte, nicht wieder zurückkehren!
Die Herlingsburg – offensichtlich eine uralte Wehranlage der Kelten – und der Staffelberg im schönen Oberfranken haben erstaunliche Gemeinsamkeiten zu bieten. Ob der Köterberg vor gut zwei Jahrtausenden auch Kelten angezogen hat? Im Berg der Herlingsburg, im Köterberg und im Staffelberg soll es unsagbar große Schätze geben. Ähnliche Überlieferung besagen, dass sich Felsspalten am Staffelberg wie am Berg der Herlingsburg auftaten und die gewaltigen Schätze zugänglich waren.
Legendenumwoben, der Staffelberg; Historische Aufnahme um 1900
Fakt ist, Ausgrabungen haben das bewiesen: der Staffelberg in Oberfranken ist von Höhlen durchzogen, eine davon ist vom Plateau des Bergs bequem erreichbar. Am Rande des Plateaus muss man einige Meter gen Tal klettern und schon steht man vor dem Eingang der wenig anziehend wirkenden Höhle. Sie ist nur sehr kurz und wird anscheinend gern für »Picknicks« missbraucht und mit entsprechendem Abfall verunreinigt. Ich selbst war wiederholt in dieser Höhle.
Meist herrschten recht unangenehmer Geruch (um das Wort Gestank zu vermeiden) und eine schwer zu beschreibende, auf mich bedrückend wirkende Atmosphäre.
In dieser Höhle kamen in meiner Jugend zwei Kinder ums Leben, sie wurden vom Blitz erschlagen. Die Kinder waren vor einem Unwetter in die Höhle geflohen, um Schutz vor dem Gewitter zu finden. Ein Loch in der Decke der Höhle kann von oben eingesehen werden. Um zu verhindern, dass jemand in dieses Loch fällt, hatte man es mit einem Eisengitter umgeben. Der Blitz schlug in dieses Eisengitter und tötete die beiden Kinder, die unmittelbar darunter standen.
Riesenglück hatte im Juli 2014 eine 40-jährige Autofahrerin aus Lichtenfels. Auf der Suche nach ihrem 16-jäjhrigen Sohn fuhr sie im PKW auf das Hochplateau des Staffelbergs. Sie verlor ihrer Aussage nach im Starkregen die Orientierung, übersah die Kante des Abgrunds und stürzte zwölf Meter in die Tiefe. Nach freiem Fall blieb sie, im Auto angeschnallt, an einer Baumkrone zunächst hängen. Nach der »Mainpost« bog sich der Baum »wie eine Wippe bis zum Boden des Steinhangs«. Relativ sanft gelangte der PKW ins Unterholz, rollte noch etwa fünfzig bis sechzig Meter weiter und blieb stehen. Die Fahrerin löste den Sicherheitsgurt, zog die Handbremse an und ging, fast unverletzt, zu Fuß nach Hause, als sei nichts geschehen. (1)
Im Inneren des Staffelbergs soll es eine Höhle geben, die Schätze unglaublicher Kostbarkeit birgt. Alle hundert Jahre öffnet sich die Höhle der Sage nach, und zwar für eine Stunde. Wer zur rechten Zeit am rechten Ort ist, kann dann – so an einem Sonntag geboren – in die Höhle vordringen und edelste Preziosen herausschleppen. Er muss sich aber beeilen, denn nach einer Stunde schließt sich der Zugang wieder und Eingeschlossene müssen einhundert Jahre warten, bis sie wieder das Licht des Tages sehen können.
Mir scheint, es gibt die Urfassung einer Sage, die immer wieder in leicht voneinander abweichenden Varianten überliefert wird: In einem »Heiligen Berg« befindet sich eine Höhle. Ein kostbarer Schatz ist darin versteckt. Der Zugang ist meist verborgen, kann aber mit Hilfe der »Springwurz« geöffnet werden. In Verbindung mit der Schatzhöhle treten drei »Heilige Frauen« oder »drei Jungfrauen« auf. Schatzsuchern gelingt es in der Regel nicht, die Kostbarkeiten zu bergen, weil sie die wahre Bedeutung der Springwurz verkennen.
Die Springwurz gilt seit Ewigkeiten als magische Pflanze.
Sie wurde schon von Eingeweihten im »Alten Indien« beschrieben, aber auch von Plinius im römischen Schrifttum und in hebräischen Werken über magische Wirkung von Pflanzen. König Salomo soll die Magie der Springwurz genutzt haben. Kein Mensch, so heißt es in uralten Texten, weiß, wo die Springwurz wächst. Mit einer List, so behaupten Esoteriker aus uralten Zeiten, kann man in den Besitz der Springwurz gelangen. Man vernagelt eine Spechthöhle, versperrt so dem Specht den Zugang in seine Behausung.
Der Specht schafft dann die Springwurz herbei, um mit Hilfe des Zauberkrauts seine Höhle wieder zu öffnen. Jagt man dann dem Specht im rechten Moment einen ordentlichen Schreck ein, lässt er die Springwurz fallen. So gelangt man angeblich in den Besitz des magischen Zauberkrauts.
Auf meinen Reisen habe ich immer wieder von der Springwurz gehört. Uneinigkeit herrschte dabei, ob es sich dabei um eine reale, existierende Pflanze handelt und wenn ja, um welche. Ist es »Salomons Siegel« aus der Familie der Spargelgewächse? Handelt es sich um eine Pfingstrosenart oder um Johanniskraut? Lassen wir uns nicht durch voneinander abweichende Varianten der Schatzhöhlengeschichte in die Irre führen. Die drei Jungfrauen, drei Mädchen, drei heiligen Frauen weisen auf matriarchalisches Glaubensgut hin. Die Höhlen waren die ältesten Orte der Verehrung der Göttin, die seit Urzeiten als göttliche Triade aufgetreten ist. In der Höhle der Göttin befindet sich nun ein unendlich wertvoller Schatz.
Ich glaube, beim Schatz in der Höhle der Göttin handelt es sich nicht um profanes Geschmeide, sondern um das geheime Wissen der Göttin vom ewigen Leben, von Tod und Wiedergeburt, von Tod und Auferstehung. Es ist das älteste Geheimnis der Menschheit.
Fußnoten:
(1) Siehe hierzu »Die Querkele vom Staffelberg«, »Süddeutsche Zeitung« vom 12.07.2014
(2) Brettenthaler, Josef und Laireiter, Matthias: »Das Salzburger Sagenbuch«, Salzburg 1969
2. Der Opferschacht von Schanze 2
Viele Wege führen von München aus in das idyllische Straßlach-Holzhausen. Man kann ein kleines Stück auf der A95 Richtung Garmisch fahren, dann auf der Landstraße via Schäftlarn nach Holzhausen. Oder man wählt die A8 Richtung Salzburg, dann auf die Landstraße: Hofoldinger Forst – Sauerlach – Endlhausen – Eulenschwang – Holzhausen.
Ober man fährt gleich Oberhaching – Deisenhofen – Oberbiberg – Ebertshausen – Holzhausen.
Welchen Weg man auch wählt, das kleine Dörfchen Holzhausen, 30 Kilometer südlich von München gelegen, ist immer eine Reise wert. Hat doch Holzhausen eine echte Sensation zu bieten: Die Reste von jahrtausendealten Kultanlagen. Jahrtausende alt sind die beiden sogenannten »Keltenschanzen«. Beide mögen einst so ausgesehen haben wie die Herlingsburg am Schieder-See. Vom Ferienhof »Zum Dammerbauer« erreicht man die einstmals heilige Stätte »Schanze 2« am Südostrand des Dörfchens in wenigen Minuten.
Wirklich viel erkennt man allerdings nicht. Im Buch mit den offiziellen Grabungsberichten heißt es allerdings (1):
»Die Schanze ist nur teilweise erhalten, aber einwandfrei erkennbar.« Erkennbar sind allerdings nur Teile der Schanze, andere Teile kann man nur erahnen und andere wiederum fielen der Flurbereinigung zum Opfer. »Schanze 1«, keine 90 Meter östlich von »Schanze 2« hat unter dem Zahn der Zeit deutlich mehr gelitten als »Schanze 2«. Ich muss zugeben: Ich habe sie bei meinem Besuch nicht gefunden.
»Schanze 2« maß in etwa 90 Meter im Quadrat. »Schanze 1« war etwas größer und fünfeckig.
Noch gut zu erkennen ist der Wal der Keltenschanze;
Foto: Heidi Stahl
Vor mehr als einem halben Jahrhundert, im Jahre 1957, erhielt der Wissenschaftler Klaus Schwarz den Hinweis, dass ein »Erdwall« bei Holzhausen »teilweise abgetragen« werde. Der Gelehrte Klaus Schwaz reagierte prompt und erschien mit einem Team von Archäologen vor Ort. Nach ersten Untersuchungen war klar: Der Wall war kein Überbleibsel eines alten Viehpferchs oder römischen Gutshofs. Man stand vor einem alten keltischen Heiligtum, vergleichbar mit einem »gallorömischen Umgangstempel«.
Sorgsamste Ausgrabungen wurden über einen Zeitraum von fünf Jahren durchgeführt. Wichtige Erkenntnisse konnten gewonnen werden. Man konnte jetzt zwischen verschiedenen Bauphasen unterscheiden: Am Anfang gab es ein sakrales Areal, das von einem mächtigen Holzzaun umgeben war. In der Westecke der so geschützten Fläche stand ein hölzerner Tempel, der wie christliche Dome so etwas wie einen überdachten Umgang besaß. Bei Domen und Kathedralen spricht man von Kreuzgängen, in denen fromme Mönche gedankenverloren zum Beispiel über Jenseits und Höllenfeuer nachdachten.
In Bauphase 2 wollte man wohl den Schutz der »Keltenschanze« noch verstärken. Ein Graben wurde ausgehoben, ein Wall wurde aufgeschüttet und dazu kam eine wuchtige Wand aus Pfählen. Der Wall muss einst gewaltig gewesen sein. Noch Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts maß man an den Ecken eine Höhe von bis zu 2,50 Metern!
Wie hoch mag er 2.100 Jahre früher gewesen sein?
Von den Holzpalisaden ist heute, rund 2.100 Jahre später, natürlich nichts mehr übriggeblieben. Auch der einst schützende Erdwall besteht nur noch zum Teil, von hohem Gras überwuchert. Bäume wachsen darauf, landwirtschaftlich genutzt wird, was einst womöglich nur keltischen Priestern und Weisen vorbehalten war. Unter der Grasnarbe allerdings hatte eine geheimnisvolle Unterwelt die Jahrtausende überdauert. Die Archäologen machten drei Schächte aus, sechs, acht und fünfunddreißig Meter tief! Welchem Zweck dienten diese Schächte einst? Der 35 Meter tiefe Schacht war teilweise handwerklich geschickt verschalt worden. Archäologen entdeckten im verschütteten Schacht ein geschnitztes, scheibenförmiges Holzobjekt. Im sechs Meter tiefen Schacht, dem kleinsten, stand einst auf dem Boden ein ins Erdreich getriebener Pfahl. Solche Pfähle versinnbildlichten in »primitiven« Zeiten nicht selten Gottheiten.
Zu Zeiten des Alten Testaments, als Jahwe schon längst offizieller Gott war, wurden noch Pfähle angebetet, stellvertretend für Göttinnen. So war das Bild der Göttin Aschera alias Astarte ein Pfahl. Aschera alias Astarte war eine der wichtigsten Fruchtbarkeitsgöttinnen.
Chemische Analysen von Material aus einem der Schächte ergaben ein für den Laien wenig aussagekräftiges Resultat. Eine klumpige Lehmschicht enthielt »Abbauprodukte organischer Substanzen« (2). Martin Bernstein erklärt in seinem Buch »Kultstätten Römerlager und Urwege«: »In den Schacht war also Blut geflossen und Fleisch geworfen worden.« Und weiter: »Jetzt hatten die Wissenschaftler ihre Beweiskette beisammen: künstlich angelegte Schächte, in denen sich Reste von Opfergaben und Kultbildern befanden; einen umfriedeten Platz, der weitgehend unbebaut war und auf dem keinerlei Gegenstände unbeabsichtigt in den Boden gelangt waren; schließlich ein Gebäude mit Umgang, das sich als Vorstufe zu den gallorömischen Tempeln interpretieren ließ. Die ›Viereckschanze‹ von Holzhausen war ein Heiligtum.«
Von Holzhausen aus habe ich mit zwei lieben Freunden Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung machen dürfen. Unzählige kleine Kirchlein konnten wir besuchen. Nicht wenige von ihnen scheinen an Orten errichtet worden zu sein, wo einst schon in vorchristlicher Zeit sogenannte »Heiden« zu ihren Göttinnen und Göttern beteten, zum Beispiel ganz in der Nähe von Quellen. Die Christianisierung erfolgte weit langsamer als Theologen oft gern wahrhaben wollen.
Heidnischer Glaube verschwand nicht von heute auf morgen, um dem christlichen Platz zu machen. Vielmehr ist anzunehmen, dass heidnische Kulte und christliche Zeremonien nebeneinander praktiziert wurden. Die Missionare waren häufig keine feingeistigweltfremden Frömmler. Sie erkannten, dass ihre Schäfchen nicht von den alten Göttern und Göttinnen lassen wollten. Also boten sie ihnen christliche Heilige an, bei denen es sich allerdings um heidnische Götter und Göttinnen im christlichen Gewand handelte.
In Vergessenheit geraten sind die Kulthandlungen, die wohl einst in »Schanze 2« vollzogen wurden. Blutspuren und Reste von Fleisch weisen auf Opferhandlungen hin.
Wenn für »Mutter Erde« geopfert werden sollte, lag es nahe, die Gaben in einem möglichst tiefen Schacht darzubieten.
Ein Pferdeskelett mit abgetrennten Extremitäten gibt Rätsel auf. Gehörte es zum zeremoniellen Ritual, die Gliedmaßen der Opfertiere abzuschlagen, um eine Flucht der toten Tiere zu verhindern?
Prof. Georg Fohrer (*1915; †2002) war »ordentlicher Professor für Alttestamentliche Wissenschaft«. In Erlangen. Ich habe manche Vorlesung bei Prof. Fohrer besucht, an einigen seiner Seminare teilgenommen. Je näher seine Emeritierung 1979 rückte, desto offener wurde der Gelehrte auch für »Randfragen«. Im Gespräch (3) erklärte er mir einmal, dass in alten Kulturen, womöglich auch in Israel, die Vorstellung bestand, man müsse Opfertieren die Möglichkeit nehmen, im Jenseits zu fliehen. »Ein Pferd sollte womöglich einem Gott als Reittier dienen, oder einem Toten im Jenseits.
In himmlischen Gefilden wie im Jenseits war aber eher ein totes Reittier von Nutzen als ein lebendes. Und es musste zunächst verhindert werden, dass das Tier floh, bevor es vom Gott erstiegen werden konnte.« Wenn man aber einem toten Pferd die Beine abschlug, konnte es im Jenseits zwar nicht fliehen, war aber ja auch als Geisterreittier nicht mehr geeignet. »Sie denken zu logisch!«, rügte mich Prof. Fohrer.
Oder gibt es eine ganz andere Erklärung für das Pferdeskelett? Bei den Kelten wurde »Epona«, auch »Epana« genannt, als Fruchtbarkeitsgöttin verehrt und angebetet.
Gleichzeitig galt sie als mächtige Göttermutter. Die Römer übernahmen »Epona« von den Kelten – als Göttin der Pferde! Weist das Pferdeskelett in »Schanze 2« auf die keltische Fruchtbarkeitsgöttin Epona hin?
Vor 2.100 Jahren, als die beiden Keltenschanzen von Holzhausen schon existierten, gab es das Dörfchen Holzhausen noch nicht. Gab es nur die dicht nebeneinander liegenden Kultstätten? Waren es Orte der Wallfahrt für vorchristliche Heiden? Siedelte man sich später, in christlicher Zeit, an, wo uralte heidnische Bräuche ausgeübt wurden?
Erinnert gar der Name – das ist reine Spekulation – an die hölzernen Palisaden der »Schanzen«? Das Filialkirchlein »St. Martin« in Holzhausen jedenfalls wurde nur einen Steinwurf von den beiden »Keltenschanzen« entfernt errichtet.
St.-Martin-Kirchlein in Holzhausen
Umstritten ist bis heute, was genau »Keltenschanzen« waren. Die »Schanzen«, Wallanlagen mit Gräben und Holzpalisaden, dienten sie nur der Verteidigung gegen Angreifer? Was sollte geschützt werden? Waren es sakrale Tempelanlagen für uralte Kulte? Oder handelte es sich um Schutz für keltische Siedlungen, in denen es allerdings auch Bauten für religiöse Zwecke gab? Meiner Überzeugung nach waren Keltenschanzen beides. Kleine Areale mit massivem Schutz dürften aber ausschließlich Kultanlagen gewesen sein. Zu diesen zähle ich beide Schanzen von Holzhausen.
Im »Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern – Band 18«, herausgegeben vom »Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz«, veröffentlicht im für präzise wissenschaftliche Publikationen bekannten »Verlag Philipp von Zabern«, wird die besondere Bedeutung von »Schanze 2« in Holzhausen hervorgehoben: »Was die Ausgrabungen in Holzhausen zur Lösung des Viereckschanzenproblems beitrugen, ist auf wenige Stichworte verkürzt Folgendes: Von den bislang für die Viereckschanzen erörterten Deutungsmöglichkeiten konnte die ›Wehrtheorie‹, sowie die ebenfalls erwogene Möglichkeit der landwirtschaftlichen Nutzung (Gutshof, Viehpferch) ausgeschieden werden. Für kultische Zweckbestimmung spricht die Deponierung organischer Substanzen in den ergrabenen Schächten sowie die Aufstellung bearbeiteter Holzgegenstände auf ihrem Grunde, welche – nach römerzeitlichen Analogien aus Gallien – einfache Göttersymbole dargestellt haben könnten.« Weiter weist das wissenschaftliche Werk daraufhin, dass es in »Keltenschanzen« offensichtlich sakrale Gebäude gab, eine Vorstufe der jüngeren »gallorömischen« Umgangstempel.
Wie viele »Keltenschanzen« es ursprünglich gegeben haben mag? Wir wissen es nicht. Es müssen allein in Bayern hunderte, wenn nicht gar tausende gewesen sein. Unzählige wurden im Zuge der Christianisierung zerstört, unzählige wurden abgetragen, um Acker- oder Weideland zu gewinnen. Erst durch die Auswertung von Luftbildern, von Flugzeugen aus aufgenommen, können längst verschwundene Anlagen wieder sichtbar gemacht werden. Ihre Grundrisse sind oft noch als Verfärbung im Boden erkennbar. Spuren von jahrtausendealten Tempeln, in denen wohl der Fruchtbarkeitsgöttin gehuldigt wurde.
Fußnoten:
(1) »Die Ausgrabungen in der Viereckschanze 2 von Holzhausen / Grabungsberichte vom Klaus Schwarz / Zusammengestellt und kommentiert von Günther Wieland«, Rahden / Westfalen 2005, S. 11
(2) Bernstein, Martin: »Kultstätten Römerlager und Urwege«, München 1996, S. 64
(3) Zitat nach Notizen rekonstruiert
(4) Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz (Hrsg.): »Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern – Band 18«, 2. Auflage, Mainz 1971
Siehe auch:
Wieland, Günther (Hrsg.): »Keltische Viereckschanzen/ Einem Rätsel auf der Spur«, Stuttgart 1999 (21. Holzhausen, Gem. Straßlach-Dingharting, Landkreis München S. 195-198)
3. Die Krypta, die Poseidon-Brunnen und der heilige Pfau der Hera
»Es war wie eine Monstermauer aus Feuer, die sich über Dom, Kirchen und Häuser senkte!«, erinnerte sich der alte Herr an die schweren Bombenangriffe auf Paderborn vom 17. Januar, 22. März und 27. März 1945. »85 Prozent der Innenstadt waren zerstört! Dom und Kirchen waren stark beschädigt! Unzählige Menschen kamen ums Leben, auch einige Ministranten im Dom!«
Arthur Harris (*1892; †1984), 1942 zum Chef des »Bomber Command« ernannt, wollte offenbar sein Konzept »moral bombing« bis zum Ende des Kriegs verwirklicht sehen.
Vorrangig galten Großstädte als Ziel der englischen Bomberverbände, die die Moral der Zivilbevölkerung brechen sollten. Allerdings war Paderborn auch in den letzten Wochen des Krieges keine Großstadt, sondern eher ein ländliches Städtchen mit gut erhaltenen mittelalterlichen Häuschen, bedeutsamen Kirchen und dem Dom.
Vom kleinbürgerlichen Paderborn blieb so gut wie nichts übrig. Die wenigen bescheidenen Häuschen, die die Massenbombardierung wie durch ein Wunder unbeschadet überstanden hatten, wurden in den Jahren nach dem Krieg abgerissen. Sie mussten hässlichen Neubauten weichen.
Und betrachtet man Fotos von Dom und Kirchen, so ist man entsetzt über die massiven Schäden und staunt, wie gut die altehrwürdigen Gotteshäuser wieder restauriert werden konnten.
So makaber es klingen mag, in jenen Tagen der Bombenangriffe, als der Krieg längst entschieden war, gab es nur einen sicheren Ort in der Kreisstadt Paderborn, im Osten von Nordrheinwestfalen gelegen: die Krypta der »Abdinghofkirche St. Peter und Paul«. Das doppeltürmige Gotteshaus sollte Teil eines Konzepts werden, das aber nie ganz verwirklicht werden konnte. Bischof Meinwerk von Paderborn (*um 975; †1036 n.Chr.) schwebte ein riesiges Kreuz vor. Den Dom ließ er als Mittelpunkt errichten. Vier Kirchen sollten die Endpunkte des Kreuzes markieren. Es konnten aber nur »St. Peter und Paul« im Westen und »St. Peter und Andreas« im Osten vollendet werden. Nach dem frühen Tod des Bischofs wurde das Konzept aufgegeben und nicht weitergeführt. Meinhards riesiges Kreuz, dessen markante Eckpunkte wohl auf uraltem sakral-heidnischen Boden errichtet werden sollten, blieb unvollendet.
Blick in die Krypta, Historische Aufnahme
In der Nacht vom 13. Auf den 14. Februar 1945 wurde Dresden systematisch mit Bomben eingedeckt. Nach offiziellen Angaben gab es 35.000 Tote, andere Schätzungen sprechen von 135.000 Toten. In neutralen, nicht am Krieg beteiligten Ländern wurde Harris, »Chef des Bomber Command«, heftig kritisiert. Churchill distanzierte sich von seinem Vasallen, der doch nur seine Befehle ausgeführt hatte.
Am 15. September 1945 schied Harris im Streit aus der RAF aus und wanderte nach Südafrika aus. Insgesamt fielen den Bombenangriffen mindestens 500.000 Menschen in Deutschland zum Opfer.
Quellen galten schon Jahrtausende vor dem Christentum als heilig. Quellenkulte waren, so konstatiert das »Lexikon Alte Kulturen« (1) »eine der ältesten Erscheinungen der Religionsgeschichte«. Die ältesten Quellheiligtümer waren Wohnsitze von Göttern und Geistern. Wurden Paderborns Quellen – es sollen einst hunderte gewesen sein – dürften zu keltischen Zeiten von Verehrern des Quellgeists Nemausus frequentiert? Ist es ein Zufall, dass die Abdinghofkirche hoch über uralten Quellen errichtet wurde?
Gott Poseidon, so überliefern es uralte Mythen und Sagen, stieß seinen Dreizack in die Erde. Schon sprudelte eine Quelle. Wen wundert es da, dass unweit von der »Abdinghofkirche St. Peter und Paul« ein »Poseidon-Brunnen« munter plätschert?
Der Poseidon-Brunnen
»Welche heidnischen Gottheiten sind denn wohl hier in vorchristlichen Zeiten verehrt worden?«, wollte ich von einem Mönch am »Poseidon-Brunnen« wissen. Ich fürchte, dass ich mit meiner Frage den frommen Mann verärgert habe. Hatte er doch eben noch seine bloßen Füße in das kühle Nass gehalten, so bereitete er nach meiner unschuldig gestellten Frage rasch seinen Rückzug vor. Er zog die Füße rasch aus dem Brunnen. Die hochgeschobene Kutte wurde hastig wieder gesenkt, Strümpfe wurden angezogen und zu guter Letzt wurden Sandalen angelegt. Gleichzeitig hatte der Mönch offenbar jegliche Lebensfreude und Heiterkeit wieder abgelegt. Es kam mir so vor, als habe er sich geschämt, weil er sich von mir beim lustigen Fußbad im Brunnen ertappt fühlte.
»Paderborn ist seit über einem Jahrtausend eine christliche Stadt! Wühlen Sie nicht im Heidentum! Besinnen Sie sich der christlichen Ursprünge von Paderborn! Wissen Sie denn, welch‘ wichtige Rolle der ›Heilige Liborius‹ für Paderborn gespielt hat?«, sprach er nun mahnend und ernst. Ich nicke. »Er hat das Liborius-Fest begründet! Wir feiern es ja noch heute vom 24. Juli bis zum 8. August!«, gab ich zur Antwort.
Eine Million »Pilger« zieht es alljährlich zum Liborius-Fest nach Paderborn. Freilich, so vermute ich, locken eher die Bier- und Imbissbuden, ein gewaltiges Riesenrad und allerlei sonstiger Jahrmarktsrummel in die altehrwürdige Stadt, weniger die angeblichen Gebeine des »Heiligen Liborius«.
140 Schausteller und 150 Marktstände auf dem »Pottmarkt« buhlen seit vielen Jahren um die Gunst der zahlungswilligen Kundschaft. Karussells dudeln kreisend, die »Schlemmermeile Plaza Europa« sorgt dafür, dass heutige Besucher auf stilvolle Weise gesättigt werden. Die Gebeine werden zum Fest vom Dom aus über den Jahrmarktsplatz durch die Straßen getragen, natürlich standesgemäß in einem wertvollen, goldenen Schrein! Ob sich der Heilige allerdings in diesem Ambiente wohlfühlen würde? Ich wage das zu bezweifeln!
»Ich habe mich mit dem ›Heiligen Liborius‹ beschäftigt!«, erklärte ich »meinem Mönch« vom »Poseidon-Brunnen«. Der Mann in der Kutte setzte sich wieder auf den Brunnenrand.
»Eine Delegation von Geistlichen ist damals nach Le Mans gereist und hat vom dortigen Bischof Reliquien erhalten, auch solche vom ›Heiligen Liborius‹. Über Chartres und Paris gelangten sie an den Rhein, dann nach Sachsen und kamen am 28. Mai 836 nach Paderborn! Sie fanden einen Platz im Dom!«
So ist es in theologischen Geschichtsbüchern überliefert.
So wird es wohl auch gewesen sein! Fakt ist: Gegen Ende des achten nachchristlichen Jahrhunderts hatte Karl der Große mit seinen Truppen offiziell über das Heidentum gesiegt. Damals herrschte rege Nachfrage nach Reliquien, denen offenbar auch in heidnischen Kreisen Zauberkräfte nachgesagt wurden. Als besonders wirksam sollen die Gebeine des ›Heiligen Liborius‹ gegolten haben!
»Mein« Mönch nickte zufrieden. »Und wie haben die Geistlichen den Weg gefunden?«, wollte er von mir wissen.
Natürlich war auch mir die fromme Legende vom Pfau bekannt, der angeblich den Geistlichen bis nach Paderborn vorausgegangen sein soll! Da müssen die Kirchenmänner aber recht bedächtigen Schritts die Reise nach Hause zurückgelegt haben. »Beschäftigen Sie sich lieber mit der frommen Überlieferung vom Pfau als mit heidnischem Unglauben!«, gab mir der nun wieder milde gestimmte Mönch auf den Weg. »Heidenbräuche führen in die Irre, lenken vom rechten Pfad ab! Sie enden in die Hölle!« Ich gelobte treuherzig Besserung. Als ich in Sachen Pfau recherchierte, kam ich aber wieder auf »heidnische Pfade«!
Auf der griechischen Insel Samos hielten die Priester der Göttin Hera Pfauen. Pfauen waren der Hera geweiht. Wer aber war Hera? Hera wurde in vorhellenistischen Zeiten als Rhea verehrt und als die »Große Mutter« angebetet. Ihre ältere Vorgängerin war Erua, die Königin, die in Babylon Wächterin über die Geburten war. In Irland stieß ich auch auf Hera, freilich wiederum unter anderem, wenngleich auch ähnlichem Namen: »Lady Eire«. Gelangte »Lady Eire« mit Missionaren aus Irland nach Deutschland, vielleicht auch in die Region von Paderborn? Brachten diese frühen Missionare den Pfau als göttliches Symboltier mit? Wie dem auch sei:
Wenn Sie nach Paderborn kommen, sollten Sie unbedingt den Dom besuchen und das berühmte Drei-Hasen-Fenster« in Augenschein nehmen. Wenige Meter davon entfernt steht ein wunderschöner Springbrunnen, dominiert von einem kunstvoll gestalteten Pfau!
Der mysteriöse Pfau von Paderborn
Doch kehren wir noch einmal zu Hera mit den Pfauen zurück! Barbara G. Walker macht uns in ihrem Lexikon »Das Geheime Wissen der Frauen« auf die alte weibliche Trinität aufmerksam (2): »Hera war ursprünglich eine weibliche Trinität, die aus Hebe, Hera und Hekate – Neumond, Vollmond und Halbmond – bestand. Andererseits verkörperte sie die Jungfrau des Frühlings, die Mutter des Sommers und die zerstörerische Alte.«
Wichtig für den »Hera-Kult« waren heilige Quellen. Hera badete, so Barbara G. Walker, in ihrer heiligen Quelle und konnte einen weiteren Zyklus durchlaufen. Im Frühling war sie Jungfrau, im Sommer gebar sie und im Herbst / Winter agierte sie als zerstörerische Alte. Durch das Bad in der heiligen Quelle wurde sie wieder zur Jungfrau, ein neuer Zyklus konnte beginnen.
Der Pfau als Symboltier wurde von den Römern übernommen. Im 2. Jahrhundert v. Chr. wurde auch der Pfau als heiliger Vogel der Göttin Juno, Göttin der Geburt, Königin der Göttinnen, zugeordnet (3). Und schließlich tauchte der Pfau in der frühchristlichen Kunst als Symbol des Paradieses und der Auferstehung wieder auf.
Im heutigen Volksglauben wird Maria, die Mutter Jesu, immer mehr zur Himmelskönigin. Maria spielt im Neuen Testament eine eher untergeordnete Rolle. Sie hat Jesus zu gebären, weitere Informationen finden sich kaum noch über sie. Im heutigen Katholizismus aber wächst ihre Bedeutung immer mehr. Maria wurde – so besagt es der katholische Glaube heute – in den Himmel aufgenommen. Es war Papst Pius XII., der am 1. November 1950 das Dogma von der leibhaftigen Aufnahme Marias in den Himmel festlegte:
»Wir verkünden, erklären und definieren es als ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die Unbefleckte, allzeit jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde.« Das war der erste Schritt zur Vergöttlichung Marias. Mit ihrer Aufnahme in den Himmel wurde sie zu einer Himmelskönigin. In der »heidnischen«
Welt war die Erhebung einer irdischen Frau zu einer himmlischen Göttin bekannt. Man bezeichnete diesen Wandlungsprozess, um das profane Wort »Beförderung« zu vermeiden, als Apotheose. Bei den Römern gab es ein alters Symbol für diese Apotheose. Es war, wir ahnen es bereits, der Pfau!
Der Pfau galt offenbar schon für die frühe Christenheit als Symbol für Unsterblichkeit. Einen wunderschönen Pfau fotografierte ich im Frühsommer 2019, wie passend, vor dem Eventlokal »Paradiesmühle« in Lügde-Rischenau.
Die Aufnahme Marias in den Himmel war nach »heidnischem« Verständnis ihre Vergöttlichung, was die evangelische wie die katholische Theologie natürlich empört bestreitet. Nach christlicher Interpretation, die sich natürlich vom Heidentum grundlegend unterscheiden muss, hat Maria lediglich ein Stadium erreicht, das jeden frommen Christen dereinst nach dem Tag des »Jüngsten Gerichts« erwartet.