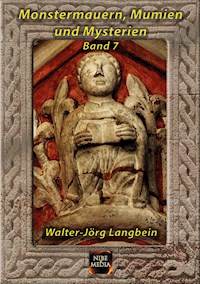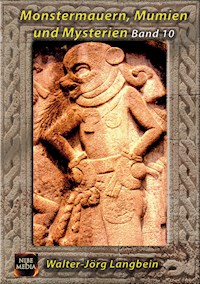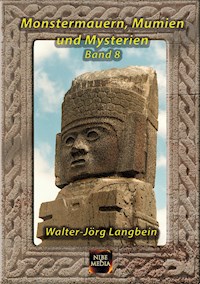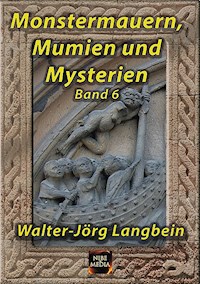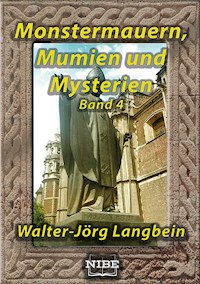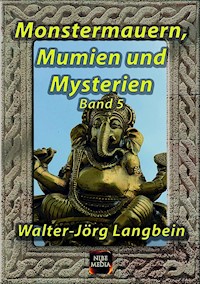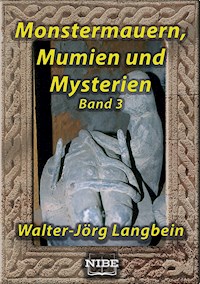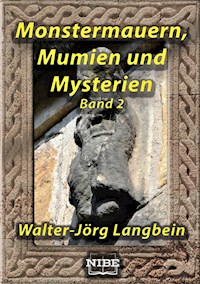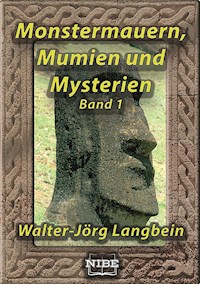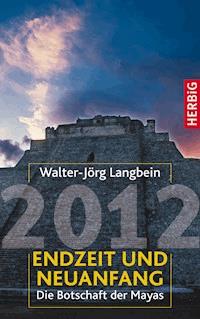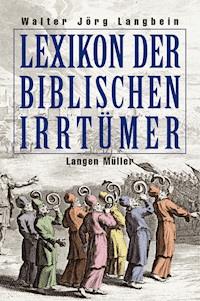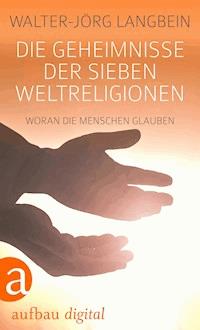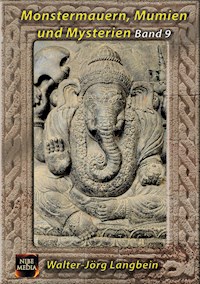
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: NIBE Media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Monstermauern, Mumien und Mysterien
- Sprache: Deutsch
In "Monstermauern, Mumien und Mysterien 9" bietet er Einblick in das weite Spektrum seiner Forschungsarbeit. In 36 Kapiteln entführt der anerkannte Experte in Sachen Grenzwissenschaften seine Leserinnen und Leser auf eine spannende, abwechslungsreiche Reise durch Raum und Zeit, von Deutschland bis nach Indien und Ecuador.Langbein spannt wieder einen weiten Bogen: von der "Göttin auf dem Berg" (Oberfranken) zur "Himmelfahrt Alexanders des Großen" (Freiburg), von versunkenen Tempeln Indiens an die Grenzen der "Anderswelt". Er entführt seine Leserinnen und Leser zu uralten "Tempeln auf dem Meeresgrund" (Indien) und durchforstet das Rig-Veda-Epos nach Hinweisen auf kosmische Besucher. "Tempelhymne 20" beschreibt ein leuchtendes metallenes Unterwasser-Fahrzeug. Was hat es mit dem "Unterwasserhort" auf dem Grund des Meeres auf sich? Wer war die die Königin der Cañari, die vor 1.200 Jahren in der Kultanlage von Inga Pirka (Ecuador) mit zehn "Dienerinnen" (Menschenopfer?) bestattet wurde? Werden wir den Kalender der Cañari je verstehen? Wo wurde ein gigantischer Goldschatz vor den plündernden Spaniern versteckt? Was bedeuten die mysteriösen Steinbearbeitungen im Norden Portugals? Gab es die göttlichen "Schlangen-Menschwesen" (Indien) wirklich? Ihre steinernen Abbilder bei Mahabalipuram geben Rätsel auf. Die Himmlischen umspannten einst den Raum im Flug. Ihre Vehikel wurden in steinernen Tempeln verewigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter-Jörg Langbein
Monstermauern, Mumien und Mysterien 9
Reisen zu geheimnisvollen Stätten unseres Planeten
Impressum
©NIBE Media ©Walter-Jörg Langbein
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags und des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Created by NIBE Media
Für den Inhalt des Buches ist allein der Autor verantwortlich und er muss nicht der Meinung des Verlags entsprechen.
Bilder, soweit nicht gekennzeichnet, Archiv Langbein
NIBE Media
Broicher Straße 130
52146 Würselen
Telefon: +49 (0) 2405 4064447
E-Mail: [email protected]
www.nibe-media.de
Der Autor vor dem Sonnentempel der Inka, Inga Pirka;
Foto: Willi Dünnenberger
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort: Die Sehnsucht nach dem Wunderbaren
1. Die Göttin auf dem Berg
2. Karl May und die Pyramide
3. Die Göttin und die Inkas
4. Himmlische Wagen und verschollene Tempel
5. Die Göttin und die sieben Tempel
6. Tempel auf dem Meeresgrund
7. Legende aus Stein
8. Sprechende Steine
9. Herr des Unterwasserfahrzeugs
10. Der Gott mit dem Löwenkopf
11. Mahabalipuram und die »Entscheider aus Flugapparaten«
12. Mächtiger Behüter und irdische Räume
13. »Den weiten Raum im Flug umspannen«
14. Apocalypse Wow
15. Kröten, Löwen, Dämonen
16. Boten der Göttin
17. Heinrich II., Napoleon, Adolf Hitler und die Lanze des Longinus
18. Kunigundes Kopf
19. Morde im Namen Gottes?
20. Wurde Papst Clemens II. ermordet?
21. Das Grab des Papstes
22. Gruselige Fabeltiere in Gotteshäusern
23. Heilige Quellen
24. Gargoylen und Monster in der Unterwelt
25. Monster in alten Kirchen
26. Übergang zur Anderswelt
27. Vom Ochsenkopf zur unverwüstbaren Maria
28. Feuerberg und Heiliger Quell‘
29. Ein Ganesha und die Herrin vom See
30. Ottilie und die Drachen von Freiburg
31. Faust und Alexander der Große fahren in den Himmel
32. Auf der Suche nach Alexanders Himmelfahrt
33. Familienidyll mit Monstern
34. Von Monstern und Götterwagen
35. Vom Mönch, vom Wolf und von einem Sonnengott
36. Alexander fliegt in den Himmel
Vorwort: Die Sehnsucht nach dem Wunderbaren
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Albert Schweitzer (1), der der vielleicht bedeutendste theoretische Physiker der Wissenschaftsgeschichte, philosophierte über das, was den Menschen auszeichnet. Er glaubte an die Phantasie: »Logik wird dich von A nach B bringen, Phantasie wohin du willst.« Er wusste, dass nicht nur der dröge Realitätssinn eine Berechtigung hat: »Ob siebzig oder siebzehn, im Herzen eines jeden Menschen wohnt die Sehnsucht nach dem Wunderbaren!« Und weiter pries der geniale Physiker »das erhebende Staunen beim Anblick der ewigen Sterne«.
Die Sehnsucht nach dem Wunderbaren motiviert vor allem Fantasten. Und wirkliche Wissenschaftler lassen sich von Fantasten inspirieren. Der junge Hermann Oberth schaute schon als Jugendlicher sehnsüchtig zum Mond und zu den Sternen. Oberth las als Kind den Roman »Von der Erde zum Mond« von Jules Verne (3) und begann zu rechnen und zu forschen. War es möglich, den Mond zu erreichen? Oberth wurde zum »Vater der Weltraumfahrt«.
Jules Vernes früher SF-Roman erschien anno 1865 in der französischen Originalausgabe (4). 104 Jahre später betrat der amerikanische Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Der Fantast Jules Verne hat den Startschuss zur Reise zum Mond in einem fantasiereichen Roman abgefeuert. Im Roman von Jules Verne dauerte der Flug von Planet Erde zu unserem Erdtrabanten 97 Stunden und 20 Minuten. »Apollo 11« war 4 Stunden und 40 Minuten länger unterwegs (5). Hut ab vor dem Fantasten Jules Vernes!
Adolf Holl (6), von vielen gefürchteter Ex-Priester und Kirchenkritiker, mahnte: »Je religiöser ein Mensch, desto mehr glaubt er; je mehr er glaubt, desto weniger denkt er; je weniger er denkt, desto dümmer ist er; je dümmer er ist, desto leichter kann er beherrscht werden. Das gilt für Sektenmitglieder ebenso wie für die Anhänger der großen Weltreligionen mit gewalttätig intolerantem ›Wahrheits‹-Anspruch.
Dagegen hilft, auf Dauer, nur Aufklärung.«
Aufklärung ist immer wichtig. Ziel meiner Buchreihe »Monstermauern, Mumien und Mysterien« ist auch Aufklärung: über die Existenz vom Fantastischen in unserer Welt.
Das Mysteriöse und scheinbar Unmögliche wird zwar gern von der Schulwissenschaft verdrängt und verleugnet, ist aber sehr real!
Mit Band 9 meiner Buchreihe »Monstermauern, Mumien und Mysterien« folgen wir gemeinsam den Spuren des geheimnisvollen Wunderbaren. Anders aber als im weiten, weiten Feld der strengen Schulwissenschaft, der Religion und der Sektiererei sollen keine Doktrinen verkündet werden. Es geht zunächst einmal um eine Bestandsaufnahme von so vielen Geheimnissen und Mysterien unseres Planeten, die wir nicht zuletzt auch vor unserer sprichwörtlichen »Haustüre« finden. Oder sollte ich sagen: Wir können das scheinbar Unmögliche finden, wenn wir nur wollen und keine Angst vor dem Unbekannten haben?
So lade ich Sie, liebe Leserinnen und liebe Leser, zu einer weiteren Reise um die Welt ein. Besuchen wir gemeinsam die »Anderswelt«. Die »Anderswelt« ist Teil der Wirklichkeit. Sie ist allerdings ein fantastischer, manchmal gruseliger, immer faszinierender Teil unserer großen weiten Welt. Es gibt sie wirklich, die »Anderswelt«. Man muss nur den Mut aufbringen, auch das scheinbar »Unmögliche« in Erwägung zu ziehen.
Brechen wir zu einer gemeinsamen Reise auf, die uns weiterbringen wird als Sie vielleicht glauben! Ich wünsche viel Freude am Grübeln!
Recht herzlich
Walter-Jörg Langbein
Fußnoten:
(1) *1875, †1965
(2) *1894; †1989
(3) *1828; †1905
(4) »De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes«
(5) Bereits nach 76 Stunden schwenkte die Kapsel mit den drei Astronauten Neil Armstrong, Edwin „Buzz“ Aldrin und Michael Collins in die Mondumlaufbahn ein. Die Fähre von »Apollo 11« setzte nach 102 Stunden und 30 Minuten auf dem Mond auf.
(6) *1930
1. Die Göttin auf dem Berg
Meine ersten Exkursionen führten mich in jugendlichen Jahren zum Staffelberg bei Bad Staffelstein. Als Kind hoffte ich, das eine oder das anderen »Querkele« beobachten zu können. Als »Querkel« oder »Querkele« bezeichnete man heinzelmännchenartige kleine Wesen. Aus der eher schmuddeligen und häufig von Besuchern verunreinigten »Querkeles-Höhle« hatten sich die kleinen Wesen wohl schon längst zurückgezogen. Meine Urgroßmutter Hedwig Welsch, geborene Engel, sie verstarb am 9.12.1971 im Alter von 90 Jahren, hatte mir so manche Sage von den Staffelberg-Zwergen erzählt. Sie waren immer sehr hilfsbereit, arbeiteten emsig und halfen den Menschennahmen ihnen unaufgefordert besonders schwere Arbeiten ab. In Sagen wird auch überliefert, dass die »Querkele« heilkundig waren und bei der Pflege von Kranken segensreich wirkten.
Die Leibspeise der Querkele waren rohe Kartoffelklöße, die fränkische Spezialität schlechthin. Gelegentlich stibitzten sie den einen oder den anderen Kloß aus Küchen und Speisekammern. Die klugen Hausfrauen gingen stillschweigend darüber hinweg. Eine geizige Frau indes versuchte, derlei harmlosen Mundraub zu unterbinden. Das kränkte die Querkele sehr und sie zogen sich aus den Behausungen der Menschen zurück. Ob sie sich noch am Staffelberg aufhielten? Als Bub durchstöberte ich manches Mal die bewaldeten Hänge des Staffelbergs. Ich kroch durch Gestrüpp, krabbelte manche Böschung hinauf. Ich bekam aber weder irgendwelche Spuren der kleinen Wesen noch einen »Querkele« selbst zu sehen. Besonders intensiv erkundete ich die Westflanke des Staffelbergs, dem sich der Würzburger Weihbischof Söllner anno 1654 nur ehrfurchtsvoll zu nähern wagte. »Dieser Berg ist ein heiliger Berg. Ich bin nicht würdig, ihn mit Schuhen zu besteigen«, soll der Kirchenmann einst gesagt haben.
Besonders interessant fand ich die Erkundung des Staffelbergs von Bad Staffelstein aus. Von der Victor-von-Scheffel-Straße aus ging’s am Friedhof vorbei, steil hinauf auf den Staffelberg. Leider fand ich kein einziges »Querkele«. Darüber wunderte sich meine Uroma Hedwig Welsch, genannt »Kleine Oma«, nicht. »Die Querkele sind doch schon vor langer Zeit ausgewandert. Von einem Fährmann haben sie sich über den Main setzen lassen. Niemand weiß, wohin es sie verschlagen hat!« Suchend kroch ich über die Reste der einstigen Wallanlage, die die Kelten vor rund zwei Jahrtausenden am und auf dem Staffelberg angelegt hatten. Mit Ausdauer hielt ich nach Eingängen zu Höhlen Ausschau.
Ich fand aber keinen einzigen.
Auf einer meiner jugendlichen Erkundungstouren begegnete mir ein freundlicher, bärtiger älterer Herr, der mit einer spitzen Metallstange im Boden stocherte. Der Mann hätte wohl Karl May als Vorbild für eine seiner Fantasiegestalten dienen können. Er trug eine Art Kutte. Darin ähnelte er dem frommen Valentin Mühe, der von 1913 bis 1925 als Eremit Valentin auf dem Staffelberg lebte. 1925 erkrankte er schwer und verließ den Staffelberg. Ausschlaggebend für seinen Entschluss, seine bescheidene Klause aufzugeben, mag auch die üble Verschmutzung des einst heiligen Bergs gewesen sein. Besonders an hohen kirchlichen Feiertagen wie Ostern strömten die Menschen in Scharen auf den Berg und Bruder Valentin verzweifelte, weil er seinen Berg nicht ausreichend schützen konnte. 1925 verliert sich jede Spur des frommen Mannes.
Der Mann mit der Kutte erklärte mir, dass er nach einem »Brunnenschacht der Kelten« suche. Er habe schon das »gesamte Plateau« überprüft, aber keinen Hinweis gefunden. Vielleicht habe man ja die Adelgundis-Kapelle über den Brunnenschacht gebaut? Tatsächlich soll bereits um das Jahr 800 ein kleines Gotteshaus auf den Resten eines »heidnischen Kultbaus« errichtet worden sein. 1419 wird die »Adelgundiskapelle« erstmals urkundlich erwähnt. Ob es sich dabei um die Kapelle aus dem Jahr 800 handelte, bleibt unklar.
Sicher ist, dass es vor rund zwei Jahrtausenden auf dem Staffelberg das keltische Oppidum Menosgada gegeben hat, eine stark befestigte Anlage, geschützt durch ein komplexes System aus Wällen, die den gesamten Staffelberg umschlossen. Dank archäologischer Ausgrabungen konnte die Schutzmauer um das Plateau des Staffelbergs in einem kleinen Teilstück rekonstruiert werden, und das bis in kleinste Details. Vermutlich waren es keltische »Adlige«, die im 5. Und 6. Jahrhundert auf der Hochfläche – 350 Meter lang und 125 Meter breit – siedelten. Die imposante Schutzmauer war immerhin fünf Meter breit und drei Meter hoch.
Paul und Sylvia Botheroyd merken in ihrem beachtenswerten Werk »Deutschland/ Auf den Spuren der Kelten« an (1):
»Im Nordosten ließen sie die Mauer sogar doppelt anlegen.
Die Häuser der Siedlung waren teilweise an die Mauer angebaut.« Bei Ausgrabungen wurden Funde getätigt, die hohe Handwerkskunst bewiesen. Da wirkten Töpfer und Schmiede. Sie fertigten formschöne Keramiken, Bronzenadeln und Bronzeanhängeranhänger, auch sehr hübsche Fibeln, eine als Pferdchen gearbeitet. Das Eingangstor zu dieser Burg dürfte an der Stelle gelegen haben, wo der moderne Weg das Plateau erreicht.«
Damit nicht genug. Weiter unten am Staffelberg wurde eine weitere Stadtmauer errichtet. Sie war 3.000 Meter lang.
Ein fast fünfzehn Meter breiter Erdwall wurde aufgeschüttet, riesige Mengen Holz wurden für eine sechs Meter hohe Bohlenwand benötigt. Bevor anrückende Feinde Wall und Holzbohlenwand angehen konnten, mussten sie erst einen zehn Meter breiten Graben überwinden. Übrigens war der Graben über weite Strecken nicht einfach nur ausgehoben, sondern in den Fels geschlagen worden. Der Arbeitsaufwand für das Oppidum auf dem Staffelberg war immens.
Rekonstruktion einer der Schutzmauern der Keltenstadt Menosgada auf dem Staffelberg;
Foto: wikipedia commons Janericloebe
Darf man davon ausgehen, dass es innerhalb der Keltenstadt auch ein Heiligtum gegeben hat? Konkrete Hinweise oder gar definitive Spuren hat man freilich in der Keltenmetropole auf dem Staffelberg nicht gefunden. Wilfried Menghin weist in seinem empfehlenswerten Werk »Kelten, Römer und Germanen/ Archäologie und Geschichte in Deutschland« darauf hin (2), dass die mysteriösen Viereckschanzen, auch »Keltenschanzen« genannt, wie die Keltenstädte gleichen Einflüssen unterliegen. Er spricht von »religiösar-chitektonischem Einfluss«.
Die Befestigungsanlagen der Kelten auf Bergen wie dem Staffelberg sind um einiges älter als die »Vierecksschanzen«. So sind keltische Verteidigungsanlagen auf dem Staffelberg schon ab etwa 600 v. Chr. nachweisbar. Auch auf dem »flachen Land« schufen die Kelten Oppida. Das Oppidum von Manching (bei München, unweit von Ingolstadt gelegen) wurde einige Jahrhunderte vor den Schanzen gebaut und erreichte enorme Ausmaße für die damalige Zeit. In der zweiten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts lebten bis zu 10.000 Menschen in der Anlage. Die mächtige Stadtbefestigung: eine »Monstermauer« mit einer Länge von über sieben Kilometern. Eine Rekonstruktion der zentralen Siedlungsfläche des Oppidums Manching im Keltenmuseum zu Manching lässt staunen, wie zivilisiert die Kelten schon gewesen sein müssen. Ihre Städte waren präzise geplant und wie auf dem Reißbrett gebaut. »Primitive« waren da nicht am Werk!
Das »Heidetränk Oppidum«, bei Oberursel im Taunus gelegen, gilt als eine der wichtigsten Anlagen dieser Art von ganz Europa. Dieses bedeutsame Oppidum, etwas jünger als die wehrhaften Keltensiedlungen vom Staffelberg oder Manching, ist kaum von Keltenschanzen (etwa Herlingsburg.) zu unterscheiden.
Nach Erkundung mehrerer Oppida und Keltenschanzen komme ich zur Überzeugung, dass die mysteriösen »Schanzen« kleinere Abbildungen der älteren Keltenstädte (Oppida) sind. Umstritten ist, ob es sich bei den Keltenschanzen ausschließlich um landwirtschaftliche Höfe von Kelten oder ausschließlich um Tempelanlagen handelte.
Vermutlich gibt es für geschätzte 20.000 bis 40.000 Keltenschanzen nicht eine einheitliche Erklärung. Bei manchen mag es sich um kleine befestigte Tempel, bei anderen um ebenfalls befestigte Höfe mit Wohngebäuden, Stallungen und Tempeln gehandelt haben. »Eingefriedete heilige Bezirke« weisen nach Ausgrabungen »tiefe Kultschächte«, »Opferfeuerstellen« und »hölzerne Umgangstempel« auf.
Der Mann mit Kutte, der mir an einem Steilhang des Staffelbergs begegnete, stocherte mit einer Metallstange im Boden herum. Warum er das tat? Ich fragte natürlich. Auf diese Weise wolle er, erklärte er mir geduldig, die verfüllte Öffnung eines »Opferschachts« finden. Bislang hatte er das Gesuchte nicht gefunden, aufgeben wollte er aber auf keinen Fall. Ob es je im Oppidum vom Staffelberg einen »Opferschacht« gegeben hat? Intensive Ausgrabungskampagnen wären erforderlich, doch es fehlt das nötige Geld. Gut möglich, dass sich das 2020 ändern wird. 2018 und 2019 gab es intensive Grabungen. Ausgelöst hat die Ausgrabungen am Staffelberg der Schriftsteller Helmut Vorndran.
Helmut Vorndran (*1961) erlernte zunächst den Beruf des Schreiners, studierte dann Sozialpädagogik und begründete 1984 schließlich mit Freunden das »Totale Bamberger Cabaret«. Helmut Vorndran stand auf der Kabarettbühne und arbeitete gleichzeitig für das »Bayerische Fernsehen«. Irgendwann lebte er seine wahre Passion: Er schrieb Krimis, die alle im Frankenland spielen. Seit 2013 arbeitet Helmut Vorndran ausschließlich als Schriftsteller.
Krimi folgte auf Krimi. 2016 erschien ein »Magnum Opus«, der Historienroman »Isarnon: Stadt über dem Fluss«. Die »Stadt über dem Fluss« ist unschwer als Menosgada, das Oppidum auf dem Staffelberg, zu erkennen. Im Vorwort zu »Isarnon« schreibt Vorndran (3): »Dieser Roman ist ein Experiment. Er ist es deshalb, weil wir so wenig über unsere keltische Vergangenheit wissen. … Über die Kelten wissen wir nur sehr wenig. Es gibt keine schriftlichen Zeugnisse, und ihre Bauten sind verschwunden, waren sie doch weitestgehend aus Holz und Lehm. Trotzdem faszinieren sie uns, weil sie das erste wirkliche Volk Mitteleuropas waren, das Volk, von dem wir abstammen.«
Es war Helmut Vorndran, der die neuerlichen Ausgrabungen am Staffelberg initiierte. Und diese Ausgrabungen führten zu einer sensationellen Entdeckung. Ein Team um Chefarchäologe Markus Schußmann fand konkrete Spuren eines gewaltigen Tores zur Keltensiedlung Menosgada. Oben auf dem Plateau wohnten, so Markus Schußmann, die Adligen wie auf einer Akropolis. Um das Plateau herum siedelte das Volk.
Dank sorgfältigster Ausgrabungen wird es möglich sein, das »Zangentor« genauso zu rekonstruieren, wie es vor rund zwei Jahrtausenden ausgesehen hat. Es soll am Staffelberg wieder in Originalgröße erstehen. Chef-Archäologe Schußmann ist begeistert. Das keltische Tor sei besser erhalten als viele andere Anlagen, an den er bisher gearbeitet habe. Die Ausmaße des Tores waren beachtlich: das Torgebäude war 12,50 Meter hoch. Die Straße, die durch das Tor führte, war mindestens sieben Meter breit.
Lange bestand das »Zangentor« freilich nicht: von 120 bis 40 vor Christus. 40 v. Chr. wurde das Oppidum auf dem Staffelberg aufgegeben. Warum? Wir wissen es nicht. Auch Chefarchäologe Markus Schußmann weiß nur, dass kurz vor der Zeitwende alle keltischen Kultstätten verlassen wurden. Das »Zangentor«, vermutlich der zentrale Zugang zum Oppidum, wurde von den Kelten selbst in Brand gesteckt.
Auf diese Weise hofften sie, leichter das im Tor verarbeitete Eisen zurückgewinnen zu können. Anno 40 v. Chr. verließen die Kelten den Staffelberg. Danach verliert sich ihre Spur. Zurück bleiben Rätsel. So wurden zwei Kindergräber im Bereich des »Zangentors« gefunden. Offenbar wurden die Kinder geopfert, um die Götter günstig zu stimmen. Ein Kind wurde vor dem Eingang, das andere hinter dem Eingang beigesetzt. Solche Menschenopfer sollen so selten nicht gewesen sein. Dass man aber gleich zwei Kinder tötete, das ist höchst ungewöhnlich. In der Regel begnügte man sich mit einem Menschenopfer.
Am Tor hat man einen abgehauenen Kopf angebracht.
Hoffte man, dass die Götter das wichtige Tor schützen würden? Oder sollten angreifende Feinde am Tor abgeschreckt werden? Die Kelten, so heißt es, waren Kopfjäger. Besiegten Feinden wurden angeblich nach der Schlacht die Köpfe abgeschlagen und als Trophäen gesammelt. Die Köpfe ihrer Feinde, die sie im Kampf töteten, haben sie als Trophäen zur Schau gestellt. Dieser Brauch sollte der Besänftigung von Göttern wie Belenus, Cernunnos, Lug, Taranis und Teutates dienen.
War dem wirklich so? Die Kelten selbst hinterließen keinerlei schriftliche Aufzeichnungen. Was wir über ihr Tun und Lassen wissen, das basiert auf den Behauptungen von »Historikern« aus jener Zeit. Ob diese Berichte allerdings die Kelten korrekt beschreiben? Derlei Berichte waren sehr häufig parteiisch, als Propaganda gegen die Kelten gedacht. Der griechische Geschichtsschreiber Didor von Sizilien zum Beispiel berichtet im 1. Jahrhundert v. Chr.: »Die Köpfe ihrer vornehmsten Feinde balsamieren sie ein und verwahren sie sorgfältig in einer Kiste, und wenn sie diese dann den Fremden zeigen, so rühmen sie sich, wie einer ihrer Vorfahren oder ihr Vater oder auch sie selbst diesen Kopf um vieles Geld nicht hergegeben hätten.«
Kehren wir auf das Plateau des Staffelbergs zurück. Besuchen wir noch einmal die kleine Kapelle hoch über dem »Gottesgärtchen«. Sollte die Überlieferung der Wahrheit entsprechen, wonach die Adelgundis-Kapelle auf den Resten eines heidnischen Tempels gebaut wurde? Das kleine Gotteshaus ist der Heiligen Adeldgundis geweiht. Die heilige Aldegundis soll tatsächlich gelebt haben (* um 630 in Coulsore, Frankreich; † 684, 695 oder 700). Sie gehört zu den Nothelferinnen und ist für Katholiken himmlische Anlaufstelle bei Krankheit und Todesgefahr. Ihr Gedenktag ist der 30. Januar. Am 1. Februar wird die Heilige Brigitte von Irland gefeiert. Zufall?
»Das Namensfest der hl. Adelgundis liegt in verdächtiger Nähe zum 1. Februar, dem Geburtstag der heiligen Brigitte von Irland, die damit das keltische Fest Imbolc, den Frühlingsanfang, christianisierte. Interessanterweise befindet sich die heilige Brigida unter den 16 Nothelfern, die in der Kapelle mit verehrt werden.«, lesen wir bei Paul und Sylvia Botheroyd (4).
Und jetzt wird es spannend. Weiter: »Die irische Brigid ist ursprünglich eine uralte, vermutlich schon vorkeltisch verehrte Feuer-, Sonnen- und Muttergöttin. Das sonnenüberflutete Bergplateau hoch über dem Maintal wäre an sich ein passender Ort für die Verehrung einer lichten Gottheit.« Wer also hinauf auf das Plateau des Staffelbergs wandert, der tritt eine weite Reise in die Vergangenheit an: zu den Kelten und zur Göttin auf dem Berg, die womöglich schon lange vor den Kelten verehrt wurde. Wer zu Beginn des dritten Jahrtausends nach Christus einer weihnachtlichen Messe beiwohnt, möge sich einer uralten Tradition bewusst sein. Die Adelgundis schlüpfte in die Rolle der »Heiligen Brigitte« von Irland. Und die war die Nachfolgerin der Göttin auf dem Berg. Den Namen dieser Göttin kennen wir nicht mehr. Es war wohl eine mächtige Feuer-, Sonnen- und Muttergöttin, die unter wechselnden Namen über die Jahrtausende hinweg verehrt wurde.
Heiligenhäuschen der Adelgundis vom Staffelberg;
Foto: wikipedia commons Janericloebe
Verblüffend ist die Ähnlichkeit zwischen der heidnischen Brigid und der christlichen Maria. Die heidnische Göttin alias Brigid gilt auch als die »Lichtjungfrau«, als »die vom Strahlenkranz Umgebene«. Brigid löst als Göttin des Frühlings die Mächte der winterlichen Kälte ab. Und Maria hat am 2. Februar auch einen ganz besonderen, christlichen Feiertag: »Mariä Lichtmess«. Nach mosaischem Gesetz darf ein neugeborener Knabe frühestens nach vierzig Tagen in den Tempel gebracht und vorgezeigt werden. Warum erst nach 40 Tagen? Weil nach dem Gesetz des Alten Testaments eine Frau nach der Geburt eines Buben 40 Tage als unrein galt (5). Durch die Geburt eines Mädchens allerdings wurde sie nach diesem Verständnis mehr beschmutzt, und galt doppelt so lang als »unrein« (6). Das ist der biblische Ursprung des Fests von Mariae Lichtmess am 2. Februar. Mariae Lichtmess wurde als Ersatz für das heidnische Frühlingsfest eingeführt. Am 2. Februar beginnt nach dem uralten Bauernkalender das neue Jahr. Das erstarrte Leben erwacht wieder. Ist nicht das Ziel jeder Religion, die Angst vor dem Tod zu nehmen, vor der ewigen Kälte eines schwarzen Nichts?
Fußnoten:
(1) Botheroyd, Paul und Sylvia: »Deutschland/ Auf den Spuren der Kelten«, München 1989, Kapitel Staffelstein, S. 193-196, Zitat S. 194
(2) Menghin, Wilfried: »Kelten, Römer und Germanen/ Archäologie und Geschichte in Deutschland«, Lizenzausgabe, Augsburg 1994, S. 127
(3) Vorndran, Helmut: »Isarnon/ Stadt über dem Fluss/ Ein Keltenroman«, Köln 2016, eBook-Ausgabe, Position 16
(4) Botheroyd, Paul und Sylvia: »Deutschland/ Auf den Spuren der Kelten«, München 1989, Kapitel Staffelstein, S. 193-196, Zitat S. 194
(5) 3. Buch Mose Kapitel 12, Verse 2-4: »Sag zu den Israeliten: Wenn eine Frau niederkommt und einen Knaben gebiert, ist sie sieben Tage unrein, wie sie in der Zeit ihrer Regel unrein ist. Am achten Tag soll man die Vorhaut des Kindes beschneiden und dreiunddreißig Tage soll die Frau wegen ihrer Reinigungsblutung zu Hause bleiben. Sie darf nichts Geweihtes berühren und nicht zum Heiligtum kommen, bis die Zeit ihrer Reinigung vorüber ist.«
(6) 3. Buch Mose Kapitel 12, Vers 5: »Wenn sie ein Mädchen gebiert, ist sie zwei Wochen unrein wie während ihrer Regel. Sechsundsechzig Tage soll sie wegen ihrer Reinigungsblutung zu Hause bleiben.«
2. Karl May und die Pyramide
»Kennt Ihr die Pyramide,
die hier in der Nähe liegt?«
»Das Innere der Pyramide war
ein Geheimnis.«
Karl May »Das Waldröschen«
Der »Schatz im Silbersee« lockte mich 2016 zu den Karl-May-Festspielen nach Bad Segeberg. Ich reiste per Zug an.
Zwischenstopp: Hamburg Hauptbahnhof. Ankunft Hamburg Hauptbahnhof: 13.7. auf Gleis 13 um 13 Uhr 13.
Nirgendwo sonst kann man Karl May mit allen Sinnen genießen wie am Kalkberg zu Bad Segeberg. Man sieht, man hört, man riecht, man fühlt, ja man schmeckt die Welt des »Maysters«. Kein Kino – ob 3D oder 2D – kann da mithalten.
Der »Schatz im Silbersee« lockte mich nach Bad Segeberg.
Und eine Pyramide. Ob Karl May je nach Bad Segeberg gekommen ist? Ob er von der Pyramide gehört hat? Fakt ist, dass der sächsische Dichter vom Geheimnis der Pyramiden fasziniert war. In seinem zehnbändigen Romanzyklus »Waldröschen oder Die Verfolgung rund um die Erde« entführt er uns auch in »Die Pyramide des Sonnengottes«. Helden wie Schurken sind vom »Schatz der Aztekenkönige« fasziniert. Dramatisch geht es bei Karl May »In der Pyramide« (1) zu.
Karl Mays »Schatz im Silbersee«, Bad Segeberg
Ob Karl May über die mysteriöse Pyramide von Bad Segeberg informiert war? Vermutlich nicht. Anno 1622 jedenfalls soll die Pyramide bereits eine baufällige Ruine gewesen sein, anno 1632 dürfte sie weitestgehend in sich zusammengebrochen sein. Es sollten aber noch einige Jahrzehnte vergehen, bis die Mauerreste abgetragen wurden. Anno 1770 stand an Stelle der einstigen Pyramide eine kleine »Kapelle«, die freilich nie als Kapelle diente. Diese »Rantzau-Kapelle« in der »Hamburger Straße« ist von bescheidenen Ausmaßen. Nach meiner Messung hat sie eine Grundfläche von etwas weniger als vier Quadratmetern.
Den Vorgängerbau der Kapelle, die Pyramide, hat Heinrich Rantzau anno 1588 aus einheimischem Kalkstein errichten lassen. Er muss recht imposant gewesen sein. Das pyramidenförmige Dach war immerhin stolze zehn Meter hoch. Mit dem massiven Unterbau erreichte die Pyramide eine Gesamthöhe von vermutlich fünfzehn Metern.
Die »Rantzau-Kapelle« erinnert an die »Rantzau-Pyramide«
Das Türmchen auf dem Dach der heutigen Rantzau-Kapelle zeigt, wie die ursprüngliche Rantzau-Pyramide ausgesehen hat. Von der Pyramide ist so gut wie nichts erhalten, nur der steinerne Altar im Inneren des winzigen Gotteshauses soll schon im Pyramidenbau gestanden haben. Was mich, gelinde gesagt, wundert: Noch vor Jahren wussten viele Einheimische nichts von der einstigen »Rantzau-Pyramide«, geschweige denn, wo sie einst stand. Das hat sich inzwischen geändert. Heute ist der kleine steinerne Backsteinbau leicht zu finden. Man muss nur fragen, bekommt in der Regel richtige Auskunft. Nicht alle Zeitgenossen, die von der kleinen Kostbarkeit gehört haben, wissen, dass Rantzau anno 1588 König Friedrich II. von Dänemark und Norwegen (*1534; †1588) ehren wollte. Der Standort für das steinerne Denkmal war sorgfältig gewählt. Er lag auf freiem Feld außerhalb der Stadtmauer, fast einen Kilometer vom Stadttor entfernt. Die Pyramide wurde auf einem vorgeschichtlichen Grabhügel errichtet. Auf diese Weise sollte eine Verbindung mit uralten Zeiten hergestellt werden. Heute steht der Nachfolgebau, kaum beachtet, mitten in Bad Segeberg in der Hamburger Straße.
Das Türmchen wurde nach dem Vorbild der »Rantzau-Pyramide gestaltet
Mit besonders großer Sorgfalt ging man beim Bau des Fundaments ans Werk. Offenbar sollte die Pyramide noch in ferner Zukunft an König Friedrich II. von Dänemark und Norwegen erinnern.
Wieso hat man Felsgestein für den Unterbau aus dem gut 300 Kilometer entfernten Höxter herangeschafft? Dass man auch gotländische Steine aus Schweden einsetzte – direkte Distanz rund 800 Kilometer – verwundert doch etwas. Gotländische Bildsteine wurden schon im 5., aber noch im 14. Jahrhundert geschaffen. Bekannt ist, dass die mit Reliefs versehenen Steine häufig von ihren ursprünglichen Standorten entfernt und beim Bau mittelalterlicher Kirchen eingesetzt wurden. Der Antransport gotländischer Steine war im 16. Jahrhundert mit erheblichem Aufwand verbunden.
Mussten doch die Felsen von der schwedischen Insel Gotland zunächst über Land geschleppt, dann an Bord von Schiffen verstaut, übers Meer – vielleicht über Lübeck – nach Bad Segeberg gebracht werden. Und das nur, um im eher unansehnlichen Fundament verarbeitet zu werden. Die heute genutzte Bezeichnung »Kapelle« ist irreführend.
Überbleibsel des »Rantzau-Obelisk«
Diente das Bauwerk doch zu keinem Zeitpunkt als Kapelle im religiösen Sinn, sondern stets als Denkmal für Friedrich II. von Dänemark und Schweden.
Die »Rantzau-Kapelle« wurde noch in jüngster Vergangenheit alles andere als besonders gepflegt. In einem traurigen Zustand fristete ein weiteres Monument ein kärgliches, beklagenswertes Dasein: der Rantzau-Obelisk. Das hat sich, zum Glück, geändert. Die historischen Monumente befinden sich wieder in einem guten Zustand.
Heinrich Graf zu Rantzau hat den Obelisk – damals wahrscheinlich bis zu fünfzehn Meter hoch – aufstellen lassen.
Ein deutlich größerer Obelisk in Rom mag als Vorbild gedient haben. Thutmosis III. ließ um 1500 v. Chr. östlich vom Tempel des Amun in Theben einen 500 Tonnen schweren Obelisken aufrichten. Die fast 35 Meter hohe Steinnadel gelangte auf Umwegen von Alexandria nach Rom. 357 wurde sie im »Circus Maximus« aufgerichtet. Ein Erdbeben brachte den Koloss zu Fall. Er zerbrach in mehrere Teile, die Brocken blieben liegen. 1587 ließ Papst Sixtus V. den zertrümmerten Obelisk freilegen, rekonstruieren und erneut aufstellen. An der Spitze wurde ein Kreuz angebracht.
Der »Rantzau-Obelisk« wurde im 19. Jahrhundert Opfer eines Sturms und zerbarst. Ein kärglicher Rest fand, jetzt etwa einhundert Meter von der »Rantzau-Kapelle« entfernt, einen neuen Platz. Zu Beginn des dritten Jahrtausends schien es so, als ob man von Seiten der Stadt kein Interesse am Erhalt der Reste des einst stolzen Obelisken habe. Offenbar hat sich das geändert. Dem Vernehmen nach wurden die noch vorhandenen Überbleibsel (mit hohem finanziellem Aufwand?) konserviert und vor weiterem Verfall bewahrt. Auch die »Rantzau-Kapelle«, einst »Rantzau-Pyramide«, wird offensichtlich gut behandelt, so wie sie es auch verdient.
»Rantzau-Kapelle« und »Rantzau-Obelisk« sind steinerne Denkmäler für eine traurige Realität geworden. Sie dokumentieren den Verfall unserer ureigenen Kultur. Unwissenheit macht sich breit, Missachtung der eigenen Wurzeln ist symptomatisch für unsere Zeit. Viele Zeitgenossen sind einfach nur gleichgültig, andere scheinen eine Art Minder-Wertigkeitskomplex zu entwickeln und im Rahmen von »Multi-Kulti« nur Fremdes zu schätzen. Ich selbst halte nichts von »Multikulti«. Allein schon der saloppe Begriff zeugt von Missachtung und Geringschätzung von Kultur.
Ein Mischmasch aus vielen Preziosen wird zu einem wertlosen Durcheinander, wobei die Schönheiten der einzelnen Kulturen kaum mehr zu erkennen sind. Mit meinem kleinen Beitrag über die »Rantzau-Kapelle« und den »Rantzau-Obelisk« möchte ich Leserinnen und Leser dazu ermutigen, in der eigenen Heimat nach geschichtsträchtigen Monumenten und Kuriosa zu suchen, die mehr Beachtung verdient haben. Ich meine: Man kann sehr wohl fremde Kulturen schätzen, ohne die eigene bestenfalls zu vergessen. Es ist ein Unding, Respekt vor fremden Kulturen zu fordern und nichts für den Erhalt der eigenen Kultur zu tun.
Am 13.7.2016 war ich vor Ort. Am Nachmittag fotografierte ich emsig. Teilweise heftige Schauer wurden immer wieder unterbrochen. Dann machte strahlender Sonnenschein das Fotografieren zum Vergnügen. Augenblicke später aber schüttete es wieder vom Himmel. Die Rantzau-Kapelle erschien in geradezu düsterem, unheimlichem Licht.
Von »meinem« Hotel, dem »Central Gasthof« (2) in der Kirchstraße, sind »Rantzau-Kapelle« und »Rantzau- in wenigen Minuten zu erreichen. Auch zur Freilichtbühne der Karl-May-Festspiele ist es nicht weit.
Noch ein wichtiger Hinweis: Direkt neben dem wirklich empfehlenswerten »Central Gasthof«: die Marien-Kirche mit ihrem herrlichen Altar. Die Marienkirche wird von Grund auf renoviert, vom Fußboden bis zum Dachstuhl. Die Arbeiten werden sich über Jahre hinziehen. Stand: Herbst 2019.
Fußnoten:
(1) »Die Pyramide des Sonnengottes« von Karl May erschien als Band 52 der berühmten Bamberger Gesamtausgabe der Werke Karl Mays. Kapitel 11 trägt die Überschrift »In der Pyramide«
(2) Hotel und Restaurant »Central Gasthof« (Familie Schumacher), Kirchstraße 32, 23795 Bad Segeberg
3. Die Göttin und die Inkas
Bei meinem ersten Besuch in Inga Pirca regnete es mehr als nur in Strömen. Es schüttete sintflutartig vom Himmel.
Die mysteriöse Mauer der wohl schönsten archäologischen Stätte Ecuadors erschien in düster-geheimnisvollem Licht.
Nur gaben meine beiden Kameras schon nach wenigen Sekunden zum Glück nur vorübergehend ihren Geist auf. Zwei Tage später waren sie wieder einsatzbereit. Fotos von Inga Pirca gelangen mir dann erst Jahre später bei mehreren Besuchen vor Ort.
Der Komplex von Inga Pica
Inga Pirca wird, ich meine etwas schmeichelhaft-übertrieben, gelegentlich das »Machu Picchu« von Ecuador gegriffen. Erbaut wurde die Anlage von den Cañari, nicht von den Inka. Trotzdem heißt die mysteriöse guterhaltene »Ruinenstätte« bis heute »Inka-Mauer«, eben »Inga Pirca« (Kechuansprache). Die Inka »eroberten« Inga Pirca, erwiesen sich aber als sehr human. Und das, obwohl ihnen die Kultur der Besiegten äußerst fremd war.
Hier wurden elf Frauen bestattet, vielleicht Priesterinnen
Das Volk der Cañari verehrte den Mond. Es war matriarchalisch orientiert. Ganz anders die Inka. Sie verherrlichten die Sonne, typisch für das Patriarchat. Bei meinem ersten Besuch vor Ort erfuhr ich, dass man bei archäologischen Ausgrabungen die letzte Ruhestätte einer Königin der Cañari ausfindig gemacht habe. Die ohne Zweifel äußerst beliebte Regentin (oder Fürstin) war nicht ohne Begleitung vom Diesseits ins Jenseits gewandert. Zehn Frauen hatten sich ihr angeschlossen. Die zehn Frauen begingen mit Gift Selbstmord. Oder wurden sie ermordet, geopfert? Das geschah vor etwa 1.200 Jahren.
Die Inka »eroberten« Inga Pirca nach Art der Österreicher nach dem Motto »Du glückliches Österreich, heirate!«
Allerdings wohl erst dann, als der erhoffte schnelle militärische Sieg über das kleine Völkchen nicht auf Anhieb gelang. Die vornehmen und selbstbewussten Inka-Adeligen heirateten Cañari-Prinzessinnen und besiegelten damit eine ganz besondere Allianz. Die Cañari blieben autonom. Sie behielten ihren Glauben und setzten ihr gewohntes religiöses Leben fort. Sie behielten ihren Glauben an die Mond-Göttin. Ihr Brauchtum blieb, von den Inka unbeanstandet, das alte. Sprachlich passten sich die zahlenmäßig weit unterlegenen Cañari den Inka an. Die Inka konnten sich von nun an auf die Cañari als treue Verbündete verlassen. Sie hatten in Inga Pirca einen strategisch äußerst wichtigen Stützpunkt und die Cañari wussten, dass ihnen von nun der militärische Schutz der Inka gewährleistet sein würde.
Wasser spielte eine immense Rolle im religiösen Leben der Cañari. Ich bewunderte einen kurios anmutenden Stein, der eine ganze Reihe von Löchern aufwies. Waren sie natürlichen Ursprungs? Keineswegs. Sie waren sorgsam – und wie man mir vor Ort versicherte – nach wissenschaftlichen Berechnungen gebohrt worden. Wann? Vor 1.200, vielleicht 1.500 Jahren? Bei dem seltsamen Löcherstein handelt es sich um einen Mondkalender der Cañari. Die Löcher wurden mit Wasser aufgefüllt, darin spiegelten sich Mond und Sterne. So wurden die für die Cañari wichtigen Daten des Mondjahrs bestimmt. So gab es ein wirklich tolerantes Miteinander der Inkas mit den Cañari. Die einen huldigten weiter dem Mond und der Mondgöttin des Matriarchats, die anderen verehrten weiter die Sonne und Götter des Patriarchats. Beide hatten ihre eigenen Zeremonien und Feiertage, es gab aber auch gemeinsame Festivitäten.
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erschienen die Inka unter Führung von Túpac Yupanqui. Gemeinsam baute man an einem »Groß Inga Pirca«. Man hatte wohl einen geschlossenen Gesamtkomplex im Sinn. Dazu kam es aber nicht. Das geplante Zentrum wurde nicht fertig gestellt. Leider kamen schon im frühen 16. Jahrhundert die ersten Spanier nach Ecuador. Pizarro tauchte 1532 mit seiner blutdurstigen Bande auf. 1534 erschien Pizarros Leutnant Sebastian de Benalcazar in Quito. 1535 dürften Inka wie Cañari in Inga Pirca von den »zivilisierten« Spaniern abgeschlachtet worden sein. Die vermeintlich »Wilden« wurden von den angeblich »Zivilisierten« ermordet. Die herrliche, im Aufbau befindliche Metropole zweier friedlich miteinander lebenden Religionen wurde zerstört.
Wie groß Inga Pirca bereits war, als es von den Spaniern zerstört wurde, wir wissen es bis heute nicht. Es müssten im Umfeld der Ruinen weitere, tiefere Grabungen vorgenommen werden. Wieder einmal fehlt das Geld. Sehr gut erhalten ist der Sonnentempel, den angeblich die Inka angelegt haben. Die imposante Mauer des oval angelegten Gebäudes sieht man schon von weitem. Und aus der Nähe erkennt man die unglaubliche Präzision, mit der teils massive Steine zugeschnitten und mörtellos auf-, an- und ineinander gefügt wurden.