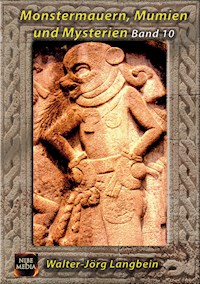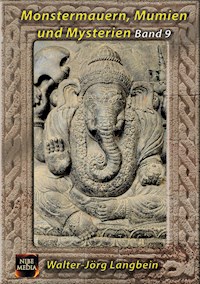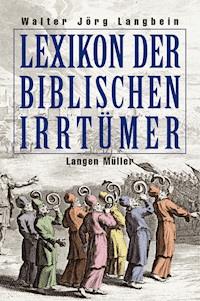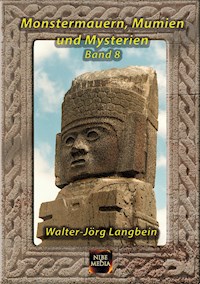
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: NIBE Media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Monstermauern, Mumien und Mysterien
- Sprache: Deutsch
In "Monstermauern, Mumien und Mysterien 8" bietet er Einblick in das weite Spektrum seiner Forschungsarbeit. In 37 Kapiteln entführt der anerkannte Experte in Sachen Grenzwissenschaften seine Leserinnen und Leser auf eine spannende, abwechslungsreiche Reise durch Raum und Zeit. Auch in Band 8 seiner Buchreihe ist Autor Walter-Jörg Langbein wieder mit seinen Leserinnen und Lesern unterwegs zu faszinierenden Stätten. Wir besuchen die mysteriöse Kultstätte bei den "Externsteinen". Wir suchen nach Spuren der Stadt, die vom Himmel fiel. Wir befragen alte Überlieferungen über die endgültige Apokalypse, die tagtäglich über die Menschheit hereinbrechen kann. Wir folgen Winnetou zu brodelnden Geysiren. Wir steigen in die Unterwelt und erkunden einen verborgenen "Heidenzauber".Wir sammeln fantastische Fakten über Engel, Götter, ihre Flugmaschinen und Waffen. Uralte Epen berichten von der Stadt, die seit Jahrtausenden vor der Küste Indiens auf dem Meeresgrund liegt. Es gibt sie wirklich! Wer war Gesar, der Göttliche mit Menschenhaut? Wer brach vom "Nabel der Welt" ins All auf? Warum wird der Genozid der Südsee bis heute verschwiegen? Woher hatte Buddha seine Laser-Waffe? Und wer schuf die "Erdställe"? Bauten die Kelten im Norden Perus eine gigantische Monstermauer um eine Stadt in den Wolken?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter-Jörg Langbein
Monstermauern, Mumien und Mysterien 8
Reisen zu geheimnisvollen Stätten unseres Planeten
Impressum
© NIBE Media © Walter-Jörg Langbein
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags und des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für den Inhalt des Buches ist allein der Autor verantwortlich und er muss nicht der Meinung des Verlags entsprechen.
Created by NIBE Media
Bilder, soweit nicht gekennzeichnet, Archiv Langbein Printed in Germany
NIBE Media
Broicher Straße 130
52146 Würselen
Telefon: +49 (0) 2405 4064447
E-Mail: [email protected]
www.nibe-media.de
Walter-Jörg Langbein; Vijayanagara, Südindien;
Foto: Ingeborg Diekmann
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort: »Vieles auf Erden ist uns verborgen.«
1. Der Engel der Apokalypse und der Bienenkorb aus Stein
2. Der »Hebel Gottes«
3. Der Gott der Zerstörung
4. Stadt der tausend Tempel
5. Von der Kreuzigung zum Teufelsarsch
6. Die Externsteine und das Blutloch
7. Rätselraten um eine Schlacht
8. Das Medaillon und eine Göttin?
9. Nikolaus und die goldenen Äpfel
10. Das Grauen der Osterinsel
11. Der Genozid
12. Das Ghetto
13. Woher, wohin?
14. Dicke Steine
15. Landung auf Dekehtik
16. Die Hölle unter unseren Füßen
17. Winnetou, tödliches Gas und Old Faithful
18. Die Stadt, die vom Himmel fiel
19. Laser-Schwerter und die Wächter am Paradies
20. Heidenzauber unter der Kirche
21. Der Engel auf dem Feuerstrahl
22. Götter, Engel, Flugmaschinen und Waffen
23. Tod im Feuerball
24. Die Stadt auf dem Meeresgrund
25. John Frum und ein Gott im Dekolleté
26. Buddha und die Laser-Waffe
27. Die geheimnisvolle Welt der Erdställe
28. Vom Nabel der Welt ins All
29. Raumfahrt und Gesar, der Göttliche mit Menschenhaut
30. Kuelap – Kultur aus dem Nichts
31. Kamen die Kelten bis nach Peru?
32. Der Schrei der Mumie
33. Der Schrei der »Banshee«
34. Halloween und der Mord an JFK
35. Spurensuche
36. Das verschwundene Schloss
37. Dreizehn Schanzen
Vorwort: »Vieles auf Erden ist uns verborgen.«
Liebe Leserin, lieber Leser!
Lassen Sie sich zu geheimnisvollen Orten unseres Planeten entführen. Wir finden Sie direkt vor unserer Haustür.
Und wir finden Sie in weiter Ferne. Nichts ist wirklich verborgen, sobald wir bereit sind, auch das Fantastische für möglich zu halten. Jacques Bergier (1) und Louis Pauwels (2) proklamierten bereits 1962 ein neues Zeitalter. Sie forderten den (3) »Aufbruch ins dritte Jahrtausend.« und sie glaubten an die »Zukunft der phantastischen Vernunft«.
Wenn wir gleich gemeinsam geheimnisvolle Stätten unseres Planeten aufsuchen, dürfen wir uns auf die »phantastische Vernunft« verlassen.
Louis Pauwels schrieb im Vorwort zu »Aufbruch ins dritte Jahrtausend« (4): »Das Phantastische ist in unseren Augen nicht gleichbedeutend mit dem Eingebildeten. Untersucht man jedoch die Realität mit der Einbildungskraft, so entdeckt man, daß die Grenze zwischen dem Wunderbaren und dem Positiven oder, wenn man so will zwischen der unsichtbaren und der unsichtbaren Welt eine sehr dünne Linie ist.« Jacques Bergier erklärte mir einmal: »Es ist sehr wichtig, den phantastischen Realismus in die Naturwissenschaften einzuführen, wenn man die Wirklichkeit wirklich erfassen möchte.«
Wenn wir gleich gemeinsam zu einer weiteren Weltreise zu den großen und kleinen Mysterien unserer Welt aufbrechen, dann bleiben wir in der Welt des Sichtbaren. Wir werden aber erleben, dass uns nur der phantastische Realismus erkennen lassen kann, wie weit verbreitet das nur scheinbar Unmögliche ist. Die Wirklichkeit ist sehr viel fantastischer als die Schulwissenschaft uns glauben lässt.
Der große Albert Einstein (5) schrieb (6): »Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat.« Ehren wir wieder den intuitiven Geist, unseren intuitiven Geist!
Wenn wir uns gleich gemeinsam auf die Suche nach dem Fantastischen in aller Welt machen, dürfen wir uns auf unsere Intuition verlassen. Wir werden mehr finden als wir vielleicht selbst für möglich halten. Fjodor Michailowitsch Dostojewski (7) notierte (8): »Vieles auf Erden ist uns verborgen.« Das stimmt. Aber wir werden auf unserer Reise Vieles im Verborgenen entdecken, wenn wir Fantasie, Intuition und fantastische Vernunft zulassen! Nicht zulassen dürfen wir Scheuklappen. Wir müssen sie ablegen. Scheuklappen werden bei Pferd und Esel angebracht, um das Gesichtsfeld der Tiere einzugrenzen. Lassen wir uns keine Scheuklappen anlegen, weder religiöse noch schulwissenschaftliche. Die Scheuklappen, die man gern Menschen verpasst, heißen Dogmen. Arthur Schopenhauer (9) wusste, dass Dogmen sehr kurzlebig sein können (10): »Die Dogmen wechseln, und unser Wissen ist trüglich.«
Albert Einstein warnte vor Wissenschaftsgläubigkeit (11):
»Aus diesen Gründen sollten wir auf der Hut sein und keine Wissenschaft und wissenschaftliche Methode überschätzen, wenn es um Probleme der Menschheit geht; und wir sollten nicht davon ausgehen, dass Experten die einzigen sind, die ein Recht darauf haben, sich zu Fragen zu äußern.«
Natürlich stimmt es, was Albert Einstein nüchtern festgestellt hat! Nicht nur »Experten« haben das Recht ihre Meinung kundzutun. Machen wir uns gemeinsam auf eine Reise durch Raum und Zeit! Bilden Sie sich eine eigene Meinung! Und glauben Sie mir nichts, liebe Leserin und lieber Leser! Bilden Sie selbst ein eigenes Urteil!
Ich wünsche eine spannende, informative, ja aufregende Reise!
Ihr
Walter-Jörg Langbein
Fußnoten:
(1) *1912; †1978
(2) *1920; †1997
(3) Pauwels, Louis und Bergier, Jacques: »Aufbruch ins dritte Jahrtausend/ Von der Zukunft der phantastischen Vernunft«, Bern und Stuttgart 1962
(4) Pauwels, Louis und Bergier, Jacques: »Aufbruch ins dritte Jahrtausend/ Von der Zukunft der phantastischen Vernunft«, Bern und Stuttgart 1962, S. 31, 25.-30. Zeile von oben
(5) *1879; †1955
(6) https://gutezitate.com/zitat/102158 (Stand 29.8.2019)
(7) *1821; †1881
(8) Dostojewski, Fjodor Michailowitsch »Die Brüder Karamasow«, 1878-1880
(9) *1747; †1805
(10) Schopenhauer, Arthur: »Die Welt als Wille und Vorstellung«, 1819, mehrfach ergänzt, seit 1844 in zwei Bänden, Zitat aus »Erster Band. Viertes Buch. Der Welt als Wille zweite Betrachtung: Bei erreichter Selbsterkenntnis Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben«
(11) Einstein, Albert: Artikel, erschienen in »Monthly Review«, 1949
1. Der Engel der Apokalypse und der Bienenkorb aus Stein
»Und wohin soll die nächste Reise gehen?«, fragt mich der Zahnarzt und bohrt gnadenlos weiter. Meinem weit geöffneten Mund entwichen einige unartikulierte Laute. »Aha, soso, also nach Südamerika, und wohin genau?« Wieder versuche ich so gut wie mir das möglich ist zu antworten.
Das fällt mir mit weit aufgerissenem Mund und einem surrenden Bohrer am schmerzenden Zahn nicht leicht. Mein Zahnarzt hat mich verstanden. Er wiederholt: »Ecuador … Ecuador …« Und er gerät ins Schwärmen: »Ja, da möchte ich auch gern mal hin … zum Beispiel nach Quito!«
Ich wundere mich schon lange nicht mehr darüber, dass der Zahnarzt genau versteht, was jeden anderen Menschen kaum noch an menschliche Sprache erinnert. Geduldig hört er meine Sprechversuche an, arbeitet konzentriert weiter, nickt, versteht und empfiehlt: »Dann müssen Sie aber unbedingt den Engel der Apokalypse besuchen!« Ich nicke nun auch. »Nicht mit dem Kopf wackeln, oder wollen Sie, dass ich in die Zunge bohre?« Ärgerlich schüttelt der Herr im weißen Kittel den Kopf und bohrt weiter. »Gleich haben wir's!«
Einige Wochen später stehe ich am Fuße des »Engels der Apokalypse«. Der spanische Künstler Agustín de la Herrán Matorras wurde vom Orden »Oblaten der seligen Jungfrau Maria« beauftragt, das 45 Meter hohe Aluminium-Monument einer Madonna zu bauen. Anibal Lopez aus Quito setzte ihn nach den präzisen Vorgaben von Augustín de la Herrán Motottas zusammen. 7.000 vorgefertigte Aluminiumteile wuchsen so zu einer mysteriösen Statue zusammen. Am 28. März 1976 wurde das Monument eingeweiht. Aber hat der Künstler wie bestellt eine geradezu gigantische Madonna entworfen und kreieren lassen? Die erwünschte Größe wurde exakt eingehalten. Zum Vergleich: Das »Hermannsdenkmal« ist mit einer Höhe von nur 26,57m die größte Statue Europas. Der Engel von Quito ist erheblich größer. Aber entstand eine Madonna wie bestellt?
Einwand: Keine Mutter Gottes, keine Madonna, kann mit Flügeln aufwarten. Das geflügelte Wesen von Quito steht auf einem Globus, um den sich eine riesige Schlange windet. Der Engel hat sie überwältigt. Er hält sie mit festem Griff an einer eisernen Kette. Ist es wirklich eine Schlange?
Der »Engel der Apokalypse«;
Foto: wiki commons Cayambe
Der Kopf erinnert mehr an ein monströses Fabelwesen als an die Schlange, die im Paradies Eva verführte. Eine Plakette, am sakralen Kunstwerk der Sonderklasse angebracht, klärt uns auf: Die attraktive Lady mit den Flügeln soll der »Engel der Apokalypse« sein, so wie im Buch »Offenbarung«, auch bekannt als »Apokalypse des Johannes«, beschrieben. Eine typische Madonna sieht anders aus. Die Plakette ist hilfreich. Sie nennt die Bibelstelle, die als Vorlage für den Engel gedient haben soll. Es ist Kapitel 12 der »Apokalypse des Johannes« (1). Im ersten Vers lesen wir: »Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen.« In Vers 14 lesen wir weiter: »Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers.« Genauso wurde auch die Riesenstatue gestaltet: Mit zwei Flügeln. Es gibt aber erhebliche Unterschiede zwischen Bibeltext und Statue hoch über Quito in Ecuador. Die Riesenfrau steht auf einem Drachen. Das entspricht in keiner Weise dem Kapitel 12 der »Apokalypse«. Auch sieht der ganz anders aus als in der »Apokalypse des Johannes« beschrieben.
Der Engel der Apokalypse steht auf einer Drachen-Schlange;
Foto: wiki commons Cayambe (Ausschnitt)
In Vers 3 der »Apokalypse« wird quasi ein Steckbrief von dem Monster geliefert: »Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen.« Das Ungetüm zu Füßen des Engels hat weder sieben Häupter noch zehn Hörner. Am 28. März 1976 weihte Pablo Munoz Vega, der 11. Erzbischof von Quito, das Denkmal. Wer oder was war die Riesenstatue für den frommen Kirchenmann? War es die Maria von Quito? War es der Engel der Apokalypse? Die mächtigen Flügel an den Schultern der stolzen Statue passen zum Engel des Untergangs, die Schlange zur Madonna? Ich wiederhole mich ungern: Mir sind keine Mariendarstellungen mit Flügeln bekannt. Des Rätsels Lösung: Die Statue ist eine Mischung aus der Gottesmutter Maria, die den Kopf der Schlange zertritt, und dem Engel der Apokalypse, so wie in der Bibel beschrieben. Wie die Madonna, Jesu Mutter ausgesehen hat, verschweigt die Bibel.
Verschmitzt lächelnd erklärt mir ein Geistlicher vor Ort:
»Wir nennen sie lieber ›Maria von Quito‹ als unseren ›Engel der Apokalypse‹! Maria klingt nicht so furchteinflößend wie
›Engel des Weltuntergangs!‹«. Als Vorlage für die riesenhafte Statue diente eine kleine Skulptur, die Bernardo de Legardo anno 1734 geschaffen hat. Sie zeigt, heiß es, die »Jungfrau von Quito«. Das kleine Kunstwerk ist auch unter dem Namen »die Tänzerin« bekannt. Seltsam: »Tänzerin« klingt recht irdisch und gar nicht nach »Madonna«. Milde lächelnd blickt die Statue auf blutgetränkten Boden. Anno 1822 fand hier die »Schlacht von Pichincha« statt. General Antonio José de Sucre besiegte die spanischen Truppen.
Aufständische Rebellen beendeten damit endgültig die Vormacht der Spanier, die so viel Leid über Südamerika gebracht hatten.
Ich stehe zu Füßen der Statue, auf einem Hügel am Rande Quitos. Die Erderhebung hat die Gestalt eines Brotlaibes, deshalb heißt sie im Volksmund »El Panecillo«, »das Brötchen« oder »der kleine Brotlaib«.
»Hier oben wurde einst ein Denkmal der Heiden verehrt.
Sie beteten zu den Gestirnen und beobachten Sonne, Mond und Sterne.«, erfahre ich von meinem priesterlichen »Guide«. Der Kultbau, der wohl schon vor den Zeiten der Inkas entstanden ist, sei von den Spaniern zerstört worden.
Autor Walter-Jörg Langbein vor dem »Bienenkorb«;
Foto: Willi Dünnenberger
Zusammen mit dem Geistlichen gehe ich einige Schritte in Richtung einer kleinen steinernen Mauer. Zu unseren Füßen erstreckt sich Moloch Quito. Aus etwas mehr als 3.000 Metern Höhe lässt sich die Hauptstadt Ecuadors überblicken. Sie liegt unter einer wabernden Glocke aus Abgasen aus Fabrikschornsteinen und von qualmenden Feuern in den Armenvierteln.
Wie viele Menschen in der Stadt wohnen, die sich wie ein Krake ausbreitet, weiß niemand wirklich zu sagen. Amtliche Daten, von eifrigen Beamten ermittelt, sind wenig verlässlich. Denn ständig strömen aus der verarmten ländlichen Umgebung Arbeitsuchende in die Stadt. Sie bauen sich illegal Hütten. 1.500.000 Menschen soll Quito anno 2005 beherbergt haben. Heute sind es 2.700.000 oder mehr. Zu unseren Füßen mache ich ein seltsames »Gebäude« aus: Es ist eine steinerne Kuppel ohne Fenster. »Das ist unser Bienenkorb von Quito!«, erklärt mir der Geistliche fast etwas unwirsch. »Manche nennen das Ding auch ›la olla‹, also Kochtopf.«
Das kuriose Denkmal ist knapp über sechs Meter hoch, sein Durchmesser beträgt drei Meter. Die einzige Öffnung führt nach oben, zum Himmel. 45 cm misst das kreisrunde Loch. Gebaut wurde »der Kochtopf« aus exakt zugehauenen, feinporigen Andesit-Steinen. Das Material ist also vulkanischen Ursprungs. Mit dem Priester umrunde ich auf gepflastertem Boden das mysteriöse Gebäude. Seine Basis liegt tiefer, ragt aus einem runden Schacht empor. »Kommt man heute noch hinein?«, möchte ich wissen.
Ich erfahre, dass das möglich ist. Man muss nur vom »steinernen Bienenkorb« bergab Richtung Stadt klettern.
Dann steht man an einem Tunneleingang. Kriecht man in den steinernen Schlund, so gelangt man unterirdisch direkt in das Innere des »Bienenkorbs«. Empfehlenswert ist ein solcher Versuch aber nicht. Schon der Abstieg zum Tunneleingang ist nicht ungefährlich. Und im kurzen Tunnel selbst hausen angeblich Obdachlose, die neugierige Touristen in ihrem Unterschlupf nur ungern sehen. Überhaupt gilt der Region um den »Bienenkorb« als höchst gefährlich.
Touristen wird dringend abgeraten, zu Fuß von der Stadt herauf zum Denkmal zu wandern. So warnt »Ecuador und Galápagos«, ein Reiseführer (2):
»Da der Weg zum ›Freiheitsgipfel‹ nicht ungefährlich ist, sollte man ein Taxi nehmen. Vom Unabhängigkeitsplatz hinauf zum Gipfel kostet eine Taxifahrt – die Wartezeit des Fahrers mit eingerechnet – zwei bis drei US-Dollar!« Welchem Zweck diente dieses runde »Auge«? Vielleicht war es ein Rauchabzug? Wenn im Inneren der steinernen Kuppel ein Feuer geschürt wurde, konnte der Qualm durch das kleine Loch in der kuppelförmigen Decke abziehen. Wenn der »Bienenkorb« so etwas wie eine Behausung war, wieso gab es dann keine Fenster? Und selbst wenn der Rauch durch die »Dachluke« entweichen konnte, dürfte der Qualm im Inneren einen längeren Aufenthalt höchst unangenehm gestaltet haben!
»Vielleicht war es ja auch so etwas wie ein Observatorium, zur Beobachtung von Sonne, Mond und Sternen«, räumt der kundige Geistliche ein. »Vielleicht ist das steinerne Ding ja eine alte heidnische Kultstätte?« Meine Vermutung wird empört mit einer barschen Handbewegung beiseite gewischt. Tatsächlich gab es einst als einzigen Schmuck an der Außenseite die Darstellung einer »Sonnengottheit«. Auf einer »Sonnenscheibe« war so etwas wie ein menschliches Gesicht zu sehen. Hatte also doch ein uraltes sakrales Gebäude die Zerstörungswut der Spanier überlebt? Angeblich ist das nicht der Fall. Das ursprüngliche Bauwerk sei von den Spaniern abgerissen, später sei eine Kopie mit der Gravur einer heidnischen Sonnengottheit errichtet worden!
Seltsam. Wie dem auch sei: Der Bienenkorb wurde gemauert. Die Inkas aber setzten nie Mörtel ein. Diese Tatsache spricht gegen die Inkas als Erbauer des mysteriösen Monumentes. Wer aber hat es dann errichtet? Seltsam: Die Schlange mit dem Monsterkopf zu Füßen des Engels der Apokalypse und die Sonnen-Gottheit am »Bienenkorb« von Quito muten so gar nicht christlich an. Ich fühle mich an uralte matriarchalische Religionen erinnert, in denen Schlangen, Drachen, Sonne und Mond eine besonders wichtige Rolle spielten.
Geologisch ist Quito sehr interessant. Fast die gesamte Stadt liegt auf sandigem Boden, den der Vulkanismus hinterlassen hat. Erdbeben und Vulkanausbrüche tauchten die Stadt immer wieder in apokalyptische Szenarien. Alte Gebäude, so wissen Einheimische, wurden mindestens vier Mal bei Vulkaneruptionen zerstört und wieder errichtet. Vierzehn Vulkane um Quito wirken recht bedrohlich. 2002 brach in der Millionenmetropole Quito der im Osten gelegene Vulkan »Reventador« aus. Vulkanasche schien alles beerdigen zu wollen. Die Menschen gerieten in Panik. Die Behörden riefen den Notstand aus. Noch schlummert der Reventador, der seit Jahrhunderten regelmäßig ausbricht. Auf Satellitenfotos erkennt man seinen Schlund, der wie ein düsteres Tor zur Hölle aussieht. Vierzehn Vulkane umgeben Quito. Die meisten Bewohner verdrängen es wohl. Aber es ist eine Tatsache, dass ein Inferno droht. Jederzeit kann es wieder ausbrechen. Es wird zu einer Apokalypse von Quito kommen.
Die Frage ist nicht, ob das jemals geschieht, sondern wann es dazu kommt! Der geflügelte »Engel der Apokalypse« scheint beschwichtigend die rechte Hand zu heben. Zu seinen Füßen windet sich eine Schlange um den Globus, so wie auch ganze Ketten noch aktiver Vulkane unseren Erdball umschlingen. Die Apokalypse ist vorprogrammiert. Supervulkane bedrohen die Existenz der Menschheit. Von ihren wahren Ausmaßen haben wir keine Ahnung. So zeigte es sich, dass der gigantische Lavasee unter dem riesigen Areal des »Yellowstone Nationalparks« in Nordamerika noch sehr viel größer ist als bislang schon befürchtet.
Fußnoten:
(1) »Apokalypse des Johannes«, Kapitel 12, Verse 1-18
(2) Falkenberg, Wolfgang: »Ecuador und Galapagos«, 4. Auflage, Bielefeld 2000, S. 145
2. Der »Hebel Gottes«
Liegt die Gefahr, die die Erde bedroht, auf dem Grund des Pazifiks? Unterseeisch grummelt es gewaltig. Wir verdrängen gern die Gefahr. Wir verschließen die Augen auch vor dem Offensichtlichen. Wir wollen gar nicht wissen, dass auf dem Meeresgrund Zeitbomben ticken, die alles Leben auf der Erde auslöschen können. Nach uralten Überlieferungen waren es »Apokalypsen«, die die Gestalt von Planet Erde prägten. Wir nehmen unbewusst die äußere Gestalt der Erde als unveränderlich und gleichbleibend wahr. Das liegt an der Kurzlebigkeit des Menschen.
Die Osterinsel – »Ende des Landes«
Lange galt in der wissenschaftlichen Welt die Lehre vom »Fixismus«: Man ging davon aus, dass die Erdkruste fest mit dem Untergrund verbunden ist. Die Lehre vom »Mobilismus« indes postuliert eine horizontale Bewegung der Erdkruste. Alfred Lothar Wegener (*1880; †1930) ging davon aus, dass unser Globus einst ganz anders ausgesehen hat als heute. Seiner Überzeugung nach, die in der Welt der Wissenschaft zunächst fachübergreifend abgelehnt wurde, heute aber allgemein anerkannt wird, gab es einst einen riesigen Urkontinent, der auseinanderbrach. Die einzelnen Teile schwammen wie Kuchenbrocken auf einer zähflüssigen Suppe aus Schokolade.
Anders formuliert: Der Urkontinent war ein ineinandergefügtes Puzzle. Die einzelnen Puzzleteile zerbrachen und drifteten auseinander. Seltsamerweise wird in der Schulwissenschaft bis heute weitestgehend nur eine horizontale Verschiebung von Landmassen akzeptiert, eine vertikale (nach unten und oben) aber abgelehnt. Deshalb gibt es im heutigen Weltbild der Wissenschaft keinen Platz für ein Atlantis im Atlantik oder ein Mu alias Lemuria im Pazifik. Uralte Überlieferungen etwa der Hopi-Indianer, bezeugen ein ganz anderes Erd-Weltbild. Demnach kann an der einen Stelle eine Landmasse absinken, wodurch an anderer Stelle eine Landmasse emporgehoben wird. Demnach gibt es auch Bewegungen von Landmassen nach oben und unten.
Nicht bekannt ist, dass geheime Osterinsel-Dokumente Beweise für die Existenz eines »Atlantis der Südsee« enthalten. Als Thor Heyerdahl (*1914; †2002) in den Jahren 1955 und 1956 intensiv Ausgrabungen auf der Osterinsel durchführte, kam er vorübergehend in den Besitz von mysteriösen Notizen. Er durfte sie aber nicht behalten, sondern musste sie wieder zurückgeben. Heyerdahl fertigte zum Glück Kopien an. Im Jahr 1963 durfte der französische Osterinselforscher Francis Mazière (*1924; †1994) ebenfalls geheime Aufzeichnungen über die Geschichte der Osterinsel studieren. Auch er erhielt die Dokumente nur leihweise.
Wo sind die Unterlagen geblieben, die von einer gewaltigen Katastrophe zu berichten wissen, die sich in der Südsee ereignet hat? Trotz intensiver Recherche gelang es mir bislang nicht, die Dokumente aufzuspüren. Wurden sie inzwischen vernichtet? Werden sie noch auf der Osterinsel, vielleicht in einer der Höhlen, versteckt? Gelangten die Unterlagen in ein chilenisches Museum, wo sie irgendwo in den Archiven im Keller verstauben? Oder wurden sie von einem reichen Sammler erstanden, der sie nur für sich allein behalten möchte?
Die russischen Gelehrten Prof. Dr. Fjodor Petrowitsch Krendeljow und Dr. phil. Aleksandr Michailowitsch Kondratow zitierten erstmals 1980 in ihrem Buch »Die Geheimnisse der Osterinsel« (1) explosives Material aus den geheimen Unterlagen, die Jahrzehnte zuvor Heyerdahl zur Verfügung gestanden hatten. Eine Übersetzung ins Deutsche erschien 1987 in Moskau und Leipzig. Es wurde in diesen geheimen Überlieferungen der Osterinsel ganz eindeutig von einem »Atlantis der Südsee« gesprochen. Da heißt es zum Beispiel (2):
»Der Jüngling Tea Waka sagte: ›Unsere Erde war früher ein großes Land, ein sehr großes Land.‹ Kuukuu fragte ihn:
›Aber warum wurde das Land klein?‹ Tea Waka antwortete:
›Uwoke senkte seinen Stab darauf. Er senkte seinen Stab auf die Gegend Ohio.‹«
Nach der mythischen Tradition der Südsee gab es einst ein großes Königreich in der Südsee. Uwoke, ein mächtiger Gott des Erdbebens, berührte mit einem »Stab« das Land.
Große Teile davon versanken. Übrig blieb, so wissen es die alten Überlieferungen, die Osterinsel. Weiter heißt es in Heyerdahls Kopien, zitiert bei Krendeljow und Kondratow (3):
»Es erhoben sich Wellen, und das Land ward klein. Der Stab Uwokes zerbrach am Berg Pukupuhipuhi. Von nun an wurde es Te-Pito-o-te-Henua, der Nabel der Erde genannt.«
In einer anderen Überlieferung, ebenfalls in den Aufzeichnungen Thor Heyerdahls vor dem Vergessen bewahrt, heißt es: »Kuukuu sagte zu ihm: ›Früher war diese Erde groß.‹ Der Freund Tea Waka sagte: ›Diese Gegend nennt sich Ko-te-To-monga-o-Tea-Waka.‹ Ariki Hotu Matua fragte:
›Warum versank das Land?‹ ›Uwoke machte das; er versenkte das Land‹, antwortete Tea Waka. Von nun an wurde das Land Te-Pito-o-te-Henua genannt.‹« Te-Pito-o-te-Henua bedeutet »Nabel der Welt«.
Heyerdahls Kopien der geheimen Überlieferungen belegen: Die Osterinsel war einst ein Teil des »Atlantis der Südsee«. Das uralte Reich ging in einer gewaltigen Naturkatastrophe unter. Die Osterinsel blieb als kleiner Rest des einstigen Landes (Kontinent? Inselgruppe?) bestehen. Ein Kontinent versank fast vollständig, nur einige Inseln blieben übrig, die noch heute aus dem Pazifik ragen.
»Rapa Nui«, so erfahren wir aus heutigen Reiseführern, sei der polynesische Name der Osterinsel. Aber was bedeutet dieser Name? Dr. Emil Reche verfasste eines der Standardwerke über die Südsee: »Polynesien«. Ausführlich geht der sprachwissenschaftlich geschulte Weltreisende auf die Osterinsel ein (4):
»Der Name der Insel: Rapa Nui«, so klärt er auf, »bedeutet: Weite Fläche, was doch heute ganz gewiss nicht auf die kleine felsige Insel zutrifft. Unter diesem Namen ist aber die Insel allen Polynesiern bis nach der Hawaii-Gruppe und bis nach Neuseeland bekannt.« Dr. Emil Reche schlussfolgert, dass die Osterinsel also einmal tatsächlich groß gewesen sein muss. Oder genauer: Die kleine Osterinsel, so wie wir sie heute kennen, war einmal ein Teil eines großen Reichs im Pazifik.
Auf der Osterinsel selbst ist das Eiland unter dem melodisch klingenden Namen »Pito te henua« bekannt: »Nabel der Welt«. Eine andere Übersetzung: »Ende des Landes«.
Das heißt, dass die Osterinsel einst Teil einer wesentlich größeren Landmasse war. Das heutige »Rapa Nui« war ein Teil einer einst riesigen Insel, die Osterinsel lag damals am Rand.
»Kosmische Lehrmeister« unterrichteten die Hopi-Indianer über Erde und Weltall
Uralt ist das Wissen der Hopi-Indianer. White Bear Fredericks, damals angesehener Stammesältester, diktierte dem ehemaligen NASA-Ingenieur Josef Blumrich (*1913; †2002) den »Erdmythos der Hopi-Indianer«. Die umfangreichen Überlieferungen erschienen 1979 als Buch unter dem Titel »Kasskara und die sieben Welten« (5). Damit wurde White Bears reicher Wissensschatz erstmals in gedruckter Form publiziert.
Nach den Hopi-Indianern gab es einst im Pazifik einen Kontinent namens »Kasskara«. Der versank bei einer gewaltigen Katastrophe in den Fluten des Meeres. Überliefert ist eine Erklärung: Während weite Regionen im Pazifik absanken, wurden zum Ausgleich im Osten von Kasskara andere Regionen hoch emporgehoben. Reine Fantasie?
Ganz und gar nicht.
Die Zyklopenstadt Tiahuanaco hatte einst einen Hafen;
Foto: Ingeborg Diekmann
Wiederholt besuchte ich die uralten Ruinen von Tiahuanaco an der Grenze zwischen Bolivien und Peru, die in einer Höhe von gut 4.000 Metern liegen. Hier oben entdeckten Wissenschaftler Hinweise auf maritimes Leben. Ausgrabungen förderten erstaunliche Fossilien etwa von Schellfisch und anderem Getier aus dem Meer zutage, die nicht in die Hochanden, sondern ans Meer gehören. Selbst die »fliegenden Fische«, deren Fossilien ausgegraben wurden, dürften wohl kaum in die Hochanden geflattert sein.
Tiahuanaco, in einer Höhe von 4.000 Metern, muss einst eine Hafenstadt mit massiven Hafenanlagen gewesen sein.
Eine ganze Flotte hatte einst im Hafen der Stadt Platz. Wie kann eine Hafenstadt in eine Höhe von 4.000 Metern über dem Meeresspiegel gelangt sein? Meine Vermutung: Unvorstellbare Kräfte müssen am Werk gewesen sein, als das »Atlantis der Südsee« versank, als die einstige Hafenstadt Tiahuanaco emporgehoben wurde. Das würde bedeuten, dass in relativ »junger Vergangenheit« gewaltige tektonische Veränderungen stattgefunden haben. Eine Erklärung für das extreme Emporsteigen der einstigen Hafenstadt ins Hochgebirge findet sich in der Mythologie der Osterinsel.
Verantwortlich ist nach der Überlieferung von Rapa Nui der Gott der Zerstörung Uoke (6):
»Früher war das Land Rapa Nui so groß und ausgedehnt wie das heutige Festland. Aber Uoke hatte darüber eine große Macht. Er hob und senkte es, wann er Lust hatte. Zu diesen Erdbewegungen verwendete er einen Hebel. Wenn er Rapa Nui hob, reichte seine Oberfläche bis zum Festland Puku Puhipuhi. Eines Tages, als Uoke sich damit vergnügte, einen Teil Rapa Nuis zu senken, um das Festland zu heben, brach der Hebel. Rapa Nui, das sich in diesem Augenblick unten befand, blieb klein, nur die Berge ragten aus dem Meer hervor, während das Festland groß blieb, da es sich oben befand. So entstand diese Insel (die Osterinsel, der Verfasser), und sie wurde zu dieser Zeit ›Te Pito Te Henua‹, das ist: ›Der Nabel der Welt‹ genannt.«
Den Menschen vor Jahrhunderten, ja vor Jahrtausenden waren die naturwissenschaftlichen Hintergründe kosmischer Katastrophen unbekannt. Naturgewalten vermochten sie nicht wissenschaftlich zu erklären. Naturgesetze im wissenschaftlichen Sinn waren unbekannt. Erklärungen wurden gesucht und gefunden. Schreckliche Geschehnisse wie Naturkatastrophen galten als das Wirken »göttlicher Mächte«.
In der Mythologie der Osterinsulaner wurde »der Stab Uwokes« oder »der Blitz Make Makes« für den Untergang des Kontinents in der Südsee verantwortlich gemacht. In der Volksüberlieferung wurde eine religiöse Ursache der Katastrophe gesucht und gefunden: Ein Gott schlägt das Atlantis der Südsee und es wird zum großen Teil versenkt. Betrachtet man diese Aussagen mit heutigem Wissensstand, dann wird wahrscheinlich, dass in der Südsee ein Vulkanausbruch unvorstellbaren Ausmaßes die Katastrophe ausgelöst haben dürfte. Platons Atlantis könnte einem gewaltigen Himmelskörper zum Opfer gefallen sein, der im Atlantik aufschlug. Fakt ist: Der gesamte Pazifikraum ist ein Hort extremer Gefahr. Ein Gürtel von unterseeischen Vulkanen kann jederzeit zu Kataklysmen ungeahnten Ausmaßes, zur nächsten Apokalypse, die alles Leben auf Erden auslöscht, führen.
Was mag das Verschwinden des »Atlantis der Südsee« verursacht haben? Mag sein, dass ein Himmelskörper aus dem All wie eine Bombe im Meer einschlug. Vielleicht brach auch ein unterseeischer Vulkan aus. Vielleicht löste ein Himmelskörper durch seinen Einschlag einen Vulkanausbruch aus. Wie auch immer: Gewaltige Magmamassen wurden in die Atmosphäre geschleudert. Die Konsequenzen für die Erde waren sehr drastisch: Es entstand so etwas wie ein riesiger Sonnenschirm aus Magma und sonstiger emporgeschossener Materie, so dass eine unnatürliche Dunkelheit ausbrach. Und eine Sintflut suchte die Erde heim. Sie verwüstete das Land, tötete Mensch und Tier.
Interessanterweise werden auch bei den Mayas exakt diese beiden Naturphänomene geschildert. Im Popol Vuh, der »Bibel der Mayas«, heißt es: »Darum verdunkelte sich das Antlitz der Erde, und es begann ein schwarzer Regen, Tagregen, Nachtregen.«
Der 21.12.2012 ist vergangen, ohne dass der Weltuntergang ausgebrochen ist. Fakt ist: Es gibt keine Mayaprophezeiung die den 21.12.2012 als Termin für die finale Apokalypse nennt. Die Mayas haben sich also gar nicht geirrt. Eine weltweite Apokalypse ist aber jederzeit möglich. Sie wird auch eines Tages über unseren Planeten hereinbrechen.
Die Frage ist nicht ob, sondern wann.
Fußnoten:
(1) Krendeljow, Prof. Dr. Fjodor Petrowitsch und Kondratow, Dr. phil. Aleksandr Michailowitsch: »Die Geheimnisse der Osterinsel«, Moskau und Leipzig 1987, Seiten 108-110
(2) Ebenda, S. 109
(3) Ebenda
(4) Reche, Dr. phil. Emil: »Polynesien«, Leipzig 1936, S.25-28
(5) Blumrich, Josef F.: »Kasskara und die sieben Welten/White Bear erzählt den Erdmythos der Hopi-Indianer« Düsseldorf, Wien 1979
(6) Felbermayer, Fritz: »Sagen und Überlieferungen der Osterinsel«, Nürnberg 1971., S. 28
3. Der Gott der Zerstörung
In Indien begegnete mir das Pendant zu Uwoke, dem Osterinselgott der Zerstörung. Im »Alten Indien« gab es eine Göttin der Vernichtung.
Bevor wir gemeinsam ins südliche Indien reisen, machen wir einen Ausflug nach Erlangen ins schöne Frankenland.
Die kleine Feier sollte die Bewohner zweier Studentenheime einander ein wenig näherbringen. Ob das gelungen ist?
Man hat gemeinsam gespeist, teils leidend-tolerant, teils begeistert lauter Musik aus der Welt des Islam gelauscht. Inzwischen sind die meisten Teilnehmer wieder auf ihre Zimmer verschwunden. Ein kleines Grüppchen diskutiert.
Nasir*, was er studiert weiß keiner so genau, redet sich in Rage: »Ihr Christen seid Ungläubige.«, schimpft er. »Ihr behauptet, dass ihr an einen Gott glaubt, dabei betreibt ihr Götzenverehrung. Ihr glaubt doch an drei Götter.« Mildeherablassend versucht Philipp* zu erklären: »Wir glauben an die Dreifaltigkeit Gottes. An Vater, Sohn und Heiligen Geist.« Nasir* winkt ab. Philipp* zitiert aus dem Glaubensbekenntnis: »Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria.«
Nasir* unterbricht: »Dann war also der Heilige Geist der Vater, Maria die Mutter.« Philipps* Erklärungen, frömmelnd und wenig überzeugend, bringen Nasir* zu Lachen. »Empfangen durch den Heiligen Geist, also hat der Geist Jesus gezeugt und die Mutter war Jungfrau. Und was hatte Gott mit der Sache zu tun?« Philipp* doziert, genervt-herablassend und aufgesetzt milde: »Gottvater, Gott-Sohn und Heiliger Geist.« Wütend stapft Nasir* davon. »Gott ist Einer, er hat keine Mutter und keinen Vater.« Philipp* hastet hinterher: »Natürlich hat Gott keine Mutter. Maria ist die Mutter Jesu.« Es fällt ihm schwer, mit Nasir* Schritt zu halten.
»Aber sagtest du nicht, dass Jesus auch Gott ist? Und Gottvater ist Gott bei euch. Dann ist Jesus sein eigener Vater.
Und der Gottvater ist auch sein eigener Sohn.« Philipp bleibt stehen. »Dem ist nicht zu helfen.«, murmelt er in seinen nicht vorhandenen Bart. Nasir* dachte wohl Ähnliches.
Ich erinnere mich noch gut an das Streitgespräch zwischen Philipp* und Nasir*, in den späten 1970er Jahren in Erlangen. Damals studierte ich noch evangelische Theologie. Wirklich einleuchtend fand ich schon damals die christliche Lehre der Dreifaltigkeit nicht. Was mir damals aber noch nicht klar war: Die vermeintlich im Ursprung »christliche« Lehre der Trinität ist sehr viel älter als das Christentum.
Der Hoyasaleshwara-Tempel lockte mich schon viele Jahre, bis ich eines Tages zu einer Indienreise aufbrach. Im südindischen Bundesstaat Karnataka besuchte ich die einstmals stolze Hauptstadt des Hoysala-Reichs. Doch was ist aus ihr geworden? Im 12. Jahrhundert war Dorasamudra eine mächtige Metropole mit starken Mauern, die aber letztlich nicht als Schutz ausreichten. Heute ist nur ein Dörfchen namens Halebid geblieben. Auf den staubigen Straßen gehen greise Weise mit wallenden Bärten majestätisch und unbeirrt, sausen Fahrräder und Motorräder um die Wette, schlängeln sich altersschwache PKWs geduldig um Menschen, Kühe und Ziegen.
Die meisten Menschen, die man trifft, sind allem Anschein nach entweder zufrieden oder mürrisch. Bei den Mürrischen handelt es sich in der Regel um Touristen, denen deutlich anzusehen ist, dass sie eigentlich nicht schon wieder noch einen Tempel besichtigen wollen. Hat man nicht alle gesehen, wenn man einen gesehen hat? Touristen schimpfen gern, sehen nicht ein, dass sie beim Betreten von Tempeln ihre Schuhe ausziehen sollen und knausern mit Trinkgeld. Vor allem sind ihnen die wortgewaltigen Erklärungen ihrer Guides viel zu detailreich. So viel wollen sie doch gar nicht erfahren. Wichtig ist ihnen, dass die Mahlzeiten pünktlich serviert werden.
Manche Querulanten sind unerträglich und beschweren sich ständig. Ich erlebte eine Reisende, die es als unzumutbar empfand, dass es in Delhi keine »Rote Grütze« als Nachspeise gab. Ein Mitreisender beklagte sich, weil es so schwierig sei in Belur ein richtiges »Wiener Schnitzel« serviert zu bekommen. Bei den Zufriedenen handelt es sich in der Regel um Einheimische, die nach unserem Verständnis bettelarm sind. Sind strahlen eine innere Ruhe aus. Manches Mal beobachtete ich einen »bettelarmen Schlucker«, der voller Mitleid einem abgehetzten, protzigreichen Touristen hinterher lächelte. Und »ärmste« Frauen schritten in natürlicher Schönheit kerzengerade, ja majestätisch. Würdevoll verrichteten sie oft schwere Arbeiten.
Im »Alten Indien« gab es bereits Götter-Triaden. Die Dreifaltigkeit des Christentums hat einen Vorläufer im Hinduismus. Schon Jahrtausende vor der christlichen Zeitwende gab es in Indien, im Hinduismus »Trimurti«: Brahma, Vishnu und Shiva bilden die indische Trinität. Brahma gilt als der Schöpfer, Vishnu als der Erhalter und Shiva als der Zerstörer.
Prof. Kanjilal, aus dem Programmheft der Weltkonferenz der A.A.S. 1979;
Foto: A.A.S.
In der Kunst werden diese drei Gottheiten manchmal als ein Wesen mit einem Leib, mit drei Köpfen und drei Armpaaren dargestellt. »Das kann nur als schwacher Versuch der Abbildung des Nicht-Abbildbaren sein.«, erklärte mir Prof. Dr. Dileep Kumar Kanjilal (*1933). »Das Göttliche Brahman ist das formlose Unveränderliche. Ursprünglich bedeutete Brahman ›Das Wort‹. Es ist der ›Urgrund des Seins‹, keine individuelle Person.«