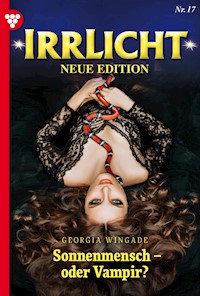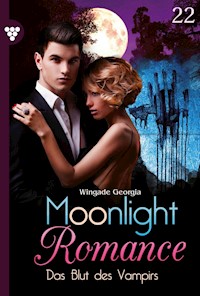Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Moonlight Romance
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Es ist der ganz besondere Liebesroman, der unter die Haut geht. Alles ist zugleich so unheimlich und so romantisch wie nirgendwo sonst. Werwölfe, Geisterladies, Spukschlösser, Hexen, Vampire und andere unfassbare Gestalten und Erscheinungen ziehen uns wie magisch in ihren Bann. Moonlight Romance bietet wohlige Schaudergefühle mit Gänsehauteffekt, geeignet, begeisternd für alle, deren Herz für Spannung, Spuk und Liebe schlägt. Immer wieder stellt sich die bange Frage: Gibt es für diese Phänomene eine natürliche Erklärung? Oder haben wir es wirklich mit Geistern und Gespenstern zu tun? Die Antworten darauf sind von Roman zu Roman unterschiedlich, manchmal auch mehrdeutig. Eben das macht die Lektüre so fantastisch... »Sie sind angestellt im Renaissance-Palazzo am Canal Grande, von diesem Signore Haberstroh?« »Ja, Commissario, seit zwei Monaten verdiene ich dort mein Geld. Gutes Geld, und ich bin es eigentlich auch zufrieden. Wenn nicht...wenn nicht...« »Wenn nicht...was?« fragte der Polizeibeamte. »Was ist geschehen?« Maria Plettista hatte offenkundig Hemmungen zu erzählen, was ihr auf den Nägeln brannte. »Es geschieht Seltsames, was sage ich, Unheimliches in dem Palazzo. Ich habe Angst, mich darin aufzuhalten. Wenn ich daran denke, dann läuft es mir kalt den Rücken hinauf und hinunter. Am liebsten würde ich nicht dort sein! Aber wie kann ich mich nicht dort aufhalten, wenn ich aufräumen und putzen soll? Gibt es eigentlich Gespenster oder Geister oder wie man das sonst noch nennt? Sie müssen mir helfen, Signore!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Moonlight Romance – 9 –
Arsenal des Todes
Was über Jahrhunderte schlummert, wird zur Bedrohung
Georgia Wingade
»Sie sind angestellt im Renaissance-Palazzo am Canal Grande, von diesem Signore Haberstroh?« »Ja, Commissario, seit zwei Monaten verdiene ich dort mein Geld. Gutes Geld, und ich bin es eigentlich auch zufrieden. Wenn nicht...wenn nicht...« »Wenn nicht...was?« fragte der Polizeibeamte. »Was ist geschehen?« Maria Plettista hatte offenkundig Hemmungen zu erzählen, was ihr auf den Nägeln brannte. »Es geschieht Seltsames, was sage ich, Unheimliches in dem Palazzo. Ich habe Angst, mich darin aufzuhalten. Wenn ich daran denke, dann läuft es mir kalt den Rücken hinauf und hinunter. Am liebsten würde ich nicht dort sein! Aber wie kann ich mich nicht dort aufhalten, wenn ich aufräumen und putzen soll? Gibt es eigentlich Gespenster oder Geister oder wie man das sonst noch nennt? Sie müssen mir helfen, Signore!«
Es war an der Zeit.
In den ersten Jahrzehnten hatte sie sich bemüht, den Geliebten zu finden. Hatte sich gesehnt, mit ihm vereint zu sein, seine starken Arme zu spüren. In seine Augen zu blicken und zu wissen: Ich gehöre zu ihm. Oder auch: Wir gehören zusammen. Sie suchte über lange Jahre die Erfüllung, die ihr versagt geblieben war.
Doch dann hatte die Energie nachgelassen, sie hatte die Suche aufgegeben, hatte resigniert. Einige Jahrhunderte lang hatte sie still gehalten, hatte gewartet. Doch dann war etwas geschehen, wovon sie nicht wusste, um was es sich genau handelte. Jedenfalls war sie geweckt worden und mit ihr der Wunsch, ihn zu finden und wieder zu haben: Ihn, Vincenzo, den Großen, den Schönen, den Starken. Ihn, dem sie sich versprochen hatte, und der ihr Leben war. Und den man ihr genommen hatte.
So hatte sie in dem alten Gemäuer wiederum mit der Suche begonnen, hatte auf diese Weise die wenigen Besucher erschreckt, die unverhofft einem Schemen gegenüber standen. Nun aber, da sie im Palazzo nichts gefunden hatte, war es an der Zeit, ihre Suche auszudehnen. Sie konnte, sie durfte nicht nachlassen in ihrem Bemühen, ihn zu finden: ihren Vincenzo!
*
Heute Morgen hatte Antonia Weber so gar keine Lust verspürt, sich selbst ein Frühstück zuzubereiten. Kurz entschlossen hatte sie gegen neun Uhr Notizblock, Fremdenführer und Stift geschnappt und hatte sich in das gegenüber liegende Caffé Campo Santa Margherita begeben. Der Milchkaffee war hier von einzigartiger Qualität und dazu die lauwarmen Croissants vom Bäcker nebenan: Besser konnte kein Frühstück sein.
Seit gut drei Wochen lebte sie hier auf dem Campo Santa Margherita, dem Mittelpunkt des »privaten« Venedig. Hierher verirrten sich kaum einmal Touristen, selbst jetzt, Mitte Mai, waren die Venezianer quasi unter sich. Niemand vermisste den Touristenrummel um San Marco und den Canal Grande, auch wenn viele der hier auf dem Campo Ansässigen gut davon lebten.
Signora Vanessa hatte sie erblickt, kaum dass sie aus der Tür getreten war, und präsentierte ihr nach einem fröhlichen »buon giorno« das übliche Gedeck, wie die Deutsche dies liebte.
Antonia war froh, dass sie ausgerechnet hier auf dem Campo eine Wohnung gefunden hatte, die neben der vorzüglichen Lage abseits der normalen Besichtigungstouren auch den Vorteil hatte, bezahlbar zu sein. Gewiss, seitdem sie mit ihrem ersten Roman »Die Steingräber von Föhr« einen Überraschungserfolg gelandete hatte, und auch der darauf folgende Titel »Schreckensnacht auf Hooge« sich unerwarteter Weise noch besser verkauft hatte, konnte sie über einige Geldmittel verfügen.
Doch ein Aufenthalt in Venedig kostete viel Geld, die Lebenshaltung war aufwendig und das kulturelle Leben lockte. Sie musste in jedem Fall das Geld zusammenhalten, wusste sie doch nicht, wie lange sie ihren Aufenthalt in der Lagunenstadt würde ausdehnen müssen.
Denn die 27-jährige Antonia Weber war zu Recherchen nach Venedig gekommen; Regionalkrimis gab es inzwischen zuhauf, doch Absatzmärkte waren lediglich die deutschsprachigen Länder. Und davon gab es eben nicht so viele. Was sie wollte, war der internationale Erfolg. Und dazu musste ein Roman her, der auch außerhalb Deutschland, auch außerhalb Europas, reüssieren konnte.
»Darf ich?« Signora Vanessa wusste genau, dass sich die zierliche blonde Deutsche immer freute, wenn sie sich für einen Augenblick (oder auch länger) zu ihr setzte, denn sie war eine unerschöpfliche Auskunftei, was die Geschichte und die Bewohner des Campo Santa Margherita und natürlich auch ganz Venedigs betraf.
»Aber, ich bitte Sie! Prego, prego!« Antonia mochte diese immer adrett angezogene, im Wesen etwas burschikose Frau, die mit ihren etwa 45 Jahren top aussah und anscheinend verwitwet oder geschieden war. Antonia fühlte sich noch nicht so vertraut mit ihr, dass sie sich eine diesbezügliche Frage erlaubt hätte.
Signora Vanessa wiederum liebte es, über ihre Heimatstadt zu erzählen, insbesondere über den Stadtteil Dorsoduro, in dem sich der Campo Santa Margherita befand.
»Sind Sie mit Ihren Recherchen weitergekommen?«, fragte sie die Deutsche, von der sie wusste, dass sie einen neuen Roman plante. »Oder haben Sie eine Frage?«
»Fragen habe ich immer, das wissen Sie. Ich möchte eigentlich so viel mehr wissen …Was können Sie mir zum Beispiel über die Kirche sagen, nach der dieser Platz hier seinen Namen erhalten hat?«
»Diese Kirche gibt es eigentlich nicht mehr. Das heißt, das Gebäude ist wohl noch vorhanden, aber als Kirche hat Santa Margherita aufgehört zu existieren. Sie wurde anno 1810 geschlossen, die Gründe dafür kenne ich nicht, aber das Stadtteilarchiv wird da sicherlich Auskunft geben können. Beherrschend ist aber an diesem Gebäude immer noch jener wundervolle Drache, der jedem auffällt, der sich dem Gemäuer nähert. Die heilige Margherita soll ja von einem Drachen verschlungen worden sein, daran erinnert die Darstellung.«
»Warum hat man das Gebäude nicht einfach abgerissen?«
»In Venedig? Das ist ganz und gar unmöglich. Eine Kirche ist ein heiliges Kulturgut, und selbst wenn man die Kirche nicht mehr als Andachtsstätte benutzt, hat man anderswie Verwendung dafür. So war zeitweilig ein Kino darin untergebracht; jetzt dient der frühere Kirchenraum als Hörsaal für unsere Universität, denn die leidet unter Raumnot. Und die Zahl der Studenten wächst stetig. Wir haben aber …«
Aus dem Inneren des Cafés ertönte ein lauter, schriller Schrei, so dass die beiden Frauen, die alleine draußen saßen, zusammenfuhren. Das hörte sich gefährlich an!
»Ich glaube, ich muss … Hoffentlich ist nichts …«. Signora Vanessa war aufgesprungen und hastete ins Innere des Lokals, wo weitere Gäste ihre Frühmahlzeit einnahmen, nun aber neugierig aufschauten. Neugierig folgte ihr Antonia, wenn auch etwas langsamer.
*
Commissario Mario d’Amato hatte sich an diesem Morgen unplanmäßig verspätet. Unterwegs von seiner Wohnung zur Dienststelle hatte ihn Dottore Fermato, ein pensionierter Lehrer seiner alten Schule, angesprochen und sich beklagt, dass immer mehr Restaurants und Imbissstände Tische und Stühle draußen auf Straßen und Gassen platzierten, um das touristische Publikum zum Bleiben zu bewegen. Der Dottore beklagte sich darüber, dass es wohl bald unmöglich würde, sich ungehindert durch die Altstadt zu bewegen, wo die Straßen und Gassen bekanntermaßen sehr eng waren. Er forderte energische Abhilfe durch die Polizei.
Es dauerte einen Augenblick, bis d’Amato dem ehemaligen Lehrer klar machen konnte, dass nicht die Polizei, sondern die Verwaltung der Stadt, genauer: Das Ordnungsamt, zuständig war. Fermato war im Alter etwas schwerhörig geworden und der Commissario musste seine Erläuterungen mehrfach wiederholen, ehe der pensionierte Lehrer alles verstanden hatte.
Nachdem d‘Amato ihm zusätzlich die Adresse der verantwortlichen Behörde auf ein herausgerissenes Blatt seines Notizbuches vermerkt hatte, bedankte er sich ausdrücklich für die Besorgnis dieses alteingesessenen Bürgers um seine Geburtsstadt. Dann endlich hatte er weitereilen können.
Manchmal empfand der Commissario solche Kontaktpflege zur Bevölkerung als lästig, doch das musste unbedingt stattfinden, das wusste der vor 32 Jahren geborene Venezianer sehr genau. Die Polizei als selbstverständlicher Helfer der Menschen auf den Straßen – so lautete die Werbung, mit der man Nachwuchs anlocken wollte. Darauf vertrauten die Leute. Da er unverhältnismäßig groß gewachsen war, im Viertel bekannt als erfolgreicher Polizist, war d’Amato auch in Zivil weithin zu erkennen und wurde dementsprechend oft angesprochen.
Sergente Pedro Spinelli erwartete ihn bereits ungeduldig. Mit seiner Erfahrung aus über dreißig Dienstjahren war er eine rechte Stütze auf dem Revier. Dennoch, manchmal war er regelrecht überfordert. So auch offensichtlich in diesem Fall.
Kaum hatte er d‘Amato durch das Fenster des Dienstraumes auf dem Vorplatz erblickt, eilte er ihm entgegen.
»Commissario, ich habe dringend auf Sie gewartet. Ich komme einfach mit dieser Frau nicht zurecht. Diese Frau – sie ist … Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll …. Sie ist so anders als meine eigene Frau.«
»Aufdringlich, durchgeknallt, verrückt?« bot d’Amato seinem Untergebenen eine Auswahl von Adjektiven an. »Was für eine Frau, von wem reden wir hier eigentlich?«
»Nun, sie ist heute Morgen hier aufgekreuzt; als ich ankam, wartete sie schon, seit einer halben Stunde, sagt sie. Dabei haben wir Dienstbeginn doch erst um Punkt acht Uhr. Was also tut sie eine halbe Stunde vorher bei uns? Und dann hat sie so wirres Zeug erzählt, dass ich es gar nicht glauben konnte …Von einer gewissen Marietta, die Selbstmord begangen hat, und einem Geist, der …. Dabei gibt es doch gar keine Geister. Oder meint sie etwa ein Gespenst?«
D’Amato sah es Spinelli an, dass er reichlich verwirrt war. Der Sergente war ein Mann der Tat und der Wirklichkeit; Geister und Gespenster hatten mit Sicherheit nichts zu suchen in seinem Weltbild.
»Gehen wir hinein«, sagte der Commissario daher. »Überlassen Sie die Frau mir. Ich werde mich darum kümmern, egal, was sie mir erzählen mag.«
Mit seiner pummeligen Figur bot der Sergente ein erheiterndes Bild, als er seinem Vorgesetzten voran in das Kommissariat lief, froh, von einer solchen Aufgabe befreit zu sein. Manches Mal waren eben Vorgesetzte doch zu etwas zu gebrauchen.
Der Commissario erkannte auf den ersten Blick, dass es sich um die Bedienstete eines der begüterten Häuser von Venedig handeln musste, die da zusammengekauert auf ihrem Stuhl saß. Sie gehörte zu jener Bevölkerungsschicht in Venedig, die von auswärts zugezogen war und in der Lagunenstadt nur mühsam ihr Auskommen fand. Er schätzte sie auf Mitte vierzig, dabei berücksichtigend, dass ein schlechtes Leben eine Schätzung des Lebensalters erschwerte. Auf Nachfrage stellte sie sich als Maria Plettista vor. Und fuhr dann fort: »Ich arbeite für Signore Haberstroh, einen reichen Deutschen, der den Palazzo der Familie Dario übernommen hat. Er soll sehr viele Euros dafür bezahlt haben, erzählt man entlang des Kanals.«
Sie machte eine Pause, das Erzählte und mehr noch das zu Erzählende schien sie sehr mitzunehmen, jedenfalls atmete sie schwer. D’Amato kannte den eleganten Renaissance-Palazzo am Canal Grande, oft hatte er ihn von außen bewundert. Lange Zeit war er leer gestanden, denn Immobilien waren in Venedig sehr teuer und die Instandhaltung der Palazzi kostete über die Jahre und Jahrzehnte mehr, als man für ihren Erwerb ausgegeben hatte. Nun schien er also einen neuen Besitzer zu haben, einen wohlhabenden Deutschen, der wirklich sehr begütert sein musste, wollte er sich ein solches Schmuckstück in Venedigs bester Wohn- und Geschäftslage leisten.
»Und Sie sind dort angestellt, von diesem Signore Haberstroh?«
»Ja, Commissario, seit zwei Monaten verdiene ich dort mein Geld. Gutes Geld, und ich bin es eigentlich auch zufrieden. Wenn nicht … wenn nicht …«
»Wenn nicht … was?« fragte der Polizeibeamte. »Was ist geschehen?«
Maria Plettista hatte offenkundig Hemmungen, zu erzählen, was ihr auf den Nägeln brannte.
»Ein kleiner Espresso – könnte ich Ihnen damit eine Freude machen?« fragte der Comissario in der Hoffnung, so die von der kahlen Nüchternheit der Dienststelle eingeschüchterte Frau leichter zum Reden zu verleiten.
»Nein, danke!« sagte diese daraufhin prompt, um sogleich fortzufahren: »Es geschieht Seltsames, was sage ich, Unheimliches in dem Palazzo. Ich habe Angst, mich darin aufzuhalten. Wenn ich daran denke, dann läuft es mir kalt den Rücken hinauf und hinunter. Am liebsten würde ich nicht dort sein! Aber wie kann ich mich nicht dort aufhalten, wenn ich aufräumen und putzen soll? Gibt es eigentlich Gespenster oder Geister oder wie man das sonst noch nennt? Sie müssen mir helfen, Signore!«
Das war eine ungewöhnliche Situation für d’Amato, der ansonsten mit Diebstahl und Überfällen, manchmal auch mit einem Mord zu tun hatte. Unheimliches fiel eigentlich nicht in seinen Aufgabenbereich.
»Seit wann passiert so etwas?« frage er und sein Interesse war nicht einmal vorgetäuscht, denn Geistererscheinungen in einem Palazzo …
Das wären Ermittlungen abseits der ausgetretenen Trampelpfade der normalen Polizeiarbeit, die den 32-jährigen Polizisten irgendwie reizten.
»Das kann ich nicht so genau sagen. Ich bin erst seit kurzem bei Signore Haberstroh, eigentlich erst, seitdem er den Palazzo hat renovieren lassen. Wenigstens zum Teil, denn das oberste Geschoss ist bis jetzt noch in einem jämmerlichen Zustand. Was vorher war, kann ich daher nicht sagen.«
Sie versank in Schweigen, wieder versunken in ihre Ängste und Alpträume – so kam es dem Commissario vor.
»Was ist denn im Einzelnen geschehen?« fragte er, denn nun war es an der Zeit, Konkretes zu erfahren.
»Nun, nehmen Sie zum Beispiel heute Morgen. Sie müssen wissen, ich wohne weit außerhalb, denn die Mieten in der Stadt – wer kann sich die schon leisten? Gestern hatte ich den kleinen Salon aufgeräumt, hatte die Fenster geputzt und die Teppiche gesaugt. Und hatte alles so in die Schränke gestellt, wie Signore Haberstroh das wünschte. Und, was meinen Sie, habe ich heute Morgen, als ich in den Palazzo kam, vorgefunden?«
Sie sah d’Amato erwartungsvoll an, als habe er die Gabe des Hellsehens und könnte vom Kommissariat aus erkennen, was im Palazzo an Ungewöhnlichem zu entdecken war.
D’Amato reagierte darauf mit dem Einzigen was ihm in solchen Situationen einfiel: Er zuckte mit den Achseln und fragte zurück: »Was wohl könnte ich bemerken?«
»Sehen Sie, das ist es: Eine einzige Unordnung habe ich vorgefunden. Dabei bin ich bekannt für meine Ordnungsliebe; ich räume immer alles auf, dorthin, wo es hingehört. Das habe ich von meiner Mutter so gelernt. Und basta!
Doch was musste ich heute Morgen erblicken? Bei einem Schrank stand die untere Tür weit auf, das würde ich nie dulden, wenn ich den Palazzo verlasse. Der Vorhang am linken Fenster war verrutscht, der Teppich lag nicht genau parallel zur Wand, wie dies der Signore Haberstroh wünscht. Und«, sie sah ihn triumphierend an, »eine Vase mit frischen Blumen, die ich zu Mittag auf den Tisch gestellt hatte, war umgefallen.«
Wenn der Commissario etwas Spektakuläreres erwartet hatte, so ließ er sich das doch nicht anmerken. Alle aufgezählten »Störungen«, er wollte es für sich einmal so nennen, waren durchaus rational erklärbar. Vielleicht war jemand zum Schlafen in das bis vor wenigen Monaten leer stehende Gebäude eingedrungen und hatte sich auch im Salon etwas umgesehen? Oder … oder … oder … Es wollten ihm viele Erklärungen für die geschilderte Unordnung einfallen.
Maria Plettista erkannte wohl an seinem Gesichtsausdruck, dass er wenig bis gar nicht überzeugt war. Sie musste noch etwas daraufsetzen, wollte sie Hilfe von ihm bekommen.
»Und außerdem riecht es seit Tagen seltsam in den Räumen, mal mehr, mal weniger, aber immer dann besonders stark, wenn solche seltsamen Dinge geschehen, wie gerade beschrieben.«
Auch das vermochte den Commissario nicht besonders zu beeindrucken und schon gar nicht zu überzeugen, dass eine nachforschungswerte Untat vorlag. Angesichts der Jammergestalt vor sich, die da zusammengekauert auf dem Besucherstuhl saß und offenkundig voller Angst war, fühlte er sich zu der vagen Zusage verpflichtet, er werde sich baldmöglichst um die Angelegenheit kümmern. Er war sich freilich bewusst, dass der allgemeine Dienstbetrieb normalerweise kaum Zeit ließ für solche Bagatellsachen.
Maria Plettista schien mit diesem Versprechen nicht besonders zufrieden zu sein und öffnete schon den Mund, um Einwände vorzubringen, da kam glücklicherweise Sergente Spinelli ins Büro gestürmt.
»Attacke mehrerer Jugendlicher auf eine Touristengruppe nahe San Marco. Die Squadrone antiterroristica ist alarmiert.«
D’Amato sprang erleichtert auf. Er ahnte, dass eine weitere Unterredung mit der verängstigten Frau weder ihn noch sie weitergebracht hätte.
»Tut mir leid«, sagte er anstandshalber. »Aber die Pflicht ruft. Finden Sie alleine hinaus?«