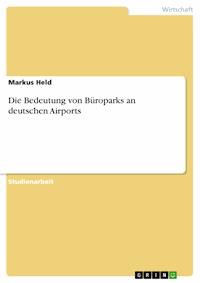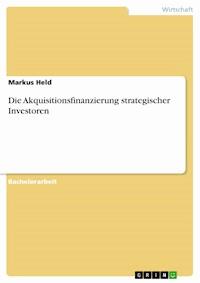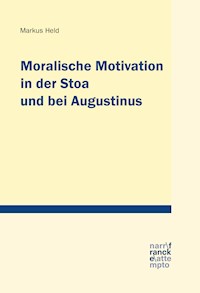
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tübinger Studien zur Theologie und Philosophie
- Sprache: Deutsch
Die Frage, warum man moralisch sein soll, ist eine der ältesten und schwierigsten Fragen der Moraltheorie: Wie kann der Mensch dem moralischen Anspruch, dem er untersteht, gerecht werden? In welchem Verhältnis stehen moralische Urteile und Überzeugungen zu den Wünschen, Neigungen und Gefühlen des Menschen? Welche Rolle kommt der Vernunft in der Handlungsmotivation zu? Welche Bedeutung hat der religiöse Glaube für die menschliche Praxis? In der zeitgenössischen Moraltheologie werden diese grundlegenden Fragen weitgehend vernachlässigt. Die vorliegende Untersuchung leistet einen Beitrag, die Motivationsproblematik wieder ins Zentrum der moraltheologischen Reflexion zu rücken. Ausgehend von einem Überblick über die gegenwärtige philosophische Diskussion um das Problem der moralischen Motivation wird die Motivationstheorie der Stoa rekonstruiert und ihre Rezeption durch Augustinus herausgearbeitet. Dabei erweisen sich die klassischen Motivationstheorien nicht nur als anschlussfähig an die gegenwärtige Diskussion, sondern sie bieten darüber hinaus auch wichtige Impulse für die Beschäftigung mit dem Motivationsproblem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1312
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Stefan Held
Moralische Motivation in der Stoa und bei Augustinus
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2020 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
ISBN978-3-7720-8701-1 (Print)
ISBN978-3-7720-0112-3 (ePub)
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
Inhalt
Vorwort
Die Frage nach der Motivation zu moralischem Handeln ist eines der grundlegendsten und ältesten Probleme der Moraltheorie. Wie kann der Mensch dazu motiviert werden, die Handlung, welche er als sittlich richtig erkannt hat, auch tatsächlich auszuführen? Welche Rolle spielen dabei seine Vernunft, Neigungen, Wünsche und Gefühle? Aus moraltheologischer Perspektive stellt sich auch die Frage, welche Bedeutung der religiöse Glaube für die menschliche Praxis hat. Auf diese Fragen sucht die vorliegende Untersuchung im Gespräch mit der zeitgenössischen analytischen Philosophie sowie unter Rückgriff auf die Motivationstheorie der Stoa und ihrer Rezeption bei Augustinus eine Antwort zu finden und einen Beitrag zum gegenwärtigen moraltheologischen Diskurs zu leisten.
Die vorliegende Studie stellt eine geringfügig überarbeitete Fassung meiner im Sommersemester 2019 von der Katholisch-Theologischen Fakultät Tübingen angenommenen Dissertationsschrift dar. Die Promotion erfolgte am 26. Juli 2019. Die Arbeit entstand mit einem Promotionsstipendium der Bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk sowie während einer mehrjährigen Tätigkeit am Lehrstuhl für Theologische Ethik/Moraltheologie in Tübingen.
Mein Dank gilt vor allem Prof. Dr. Franz-Josef Bormann, der mein Interesse für metaethische Fragen und ihre Relevanz für die Moraltheologie geweckt und die Arbeit geduldig und mit zahlreichen Hinweisen und Anmerkungen begleitet hat. Prof. Dr. Johannes Brachtendorf danke ich für die Erstellung des Zweitgutachtens sowie für seinen hilfreichen Rat insbesondere in Fragen der Augustinus-Interpretation. Beiden möchte ich außerdem für die Aufnahme der Arbeit in die Reihe Tübinger Studien zur Theologie und Philosophie danken. Prof. Dr. John Cooper danke ich für die Einladung an das Philosophy Department der Princeton University, wo seine wertvollen Anregungen meine Forschungen zur stoischen Philosophie wesentlich vorangebracht haben. Der Bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk bin ich für die langjährige Unterstützung und Förderung zu Dank verpflichtet. Die Drucklegung der Arbeit wurde durch Druckkostenzuschüsse der Diözese Rottenburg-Stuttgart, des Erzbistums Freiburg und der Stiftung Landesbank Baden-Württemberg ermöglicht, für die ich mich ebenfalls herzlich bedanken möchte.
Ein besonderer Dank gilt meiner Familie und meinen Freunden, die mich während der Entstehung der Arbeit stets unterstützt haben. Ohne diese Unterstützung wäre diese Arbeit nicht entstanden.
I.Einleitung
Die Frage, warum man moralisch sein soll, ist eine der ältesten Fragen der Moraltheorie. Hinter ihr verbergen sich eine Reihe fundamentaler philosophischer wie theologischer Probleme: Was bedeutet ‚moralisch‘? Welche Lebensbereiche werden vom Begriff der ‚Moral‘ erfasst? Welchen Verpflichtungsgrad haben moralische Forderungen? Wie erfährt der Mensch den sittlichen Anspruch, den moralische Forderungen an ihn stellen? Was bewegt den Menschen dazu, diesem Anspruch gerecht zu werden? In welchem Verhältnis stehen moralische Urteile und Überzeugungen zu den Wünschen, Neigungen und Gefühlen des Menschen? Warum können Menschen in Übereinstimmung mit ihren Überzeugungen handeln? Wie ist es zu erklären, wenn sie dies nicht tun? Welche Rolle spielt die Vernunft bei der Steuerung konkreter Handlungen? Welche Rolle kommt der Kognition, der Imagination und der Erinnerung bei der Handlungsmotivation zu? Und aus moraltheologischer Perspektive nicht zuletzt auch: Welche Bedeutung hat der christliche Glaube für die menschliche Praxis?
Im Folgenden werden nicht alle diese Fragen beantwortet werden können. Der Fokus der vorliegenden Untersuchung soll auf der Motivationsproblematik liegen. Fragen der Semantik des Moralbegriffs sowie seiner Extension werden in der Folge ausgeklammert. Zur Frage des Verpflichtungsgrades moralischer Forderungen sowie zur Erfahrung des sittlichen Anspruchs dieser Forderungen seitens des Menschen werden sich in den Ausführungen über unsere Handlungsgründe einige Bemerkungen finden, die freilich nicht erschöpfend sein können.
Es werden in der vorliegenden Arbeit auch keine substantiellen Fragen der normativen Ethik diskutiert, sondern Fragen der Motivations- und Handlungstheorie sowie der Metaethik, insoweit sie für die Motivationsfrage relevant sind. Die Fragen der Motivationstheorie liegen der substantiellen normativ-ethischen Frage, wie man handeln und leben soll, voraus und beschäftigen sich damit, was in einem handelnden Akteur vor sich geht. Diese Fragen, darauf hat Elizabeth AnscombeAnscombe, G. E. M. aufmerksam gemacht, müssen betrachtet werden, bevor man sich normativen Fragen zuwenden kann.1 So sei eine Erklärung dafür, warum ein ungerechter Mensch ein schlechter Mensch und eine ungerechte Handlung eine schlechte Handlung sei, ohne eine adäquate Philosophie der Psychologie – d.h. Philosophie des Geistes – nicht möglich.2 Um erklären zu können, warum eine ungerechte Handlung eine schlechte Handlung sei, benötige man mindestens „eine Darstellung dessen, was eine menschliche Handlung überhaupt [sei] und wie ihre Beschreibung als ‚das und das tun‘ von ihren Motiven und den mit ihr verbundenen Absichten abhängig [sei]; was wiederum eine Klärung dieser letzteren Begriffe voraussetz[e].“3 Zudem lässt sich die moralische Qualität einer Handlung nicht allein anhand des äußeren Aktes, unabhängig von den Intentionen und Motiven des Akteurs bestimmen. So macht es für die moralische Qualität einer Handlung einen Unterschied, ob jemand ein ertrinkendes Kind aus Menschenliebe rettet oder ob er dies aus Geltungssucht tut, weil er sich etwa erhofft, dadurch ins Fernsehen oder in die Zeitung zu kommen. Aus diesen Gründen braucht es Anscombe zufolge, bevor man in sinnvoller Weise Ethik betreiben kann, eine adäquate Handlungstheorie und Philosophie der Psychologie – zumindest hinsichtlich derjenigen mentalen Kategorien, die für das menschliche Handeln relevant sind: Welche Rolle spielen Lust und Schmerz für unser Handeln? Was ist die Aufgabe der Wahrnehmung dabei? Welche Rolle spielen unsere Wünsche, der Wille und die Vernunft? Wie ist ihr Verhältnis zueinander zu bestimmen? Welche Funktion hat die Intention bzw. Absicht? Welche Rolle kommt der Antizipation und Vorstellung bzw. Imagination zu? Was ist die Aufgabe der Erinnerung? Was die von Wissen? Da sich alle diese Subsysteme darauf auswirken, wie ein Akteur motiviert ist, auf bestimmte Weise zu handeln, ist es die Aufgabe der Ethik, ein genaueres Verständnis der einzelnen Größen sowie ihres Verhältnisses untereinander zu erlangen. Die folgende Untersuchung soll einen Beitrag zu einem solchen tieferen Verständnis der genannten Begriffe leisten.
Auch aus einer dezidiert moraltheologischen Perspektive erscheint eine solche Untersuchung aus einer Reihe von Gründen wichtig. So ist zunächst zu klären, wie die Menschen motiviert werden bzw. motiviert werden können, dem moralischen Anspruch, welchem sie unterstehen, gerecht zu werden. Wenn die Menschen einem moralischen Anspruch unterliegen, müssen sie diesen auch erfüllen können. Es ist daher von zentraler Bedeutung, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie die Menschen den an sie gestellten moralischen Anspruch erfüllen können und welche Motivation sie dabei antreibt. Ist die Motivation des Christen und des nichtgläubigen Menschen dieselbe? Oder ist beim Christen ein spezifisch religiöses Motiv wirksam, welches ihn zur Erfüllung der allgemeinen moralischen Forderungen antreibt? Spätestens mit der Thematik des proprium Christianum in der theologischen Ethik steht man vor der Frage, welche Relevanz der christliche Glaube für die menschliche Praxis besitzt. Wenn sich die moralische Qualität einer Handlung auch an den Intentionen und Motiven des Akteurs bemisst, lassen „sich […] die Sinnorientierung einer Person und der Glaube nicht mehr ausklammern, nämlich die Frage, was jemand vom menschlichen Leben, vom Ziel und von der Berufung des Menschen hält, was für ihn der absolute Wert ist, der sich nicht mehr anderen unterordnet“4, wobei freilich noch der nähere Zusammenhang zwischen den Kategorien der Intention, des Motivs und der Sinnorientierung zu erläutern sein wird. Hans RotterRotter, H. stellt daher zur Bedeutsamkeit der Motivationsfrage für die Ethik fest: „Wenn Moral der Menschlichkeit dienen will, dann muß sie konkret sein und dem Raum der Freiheit des einzelnen Rechnung tragen. Dann muß sie auch wissen um die vielfältigen Motive, die den Menschen bewegen, und um die konkreten Bedingungen, unter denen sich der Vollzug der menschlichen Freiheit ereignet.“5
Für den Moraltheologen stellen sich aus systematischer Perspektive hinsichtlich der Motivationsproblematik folgende Fragen: Wie sind Natur, Glaube, Gnade und sittlich richtiges Handeln zueinander in Beziehung zu setzen? Existieren spezifisch religiöse Handlungsgründe, die für den Christen ein Sonderethos begründen, welches über ein allgemein menschliches Minimum hinausgeht? Wie kann der Christ in diesem Falle zur Erfüllung dieses Sonderethosʼ motiviert werden? Oder bestehen für den Christen dieselben moralischen Pflichten wie für alle anderen Menschen auch, nur dass seine Motivation zur Erfüllung dieser Pflichten eine andere ist? Welche Rolle kommt der göttlichen Gnade für die Handlungsmotivation der Menschen zu und wie ist ihre Wirkweise näherhin zu verstehen?
In der nachkonziliaren Moraltheologie lässt sich eine Tendenz beobachten, diese Fragen als randständig zu betrachten, was ihrem systematischen Gewicht unangemessen ist. Insbesondere mit dem Aufkommen der ‚autonomen Moral‘6 und der dort zu findenden Identifizierung der Moraltheorie mit normativer Ethik wurde die Relevanz des christlichen Glaubens und des Gottesbegriffs zunehmend auf der motivationalen Ebene angesiedelt, ohne jedoch weitere systematische Reflexionen über die dadurch aufgeworfenen Fragen im Kontext der Handlungsmotivation anzustellen. Diese Tendenz zur Verschiebung der Relevanz des christlichen Glaubens auf die Ebene der Handlungsmotivation ist das Ergebnis der Bestrebungen der autonomen Moral, die Rationalität der Normbegründung zu sichern und vor lehramtlichen Zugriffen zu schützen. Nur wenn der Glaube von der Begründungsfrage normativ-ethischer Forderungen ausgeklammert werde, könne man sich, so die Annahme, vor Bevormundungen seitens des kirchlichen Lehramtes schützen. Dies warf freilich die Frage auf, welche Relevanz der Glaube dann überhaupt für das Handeln des gläubigen Christen haben könne. Die naheliegende Antwort bestand dabei darin, seine Bedeutung auf der Motivationsebene anzusiedeln und zu sagen, dass der Christ ein spezifisch religiöses Motiv besitze, welches ihn zur Ausführung der von ihm unabhängig von seinem Glauben als moralisch richtig erkannten Handlungen bewege. Die Begründung und Erkenntnis der sittlichen Richtigkeit einer Handlung unterscheide sich dabei für den Gläubigen nicht von der des Nichtgläubigen. Doch würden beide, so die These der autonomen Moral, jeweils durch unterschiedliche Motive zu ihrer Ausführung veranlasst. An dieser Stelle ist jedoch auf das Heteronomie-Problem hinzuweisen, wenn der Glaube als Motiv für das Handeln des Christen angesehen wird. Führt ein Akteur eine in äußerer Hinsicht moralisch richtige Handlung aus dem Grunde aus, dass er der Überzeugung ist, dass ihm Gott dies befiehlt, und er sich durch die Ausführung eine göttliche Belohnung bzw. das Vermeiden einer Strafe verspricht, dürfte dies kaum als eine moralisch vorbildliche Handlung gelten können, insofern sich moralisches Handeln dadurch auszeichnet, dass das Richtige allein aus dem Grunde getan wird, weil es das Richtige ist.7 Eine Theorie, welche die Relevanz des Glaubens für die moralische Praxis des Menschen auf den Bereich der Motivation verschiebt und annimmt, dass sich die Motivation des Gläubigen grundlegend von der des Nichtgläubigen unterscheidet, wird also unserem Verständnis moralisch richtigen Handelns nicht gerecht und ist dem Vorwurf der Heteronomie ausgesetzt.
Es ist des Weiteren zu fragen, „ob die verbreitete Rede von der primär motivationalen bzw. ‚stimulierenden‘8 Funktion religiöser Überzeugungen der tatsächlichen Relevanz des Glaubens für die Moral hinreichend gerecht wird oder selbst das Ergebnis einer problematischen Verengung der Moraltheorie auf die Normproblematik darstellt.“9 Zu dieser Engführung dürfte insbesondere eine unkritische Orientierung an der Kantischen Ethik beigetragen haben, die mit ihrer Eudämonismuskritik und ihrer Fixierung auf den Normbegriff zur Verdrängung der Frage nach einem glücklichen, gelingenden oder guten Leben und der damit verbundenen Motivationsproblematik aus dem philosophischen Diskurs geführt und dadurch den Weg der Moraltheologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorgezeichnet hat.10 Problematisch an dieser Tendenz ist die Ausklammerung der systematischen Reflexion auf die seit Sokrates und PlatonPlaton11 das philosophische Denken beschäftigende Frage, wie der Mensch zur Ausführung der als sittlich richtig erkannten Handlung – seiner Pflicht – bewegt werden könne. In der eudämonistischen Ethiktradition stand diese Frage aufgrund des konstitutiven Charakters sittlich richtigen Handelns für ein gutes Leben im Zentrum der philosophischen Reflexion. Da die Menschen glücklich sein und ein gutes Leben führen wollen, müssen sie sittlich richtige Handlungen ausführen, die ein konstitutives Element des guten Lebens bilden. Weil die Menschen ein gutes Leben führen wollen – also eine Motivation zu einem solchen Leben besitzen –, werden sie auch motiviert sein, die Handlungen auszuführen, die Teil eines solchen Lebens sind.
Einen solchen von der antiken Ethik inspirierten Versuch der Entfaltung einer Motivationstheorie hat neuerdings Katja VogtVogt, K. M. vorgelegt.12 Sie unterscheidet zwischen einer sog. large-scale motivation, ein gutes Leben zu führen, und sog. mid- und small-scale motivations, bestimmte Projekte zu verfolgen bzw. konkrete Einzelhandlungen auszuführen.13 Die Motivationen niedrigerer Ordnung speisen sich dabei jeweils aus den Motivationen höherer Ordnung und müssen von diesen her verstanden werden. Die large-scale motivation bildet dabei die Motivation höchster Ordnung, aus welcher sich die mid- und small-scale motivations speisen. Die mid- und small-scale motivations, bestimmte Projekte zu verfolgen bzw. gewisse Handlungen auszuführen, werden dabei einerseits von der large-scale motivation durch die mit ihr verbundene Vorstellung eines guten Lebens geleitet, andererseits verleihen sie der für die large-scale motivation zentralen Vorstellung eines guten Lebens ihren Inhalt, insofern sie konstitutive Bestandteile desselben sind.14 Die mid-scale motivations übersetzen die large-scale motivation, ein gutes Leben zu führen, in konkrete handlungsleitende Pläne und verleihen den small-scale motivations und den aus ihnen resultierenden Handlungen Form und Struktur und stellen auf diese Weise einen normativen Rahmen für diese zur Verfügung.15 Die motivationale Kraft der small- und mid-scale motivations hängt dabei von der Kraft der large-scale motivation, ein gutes Leben zu führen, ab. Geht sie verloren – z.B. im Zuge einer depressiven Episode –, kommen auch die mid- und small-scale motivations zum Erliegen.16 Die Motivationen höherer Ordnung prägen und bestimmen also die untergeordneten Motivationen zu konkreten Einzelhandlungen.
Mit der Verdrängung der Frage nach dem guten Leben aus der ethischen Diskussion infolge der Eudämonismuskritik Kants und ihrer Wirkungsgeschichte ist jedoch diese natürliche Verbindung zwischen der Motivation, ein gutes Leben zu führen, und der Motivation, das Richtige zu tun, zerbrochen. Es erschien plötzlich fragwürdig, warum man überhaupt moralisch handeln soll.17 Doch die Fragwürdigkeit bleibt meist unreflektiert, da die Motivationsproblematik an die Peripherie der ethischen Theoriebildung verdrängt wurde. Dies erscheint umso problematischer, da durch die Eudämonismuskritik eine Kluft zwischen das, was der Akteur als seine Pflicht erkannt hat, und das, was er natürlicherweise will und wozu er aufgrund seines Motivationsprofils in psychologischer Hinsicht motiviert werden kann, getreten zu sein scheint. Ob diese Lücke tatsächlich existiert und wie sie gegebenenfalls zu überbrücken ist, wäre eine zentrale Aufgabe ethischer Reflexion, der sich derzeit die Moraltheologie jedoch kaum stellt.
Die generelle Tendenz der Vernachlässigung einer systematischen Reflexion auf das Motivationsproblem in der nachkonziliaren (Moral-)Theologie soll hier exemplarisch an einigen Beispielen veranschaulicht werden. Helmut MerkleinMerklein, H. spricht in seiner Habilitationsschrift Die Gottesherrschaft als Handlungsprinzip18 zwar von einer „handlungsmotivierende[n] Stringenz“19, einer den Menschen zur Handlung provozierenden Funktion20 und einem „zwingende[n] Charakter“21 der Gottesherrschaft und weist ihr die Funktion eines Motivs22 bzw. einer Motivation des Handelns23 und eines „Sinnhorizont[s]“24 zu, doch bleiben diese Beschreibungen vage und erfahren eine weit weniger intensive Diskussion als die auf der Ebene der normativen Ethik der Gottesherrschaft ebenfalls zugeschriebene Funktion der Handlungsorientierung. Die fehlende Analyse und Differenzierung dieser unterschiedlichen Kategorien lassen die Bedeutung der Gottesherrschaft bzw. des christlichen Glaubens für die konkrete Praxis des Menschen diffus und unverbindlich erscheinen. Worin ist der ‚zwingende Charakter‘ der Gottesherrschaft festzumachen? Wie äußert sich ihre ‚handlungsmotivierende Stringenz‘ konkret in der Psychologie des Akteurs? Wie kann die Gottesherrschaft ein ‚Motiv‘ oder eine ‚Motivation‘ für das Handeln des Menschen sein? Wie kann sie Zugriff auf das Motivationsprofil eines Akteurs bekommen? Was genau hat es zu bedeuten, wenn man von der Gottesherrschaft als ‚Sinnhorizont‘ spricht, „auf den hin und von dem her sich das menschliche Handeln zu bestimmen hat“25?
Obschon Wolfgang GöbelGöbel, W. in seiner kritischen Auseinandersetzung mit den Ausführungen Merkleins26 auf die Vagheit und Diffusität dieser Aussagen hinweist27 und eine Ordnung und Systematisierung der verschiedenen Aspekte vornimmt, in welchen MerkleinMerklein, H. die ethische Bedeutung der Gottesherrschaft festmacht, nimmt auch bei ihm die Diskussion der normativen Ebene – d.h. die handlungsorientierende Funktion der Gottesherrschaft – einen weitaus größeren Raum ein. In Bezug auf die motivationale Funktion der Gottesherrschaft stellt er dagegen lapidar fest: „Die Gottesherrschaft, das präsente und kommende Reich Gottes als ein, ja, als das Ausführungsprinzip christlichen Handelns zu verstehen, das macht keine Schwierigkeiten. Daß ihre ergreifende Gegenwart christliches Handeln trägt, daß sie eine Kraft ist, die christlicher Schwäche zu Hilfe kommt und daß ihre verheißungsvolle Zukunft den Mut der Glaubenden befreit, sie als Ziel lockt, provoziert, vielleicht auch fasziniert, […] das versteht man […]. […] Die Gottesherrschaft als Ausführungsprinzip des Handelns, dieser eine Teil der These Merkleins macht also keine Schwierigkeiten.“28 Doch wie hat man sich diese Hilfe genau vorzustellen? Wie wirkt sie sich in psychologischer Hinsicht aus? Wie kann die Gottesherrschaft – d.h. das präsente und kommende Reich Gottes – als ein Zustand der Welt subjektives Ausführungsprinzip für das Handeln eines Akteurs werden? Worin äußert sich die tragende Kraft der Gottesherrschaft für das Handeln des Menschen? Diese Fragen scheinen keineswegs klar zu sein. Auch dürfte sich ihre Beantwortung nicht ohne Weiteres als unproblematisch erweisen. Die Ausblendung dieser Fragen durch Göbel ist umso bedauerlicher, als er selbst die Gottesherrschaft für „das unüberbietbare principium executionis der Moraltheologie“29 sowie „das Proprium christlicher Theorie des Handelns“30 – „ihr Nonplusultra“31 – hält und noch feststellt, dass „Handlungsorientierung und Handlungsvollzug […] seit jeher die großen Probleme der Ethik, der philosophischen wie der theologischen[,] [seien].“32 Dass er nur das erste dieser Grundprobleme ausführlicher diskutiert, ist bedauerlich, jedoch auch bezeichnend für die nachkonziliare Moraltheologie.
Erst in den letzten Jahren rückte die Motivationsfrage im Zuge der philosophischen Rehabilitierung der Lehre vom Glück bzw. guten Leben33 und der Neubelebung der Tugendethik34 sowie der theologischen Rezeption dieser Strömungen wieder stärker ins Zentrum der moraltheologischen Reflexion.35 Entsprechend der wiederentdeckten Relevanz der Motivationsproblematik in der Moraltheologie stellt Franz-Josef BormannBormann, F. J. im Anschluss an William FrankenaFrankena, W. K.36 zurecht fest, „dass wir es […] bei der Frage, warum wir moralisch sein sollen, mit einem Grundproblem der Moraltheorie zu tun haben, das sich kaum handstreichartig lösen lässt, sondern uns in die Tiefen der philosophischen und theologischen Reflexion führt.“37
Es bleibt allerdings zu fragen, ob die in der autonomen Moral vorhandene Tendenz, die Relevanz des christlichen Glaubens auf die Motivationsfrage und möglicherweise einige christliche Sonderpflichten zu beschränken, angemessen ist. Wenn der Glaube, wie Alfons AuerAuer, A. hervorhebt, ein wirklich neues Sein hervorbringt und einen neuen Sinnhorizont eröffnet,38 dann kann die Relevanz des Glaubens nicht auf bestimmte Felder sittlicher Praxis beschränkt bleiben, und es wäre nach der Vollgestalt christlicher Lebensführung sowie der konstitutiven Bedeutung des christlichen Glaubens für das spezifisch christliche Verständnis menschlicher Vollendung zu fragen.39 Es wäre auch zu klären, ob die Handlungsmotivation des Christen in jedem Fall eine andere ist als die des Nicht-Christen oder ob hier weitere Differenzierungen nötig sind – wie etwa die zwischen der Motivation zur Erfüllung elementarer moralischer Pflichten und der Motivation zur Erfüllung spezifischer hochethischer Weisungen.40
BormannBormann, F. J. hat in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, auf der Ebene der elementaren normativen Pflichten dem Gottesbegriff und dem christlichen Glauben weder eine motivationale noch eine epistemologische Funktion zuzuschreiben.41 Ziel dieser Begrenzung ist es u.a., die moralische Reinheit der Motivation zu sichern, so dass der Akteur das Richtige allein aus dem Grund tut, dass es das Richtige ist, wodurch das Heteronomie-Problem vermieden und unserem Verständnis moralisch vorbildlichen Handelns Rechnung getragen wird. Der christliche Glaube ist Bormann zufolge vielmehr ein „Sinngrund – und damit gewissermaßen als ‚motivationale Kraft zweiter Ordnung‘“42 zu verstehen –, welche ihre motivationale Wirkung vor allem in bestimmten Grenzsituationen entfaltet, in denen die Erfüllung der elementaren moralischen Pflichten dem Menschen besonders schwerfällt und die Sinnhaftigkeit der eigenen Praxis in Frage steht, so dass „eine ‚Stellungnahme zur Welt als Ganzer‘ (i.S. des Wittgensteinschen Ethikbegriffs) unausweichlich erscheint.“43 Der eingeschränkten motivationalen und epistemologischen Relevanz des christlichen Glaubens im Bereich der elementaren moralischen Pflichten zum Zweck der Wahrung der Selbstzwecklichkeit der Moral steht bei Bormann das Erkenntnis- und Motivationspotential des christlichen Glaubens im Bereich supererogatorischen Handelns bei der Erfüllung spezifisch christlicher, hochethischer Weisungen gegenüber.44 Dieses zeigt sich für ihn exemplarisch im christlichen Liebesgebot mit seiner spezifischen triangulären Struktur von Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe, welches auf einer ganz bestimmten Verhältnisbestimmung Gottes zur Welt beruhe und sich allein im christlichen Glauben erschließe.45
Wenn die motivationale Relevanz des Glaubens in dieser Weise eingeschränkt wird, steckt sein modifizierendes Potential für die Ethik vielleicht eher in einer selektiven und akzentuierenden Funktion für das Ethos.46 Der christliche Glaube und seine Vorstellung menschlicher Vollendung muss sich dabei als Sinnressource auch in der Mitte des alltäglichen Lebens des Christen auswirken und sein Handeln prägen, indem er ihm einen neuen Handlungsspielraum und neue Freiheiten eröffnet.47 Das Handeln des Christen erhält dabei nicht nur eineeschatologische Signatur, sondern auch traditionelle Grenzziehungen ethnischer oder kultureller Art verlieren ihre Bedeutsamkeit in einer auf die Nachfolge Jesu Christi ausgerichteten Existenz.48 Die Bedeutung des christlichen Sinnhorizonts für das menschliche Handeln wäre in diesem Falle nicht mehr pauschal auf die Motivation zu sittlich richtigem Handeln zu reduzieren.49
Die Motivationsproblematik und die Frage nach der Relevanz des christlichen Glaubens für die menschliche Praxis erweisen sich damit als äußerst vielschichtige Probleme. Die folgende Untersuchung wird daher in drei Schritten vorgehen, um Antworten auf die hier aufgeworfenen Fragen zu finden. In einem ersten Schritt wird die zeitgenössische Debatte zum Problem der moralischen Motivation aufgearbeitet. Ziel dieser Überlegungen ist es u.a. aufzuzeigen, wie die zeitgenössische Moralphilosophie versucht, die oben angesprochene Kluft zwischen dem als sittlich richtig Erkannten und dem, was man als Akteur natürlicherweise will und wozu man in der Folge aufgrund seines Motivationsprofils motiviert werden kann, zu überbrücken. Dabei wird insbesondere die Rolle von Handlungsgründen für unsere Motivation von zentraler Bedeutung sein. Es wird herauszuarbeiten sein, wie die Gründe, welche für die Ausführung einer Handlung sprechen, motivational wirksam werden können und worin diese Gründe eigentlich näherhin bestehen. Denn der Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er sein Handeln durch Gründe selbst bestimmen kann. Dadurch erhält er rationale Kontrolle über sein Handeln.50 Hierfür ist es freilich nötig, dass er nicht nur aus Gründen handelt, sondern diese Gründe auch als Gründe anerkennt. Im Idealfall ist dabei der subjektive Handlungsgrund, aus dem der Akteur handelt, auch zugleich ein objektiver Grund, der für die Ausführung der Handlung spricht, und der Akteur zieht die Gründe, die er für besser hält, den Gründen vor, welche ihm schlechter zu sein scheinen.51
Des Weiteren ist auf den genauen Zusammenhang zwischen unseren moralischen Urteilen und unserer Handlungsmotivation einzugehen sowie das Verhältnis von Vernunft und Wünschen bzw. affektiven und desiderativen Zuständen zu bestimmen. In unserem Alltagsverständnis nehmen wir eine enge Verbindung zwischen unseren Urteilen bzw. Entscheidungen und unserer Motivation an, diesen Urteilen bzw. Entscheidungen entsprechend zu handeln. Wir scheinen somit durch unsere Urteile und Entscheidungen eine Form der Kontrolle über unsere Motivation auszuüben, welche allerdings durch solche Phänomene wie Willensschwäche oder Antriebslosigkeit in Frage gestellt wird. Es wird sich zeigen, dass in der aktuellen Diskussion über das Problem der moralischen Motivation sehr unterschiedliche und sich einander ausschließende Positionen eingenommen werden, welche sich unversöhnlich gegenüberstehen. Ein Grund für diese festgefahrenen Oppositionen in der zeitgenössischen Handlungs- und Motivationstheorie dürfte in ihrer starken Fokussierung auf Handlungsgründe liegen, welche lokal zu begrenzt ist, um eine so grundlegende Problematik wie die Frage der moralischen Motivation zu klären. Dennoch erweist sich das analytische Instrumentarium der gegenwärtigen Diskussion als hilfreich, um das Problem besser zu verstehen und die zentralen Problemlinien zu identifizieren. Es muss jedoch in einem weiteren (moral-)psychologischen Kontext angewendet werden.
In einem zweiten Schritt soll unter Rückgriff auf die stoische Motivations- und Handlungstheorie ein möglicher Ausweg aus der zeitgenössischen Engführung des Motivationsproblems auf den Gründediskurs gesucht werden, wobei das im ersten Teil erarbeitete analytische Instrumentarium zum besseren Verständnis der stoischen Theorie zur Anwendung gebracht wird. Die stoische Theorie bietet sich für diese Aufgabe aus mindestens drei Gründen an: Erstens zeichnet sich die antike und die stoische Handlungs- und Motivationstheorie im Besonderen dadurch aus, dass sie das Motivationsproblem in einem weiteren Kontext der Naturphilosophie und Psychologie situiert und die einzelnen Subsysteme, die einen Beitrag zur Handlungsmotivation leisten – das Strebevermögen, Kognition, Affekte, das Vorstellungsvermögen bzw. Imagination, Erinnerung –, innerhalb der Psychologie eines Akteurs studiert. Diese Erweiterung der Perspektive wird ein neues Licht auf die hier angesprochenen Fragen werfen und neue Lösungsmöglichkeiten für die aufgetretenen Probleme eröffnen. Zweitens bietet die Stoa mit ihren ausführlichen Reflexionen im Bereich der Affektenlehre eine interessante und diskussionswürdige Position zur Verhältnisbestimmung von Vernunft und affektiven bzw. desiderativen Zuständen, welche es mit Blick auf die Motivationsproblematik auch heute noch verdient, studiert zu werden, und die auch in gegenwärtigen Debatten noch ihre Vertreter findet.52 Drittens hat die Stoa eine breite Wirkung auf die abendländische Theologie- und Geistesgeschichte ausgeübt, welche bis heute prägend für unser Denken ist. Das primäre Ziel der Untersuchung besteht in der Rekonstruktion und ausgewogenen Darstellung der stoischen Motivationstheorie. Kritik an bestimmten Positionen und abweichenden Forschungsansichten wird meist in den Anmerkungen ihren Platz haben.
In diesem dritten Teil der Arbeit wird zunächst das Verhältnis von Eudämonismus und Naturphilosophie innerhalb des stoischen Denkens zu bestimmen sein, da sich die Art und Weise, wie diese Verhältnisbestimmung vorgenommen wird, auf die Art der Handlungsgründe auswirkt, welchen der Mensch begegnet. Dabei werden auch im Kontext der Erörterung der stoischen οἰκείωσις-Lehre erste Überlegungen zur stoischen Motivationspsychologie angestellt, welche bei der Untersuchung der jeweiligen Rolle der einzelnen psychologischen Subsysteme für die Handlungsmotivation vertieft werden. In diesem Zusammenhang sollen auch die stoische Affektenlehre und die damit verbundene Verhältnisbestimmung von Vernunft und affektiven bzw. desiderativen Zuständen sowie das Phänomen der Akrasie den ihnen gebührenden Stellenwert erhalten. Im Anschluss an die Rekonstruktion der stoischen Motivationstheorie sollen die daraus gewonnen Erkenntnisse noch einmal in einem Zwischenfazit mit den Ergebnissen der Untersuchung aus Teil II in Verbindung gebracht werden.
Im vierten Teil der Arbeit wird schließlich die Rezeption der stoischen Motivationstheorie durch AugustinusAugustinus von Hippo von Hippo im Zentrum stehen. Hier soll es nicht darum gehen, eine umfassende Bestimmung des Verhältnisses Augustins zur Stoa vorzulegen, sondern lediglich darum, strukturelle Parallelen und Einflüsse des stoischen Denkens auf Augustinus im Bereich der Motivationstheorie aufzuzeigen. Dabei ist es hinreichend einen Gedanken als stoisch zu bezeichnen, wenn er seinen Ursprung in der stoischen Philosophie hat, auch wenn dieser durch neuplatonische Vermittlung auf Augustinus gekommen sein mag. Die neuplatonischen Adaptionen stoischen Gedankenguts durch PlotinPlotin und PorphyriosPorphyrios und ihr Einfluss auf Augustinus sollen daher nicht explizit rekonstruiert werden. Der Fokus liegt auf den strukturellen Parallelen zwischen der stoischen und der augustinischen Motivationstheorie. Der Umgang Augustins mit stoischem Gedankengut und die Verbindung der stoischen Einflüsse mit anderen Elementen seines Denkens ist in der Forschung bislang wenig untersucht, auch wenn in den letzten Jahren ein zunehmendes Interesse an dieser Fragestellung zu beobachten ist.53 Entsprechend dieses neuen Interesses am stoischen Einfluss auf Augustins Denken stellt James WetzelWetzel, J. treffend fest: „Stoic rather than Neoplatonic influence informed his early views of virtue, autonomy, and the good life, and disposed him to think Stoically about ethics throughout his career as a philosopher and theologian.“54 Nicht nur das frühe Denken Augustins stehe demnach unter stoischem Einfluss, sondern dieser bilde eine Konstante – von unterschiedlicher Intensität – in seiner gesamten Denkentwicklung.55 Bei der Untersuchung der Stoa-Rezeption Augustins wird es zunächst darum gehen, die Quellen zu identifizieren, durch welche Augustinus Kenntnis der stoischen Philosophie hatte. Im Anschluss daran wird den stoischen Einflüssen in seiner Verhältnisbestimmung von Eudämonismus und ordo bonorum nachzugehen sein, welche – wie das Verhältnis von Eudämonismus und Naturphilosophie in der Stoa – Auswirkungen auf sein Verständnis von Handlungsgründen hat. Im Kontext dieser Diskussion der Gründeproblematik wird auch auf Augustins Rezeption der stoischen οἰκείωσις-Lehre eingegangen, welche die Überleitung zu seiner Motivationspsychologie bildet. Bei deren Untersuchung wird sich zeigen, dass Augustinus in struktureller Hinsicht stark von der stoischen Theorie beeinflusst war, an dieser jedoch einige bedeutsame Modifikationen und Neuakzentuierungen vorgenommen hat. So gewinnt bei ihm die Affektenlehre und die damit verbundene Gewohnheit spezielle Prominenz, die sich schließlich in seiner Diskussion des Phänomens des zerrissenen Willens ausdrückt. Auch Augustins Gnadenlehre fügt sich passend in die Struktur seiner Handlungspsychologie ein, so dass man hier ein psychologisch fundiertes und differenziertes Modell für die Relevanz des christlichen Glaubens für die menschliche Praxis vorfindet. Damit stellt sich freilich auch die Frage nach der Möglichkeit des sittlich richtigen Handelns für Nicht-Christen. Dieses Problem soll zum Abschluss des vierten Teils der Arbeit diskutiert werden, bevor die Ergebnisse in einem Zwischenfazit noch einmal zusammengeführt und mit den Erkenntnissen der vorhergehenden beiden Teile in Beziehung gesetzt werden.
Den Abschluss der Arbeit bildet ein Blick auf den systematischen Ertrag der vorhergehenden Überlegungen, in dem die Erkenntnisse der Untersuchung noch einmal gebündelt und mit den oben aufgeworfenen Fragen in Verbindung gesetzt werden, wobei die Relevanz des christlichen Glaubens für die menschliche Praxis am Ende nochmals besondere Aufmerksamkeit bekommen soll.
II.Moralische Motivation: Die aktuelle Debatte
II.1Die Frage der moralischen Motivation
Es ist ein alltägliches Phänomen, dass wir das Verhalten und die Haltungen unserer Mitmenschen wie auch unsere eigenen Handlungen und Einstellungen von einem moralischen Standpunkt aus bewerten. So sagen wir: „Es war gut, dass ich die überflüssigen Kleider an Bedürftige gespendet habe.“ „Es ist richtig, das Portemonnaie seinem Besitzer zurückzugeben.“ „Es ist falsch, Tiere zu quälen.“ „Ich war ungerecht.“ „Er ist ein schlechter Mensch.“ „Das hast du gut gemacht.“ „Du hast dich tapfer verhalten.“ „Er ist sehr rücksichtsvoll.“
Wenn wir diese Urteile äußern, gehen wir davon aus, dass sie wahr oder falsch sein können und dass sie deshalb wahr sind, weil es etwas gibt, das sie wahr macht – unabhängig davon, was wir darüber denken oder empfinden. Das Urteil „Es ist richtig, das Portemonnaie seinem Besitzer zurückzugeben.“ ist also genau deswegen wahr, weil der Handlung die Eigenschaft der (sittlichen) Richtigkeit zukommt. Es ist falsch, wenn die Handlung diese Eigenschaft nicht besitzt. Äußern wir also ein moralisches Urteil wie „Es ist richtig, das Portemonnaie seinem Besitzer zurückzugeben.“ oder „Er ist ein schlechter Mensch.“, drücken wir damit unsere Überzeugung darüber aus, welche sittliche Eigenschaft einer Handlung bzw. einer Einstellung zukommt, und wie alle Überzeugungen können auch unsere moralischen Überzeugungen wahr oder falsch sein, je nachdem ob sie den Tatsachen, d.h. der Wirklichkeit entsprechen oder nicht.
Anders aber als unsere sonstigen Überzeugungen können die moralischen Überzeugungen, die in unseren Urteilen zum Ausdruck kommen – so nehmen wir an – auch unmittelbar handlungswirksam werden. Demnach müssen sich moralische Tatsachen, die Gegenstand unserer moralischen Überzeugungen sind, von sonstigen Tatsachen etwa physikalischer Art unterscheiden. Moralische Tatsachen sind praktische Tatsachen, d.h. dass derjenige, der das moralische Urteil fällt, dass es richtig ist, das Portemonnaie seinem Besitzer zurückzugeben, zugleich einen guten Grund für diese Handlungsweise anerkannt hat und auch motiviert sein wird, entsprechend zu handeln, solange zumindest keine konkurrierenden Gesichtspunkte in eine andere Richtung weisen. Es würde uns merkwürdig vorkommen, wenn jemand das Urteil fällt, dass es richtig sei, das Portemonnaie seinem Besitzer zurückzugeben, aber anschließend fragt, welchen Grund er eigentlich habe, das zu tun. Wir würden wohl an der Aufrichtigkeit seines moralischen Urteils zweifeln. Moralische Urteile scheinen uns also Gründe für unser Handeln zu geben, die ceteris paribus mit einer entsprechenden Handlungsmotivation einhergehen.
An dieser Stelle scheint jedoch ein Problem aufzutreten: Wie kann es möglich sein, dass uns unsere Urteile, die ja der Ausdruck unserer Überzeugungen über bestimmte Tatsachen sind, zum Handeln motivieren? Müssten es nicht ganz absonderliche1 Tatsachen sein, auf welche sich Überzeugungen beziehen, die uns zum Handeln motivieren können – Tatsachen von ganz anderer Art als das, was wir sonst kennen? Wie sollen uns Tatsachen, die unabhängig von uns existieren, Handlungsgründe geben und eine Art Magnetismus des Guten ausüben können, der uns zum Handeln motiviert? Es geht also letztlich um die Frage, welche Beziehungen zwischen den moralischen Tatsachen, unseren moralischen Urteilen, unseren Handlungsgründen und unserer Handlungsmotivation bestehen. Den Handlungsgründen wird bei dieser Entschlüsselung der Beziehungen eine entscheidende Rolle zukommen, insofern sie sich nicht nur auf die moralischen Tatsachen beziehen und in unseren moralischen Urteilen erfasst werden, sondern auch für unsere moralische Motivation von entscheidender Bedeutung sind. Daher wird es zunächst nötig sein, die Frage zu klären, was Handlungsgründe sind und welche Arten von Gründen es gibt, bevor wir uns den verschiedenen Beziehungen zuwenden können, die zwischen Gründen, moralischen Tatsachen, moralischen Urteilen und unserer Handlungsmotivation bestehen.
II.2Handlungsgründe
Menschen sind in der Lage, Gründe zu verstehen, auf sie zu antworten und aus ihnen zu handeln. Da allerdings die Gründe, aus denen wir handeln, nicht immer gute Gründe sind und wir auch nicht immer aus den guten Gründen handeln, die wir haben, drängt sich hier eine erste wichtige Unterscheidung auf: Die Unterscheidung zwischen normativen und motivierenden Gründen.1Normative Gründe sind die Gründe, die für eine Handlung sprechen,2 wodurch normative Gründe ipso facto gute Gründe sind. In diesem Zusammenhang ist es wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass es keinen Sinn ergibt, normative Gründe für Ereignisse in der Welt anzuführen, die in keiner Verbindung mit einem intentionalen Subjekt stehen. Man kann zwar durchaus fragen: „Warum ging die Lawine ab?“ Aber dabei wird nach einer Erklärung gefragt, warum die Lawine abging, also nach dem Grund, warum sie abging, nicht aber nach dem Grund der Lawine für ihr Abgehen.3 Unsere Handlungsgründe sind von einer anderen Art. Wenn man fragt: „Warum hast du die Lawine ausgelöst?“, fragt man nach etwas anderem. Man fragt nach einer Rechtfertigung für die Handlung – möglicherweise: „Ich habe die Lawine ausgelöst, um einen unkontrollierten Abgang zu verhindern.“ Motivierende Gründe sind im Gegensatz dazu die Gründe, aus denen jemand tatsächlich handelt; sie müssen nicht notwendigerweise auch gute Gründe sein. So könnte jemand auf die Frage: „Warum hast du die Lawine ausgelöst?“ antworten: „Ich habe die Lawine ausgelöst, um das hässliche Hotel zu zerstören.“ Hier erfährt man den Grund, aus dem jemand die Lawine ausgelöst hat – nämlich „um das hässliche Hotel zu zerstören“ –, doch ist es schwerlich ein guter Grund, der für die Handlung spricht. Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass die beiden Arten von Gründen auseinandertreten können, doch zeichnet sich rationales Handeln, wonach wir als rationale Wesen streben, dadurch aus, dass sie zusammenfallen, d.h. wir handeln aus den Gründen, die für das entsprechende Handeln sprechen.
Aus diesen Differenzierungen folgt also, dass ein Handlungsgrund zwei unterschiedliche Funktionen übernehmen kann: Einen Grund, der für eine Handlung spricht, nennen wir ‚normativen Grund‘; einen Grund, aus dem jemand tatsächlich handelt, nennen wir ‚motivierenden Grund‘. Es wäre allerdings verfehlt aufgrund der unterschiedlichen Rollen – normativ und motivierend –, die Gründe spielen können, auf eine grundsätzliche, ontologische Verschiedenheit der Gründe zu schließen. Ein und derselbe Grund kann je nach Kontext, in dem er vorkommt, ein normativer oder ein motivierender Grund sein – oder auch beide Rollen zugleich ausüben. So kann der Grund, dass man einen unkontrollierten Abgang einer Lawine verhindern will, ein Grund sein, der dafür spricht, eine Lawine auszulösen (normativ), und er kann der Grund sein, aus dem jemand eine Lawine auslöst (motivierend). Diese allgemeinen handlungstheoretischen Überlegungen gelten auch für den speziellen Fall der moralischen Gründe, die im Fokus der weiteren Untersuchung stehen werden. So ist der Grund, dass es richtig ist, das Portemonnaie seinem Besitzer zurückzugeben, ein Grund, der dafür spricht, dem Besitzer das Portemonnaie zurückzugeben (normativ). Er kann aber auch der Grund sein, aus dem ich dem Besitzer das Portemonnaie zurückgebe (motivierend). Wie oben bereits kurz erwähnt, konvergieren die beiden Arten von Gründen im Falle rationalen Handelns, d.h. die Gründe, die für unser Handeln sprechen, sind zugleich auch die Gründe, aus denen wir de facto handeln. Bei der weiteren Analyse des Problems der moralischen Motivation wird es also um die Gründe gehen, die eine normative Kraft besitzen und eine Person tatsächlich zum Handeln motivieren. Die normativen und motivierenden Gründe werden daher im Fokus der folgenden Untersuchung stehen. Betrachten wir also die Kategorien der normativen und motivierenden Gründe näher.
II.3Normative Gründe
Was sind normative Gründe?1 Eine Antwort auf diese Frage ist insofern von großer Bedeutung für das Problem der moralischen Motivation, als Moral eine normative Sphäre ist, welche allen Akteuren Gründe für ihr Handeln gibt, unabhängig von ihren kontingenten Wünschen, Dispositionen und Interessen.2 Es wurde bereits erwähnt, dass normative Gründe für bzw. gegen etwas sprechen, d.h. sie machen etwas richtig oder angemessen und können dadurch dieses Etwas rechtfertigen.3 Im Bereich der Moral lässt sich dieses Etwas als Handlungen und Einstellungen bestimmen, weshalb normative Gründe in der Moral für oder gegen Handlungen und Einstellungen von Menschen sprechen und als normative praktische Gründe bezeichnet werden können. Im Kontext der Moral und des Handelns ist das Kriterium, durch welches beurteilt werden kann, ob normative praktische Gründe für bzw. gegen Handlungen und Einstellungen sprechen, das Wertvolle und Gute bzw. das Gesollte und Richtige.4
Es ist die eigentümliche Funktion normativer praktischer Gründe im Rahmen der Deliberation und Beratschlagung als Überlegungen vorzukommen, über die Handelnde reflektieren, um zu einem Schluss zu kommen, was sie tun bzw. welche Einstellung sie haben sollen. Dabei können Gründe für eine bestimmte Handlung durch Gründe gegen diese Handlung überwogen werden. Einen solchen Grund, der durch andere Gründe überwogen wird, nennen wir einen ‚pro tanto Grund‘. Wird ein solcher pro tanto Grund nicht durch andere Gründe überwogen, nennen wir ihn einen ‚pro toto Grund‘; ein solcher Grund spricht pro toto für bzw. gegen eine Handlung. Normative praktische Gründe im Besonderen geben einer Handlung einen Wert, wodurch sie die Entscheidung und das Handeln einer Person leiten und zugleich eine Basis für die Bewertung der Handlung bilden. Auf diese Weise dienen normative Gründe auch zur Rechtfertigung von Handlungen, da sie diejenigen Handlungen erklären bzw. plausibilisieren, zu denen man nach rationaler Überlegung gelangt ist, d.h. Handlungen zu denen man aufgrund von Gründen für diese Handlungen gelangt ist. Daraus folgt, dass normative Gründe prinzipiell in der Lage sein müssen, eine Erklärung bzw. Plausibilisierung für eine Handlung zu bieten:5 Wenn X ein normativer Grund zu φ-en ist, dann muss es möglich sein, dass Personen aus dem Grund, dass X, φ-en und dass dies, wenn sie das machen, ihre Handlung erklärt. Daraus folgt aber nicht, dass normative Gründe immer eine Handlung erklären. Handelt die Person nicht aus einem normativen Grund, erklärt der normative Grund die Handlung auch nicht. Dennoch ist es prinzipiell möglich, dass er die Handlung erklärt.
Ein weiteres Merkmal normativer praktischer Gründe besteht darin, dass sie präsumtiv hinreichend sind.6 Ein Grund zu φ-en ist dann zu einem bestimmten Zeitpunkt präsumtiv hinreichend, wenn es der Fall ist, dass es zu diesem Zeitpunkt gerechtfertigt ist zu φ-en, wenn kein anderer Grund für oder gegen die Handlung spricht.7 Da normative praktische Gründe, wie oben erwähnt, nur dann existieren, wenn die entsprechende Handlung mit einem Gut in Verbindung steht, wodurch die Handlung einen Wert erhält, wird deutlich, warum normative praktische Gründe präsumtiv hinreichend sind: Ein einziger normativer praktischer Grund reicht aus, um einer Handlung Wert zu verleihen, und ist, solange es keine anderen Gründe gibt, die in eine andere Richtung weisen, hinreichend, um die Handlung zu rechtfertigen.
Als letztes Merkmal normativer Gründe ist noch auf die Universalität von normativen Gründen zu verweisen. Dieser Universalität zufolge besteht ein normativer Grund zu φ-en, sofern er wirklich besteht, für alle Akteure, insofern ihre relevanten Umstände dieselben sind. Immer wenn wir ein Urteil über unsere Gründe fällen, machen wir zugleich auch Annahmen über die Gründe, die für andere bestehen, insofern sie sich in denselben Umständen befinden.8
Bevor nun allerdings mit der weiteren Analyse normativer Gründe fortgefahren werden kann, ist zunächst in einem kurzen Exkurs auf die Vieldeutigkeit der Internalismus/Externalismus-Unterscheidung innerhalb der Metaethik einzugehen, da eine bestimmte Spielart dieser Unterscheidung in der weiteren Analyse normativer Gründe von zentraler Bedeutung sein wird.
Die Unterscheidung von internalistischen und externalistischen Theorien spielt in den zeitgenössischen metaethischen Debatten z.B. über die Struktur praktischer Rationalität oder über den Status normativer Gründe eine wichtige Rolle. In formaler Hinsicht lassen sich die beiden Theorietypen dadurch unterscheiden, dass der Internalismus eine innere Beziehung zwischen zwei Relata annimmt, während der Externalismus eine solche Verbindung bestreitet. Da die Internalismus/Externalismus-Unterscheidung in der aktuellen metaethischen Diskussion auf ganz unterschiedlichen Feldern Anwendung findet, besteht die Gefahr der Verwirrung, wenn die unterschiedlichen Kontexte, in denen die Unterscheidung vorgenommen wird, nicht klar voneinander getrennt werden. In diesem Exkurs soll daher der Versuch unternommen werden, die für diese Arbeit relevanten Formen9 der Unterscheidung deutlich gegeneinander abzugrenzen und terminologisch klar zu unterscheiden. Als Differenzierungskriterium werden dabei die verschiedenen Relata dienen, welche in einer internen bzw. externen Verbindung stehen sollen. Dabei wird auch die Art der internen bzw. externen Beziehung näher betrachtet werden.
Die erste Form der Internalismus/Externalismus-Unterscheidung betrifft die Existenz normativer Gründe.10 Daher soll im Folgenden ein Internalismus in Bezug auf normative Gründe als ‚Theorie interner Gründe‘, ein Externalismus in Bezug auf normative Gründe als ‚Theorie externer Gründe‘ bezeichnet werden.11 Eine Theorie interner Gründe formuliert eine Bedingung für das Bestehen normativer Gründe. Das wesentliche Charakteristikum einer Theorie interner Gründe besteht darin, dass die Wahrheit einer Behauptung über die Existenz eines normativen Grundes an das Vorhandensein eines geeigneten Elements innerhalb des subjektiven Motivationsprofils des Akteurs gebunden wird. Die Fähigkeit einer Überlegung, den Akteur zu motivieren, wird zu einer notwendigen Bedingung dafür, dass die Überlegung ein normativer Grund sein kann:
Theorie interner Gründe: Für einen Akteur besteht nur dann ein normativer Grund zu φ-en, wenn er mit vollem Wissen um alle für sein Handeln relevanten Gesichtspunkte sowie nach Durchlaufen eines rationalen Deliberationsprozesses motiviert wäre zu φ-en.
Ein Vertreter einer Theorie externer Gründe würde die hier angenommene innere Beziehung von normativen Gründen und einer entsprechenden Motivation bestreiten und stattdessen behaupten, dass für einen Akteur auch dann ein normativer Grund zum Handeln bestehe, wenn dieser auf keine Art und Weise zu einem solchen Handeln motiviert werden könne. Die relevanten Relata innerhalb dieser Internalismus/Externalismus-Unterscheidung sind folglich normative Gründe einerseits, eine Motivation andererseits, wobei das Vorhandensein einer Handlungsmotivation zu einer notwendigen Bedingung für die Existenz eines normativen Grundes wird. Diese Form der Internalismus/Externalismus-Unterscheidung wird im folgenden Kapitel näher untersucht.
Eine weitere Form der Internalismus/Externalismus-Unterscheidung betrifft die Beziehung von moralischen Urteilen und einer entsprechenden Motivation.12 Die beiden sich aus der Unterscheidung ergebenden Positionen werden in der Folge als ‚motivationstheoretischer Internalismus bzw. Externalismus‘ bezeichnet.13 Der motivationstheoretische Internalismus geht von der Beobachtung aus, dass unseren moralischen Urteilen eine praktische Dimension innewohnt, insofern sie eine wichtige Rolle bei der Regelung unseres Verhaltens spielen – wir versuchen mit ihnen, das Handeln anderer zu beeinflussen sowie unser eigenes Handeln an ihnen zu orientieren. Der motivationstheoretische Internalismus nimmt nun an, dass unseren moralischen Urteilen eine motivationale Kraft inhäriert, welche für die praktische Dimension der Urteile verantwortlich ist. Dieser Position zufolge besteht eine innere Verbindung zwischen dem moralischen Urteil und einer entsprechenden Handlungsmotivation:
Motivationstheoretischer Internalismus: Wenn ein Akteur urteilt, dass es für ihn moralisch richtig ist zu φ-en, dann ist er notwendigerweise pro tanto motiviert zu φ-en.
Der motivationstheoretische Externalismus bestreitet dies und behauptet, dass die Verbindung nur kontingeneterweise bestehe, die Motivation jedoch aufgrund eines weiteren, dem Urteil externen Elements zuverlässig dem moralischen Urteil folge. Dem motivationstheoretischen Externalismus zufolge ist es also möglich, ein aufrichtiges moralisches Urteil zu fällen, ohne in irgendeiner Art und Weise zu einem entsprechenden Handeln motiviert zu sein. Für den motivationstheoretischen Internalismus ist ein moralisches Urteil ohne eine entsprechende Handlungsmotivation nicht denkbar. Die innere Beziehung zwischen dem moralischen Urteil und der entsprechenden Handlungsmotivation ist für den Internalismus eine notwendige Beziehung, die in jeder möglichen Welt besteht.14 Der Internalismus stellt daher eine begriffliche Wahrheit dar und formuliert eine Bedingung für das Vorliegen eines moralischen Urteils. Fällt jemand ein vermeintliches moralisches Urteil, ohne zu einem entsprechenden Handeln zumindest pro tanto motiviert zu sein, hat er dem Internalismus zufolge nicht wirklich ein moralisches Urteil gefällt, sondern seine Aussage bzw. sein mentaler Zustand des ‚Urteilens‘ erfüllt irgendeine andere Funktion. Für den Externalisten genügt es daher, die bloße Möglichkeit eines aufrichtigen moralischen Urteils ohne eine damit verbundene Handlungsmotivation aufzuweisen, um den motivationstheoretischen Internalismus als falsch zu widerlegen. Diese Form der Internalismus/Externalismus-Unterscheidung wird in Kapitel II.5 genauer betrachtet.
II.3.1Interne und externe Gründe
Manche Philosophen sind der Überzeugung, dass mehr über normative Gründe gesagt werden könne und müsse als lediglich, dass sie „für etwas sprechen“. Vertreter einer Theorie interner Gründe haben eine wunschbasierte Theorie angeboten, um zu erklären, was Gründe sind. Zu beachten ist, dass es bei dieser Theorie nicht um die substantielle Frage geht, welche normativen Gründe es gibt, sondern um die analytische Frage, was normative Gründe sind. Der Theorie interner Gründe zufolge spricht eine Überlegung genau dann für eine Handlung, wenn das Ausführen der Handlung in der richtigen Beziehung zu den Wünschen – in einem weiten Sinne – des Akteurs steht, typischerweise dadurch, dass die Handlung dazu beiträgt, einen dieser Wünsche zu befriedigen. Das wesentliche Charakteristikum von Theorien interner normativer Gründe besteht also darin, dass die Wahrheit einer Behauptung über die Existenz1 eines normativen Grundes an das Vorhandensein eines geeigneten Elements innerhalb des subjektiven Motivationsprofils des Akteurs gebunden wird. Die Fähigkeit einer Überlegung, den Akteur zu motivieren, wird also zu einer notwendigen Bedingung dafür, dass die Überlegung ein normativer Grund sein kann. Diese Bedingung wird als die ‚internalistische Bedingung‘ bezeichnet.2
Da das subjektive Motivationsprofil für die Existenz von Gründen in dieser Theorie von entscheidender Bedeutung ist, ist zunächst zu klären, was darunter zu verstehen ist. Bernard WilliamsWilliams, B. bestimmt das subjektive Motivationsprofil (‚motivational set‘) eines Akteurs als „the set of his desires, evaluations, attitudes, projects, and so on“3. Diese offene Formulierung zeigt, dass uns nicht allein unsere Wünsche Gründe zum Handeln geben, sondern dass das subjektive Motivationsprofil vielmehr alles umfasst, um dessentwillen wir handeln – alles, was wir verfolgen, befördern, schützen und respektieren. Was wir Grund haben zu tun, hängt also wesentlich davon ab, welche Ziele – in einem umfassenden Sinn – wir bereits haben.4 Daraus folgt, dass wir, wenn wir rational in Bezug auf unsere Ziele sind, rational schlechthin sind. Der ‚Gründe-Externalist‘ würde dies bestreiten, da für ihn die normativen Gründe, die wir haben, keineswegs mit den Zielen verbunden sein müssen, die wir de facto besitzen. Dem Externalisten zufolge besteht für einen Akteur auch dann ein normativer Grund, in bestimmter Weise zu handeln, wenn dieser aufgrund seines subjektiven Motivationsprofils in keiner Weise zu der Handlung motiviert werden kann. Wenn er die Dinge so sähe, wie sie sind, würde er die Gründe sehen. So sind moralische Tatsachen für den Externalisten so beschaffen, dass wir durch sie zu entsprechendem Handeln motiviert sein werden, wenn wir sie als das sehen, was sie sind.5
II.3.1.1WilliamsWilliams, B.’ Argument für interne Gründe
Die einflussreichste Formulierung der Theorie interner Gründe findet sich bei Bernard WilliamsWilliams, B.. Er hat sie in seinem bedeutenden Aufsatz Internal and External Reasons aus dem Jahre 1980 erstmals formuliert und 1989 in Internal Reasons and the Obscurity of Blame weiter entfaltet und präzisiert. Williams versucht zu zeigen, dass es keine externen Gründe gibt. Der Standardinterpretation1 seiner Version des Internalismus zufolge besteht für einen Akteur nur dann ein normativer Grund zu φ-en, wenn φ-en auf eine bestimmte Art und Weise mit dem subjektiven Motivationsprofil des Akteurs verbunden ist.2 Williams illustriert diese These durch das Beispiel von Owen Wingrave aus HenryHenry, P. Jamesʼ gleichnamiger Kurzgeschichte, welche auch von Benjamin Britten für die Oper adaptiert wurde. Owen Wingrave ist der Nachkomme einer Familie mit einer großen und traditionsreichen Militärvergangenheit. Seine Familie drängt ihn dazu, ebenfalls eine militärische Laufbahn einzuschlagen, er selbst hat jedoch keine Motivation dazu und alle seine Wünsche weisen in eine andere Richtung. Wenn Owen auch nach umfassender Information über alle für seine Berufswahl relevanten Faktoren und eingehendem praktischem Überlegen auf Basis seiner bestehenden Wünsche nicht dazu motiviert werden könne, eine militärische Laufbahn einzuschlagen, dann besteht für ihn Williams zufolge auch kein normativer Grund, in die Armee einzutreten.3
Die obige These der WilliamsWilliams, B.’schen Theorie interner Gründe, der zufolge für einen Akteur nur dann ein normativer Grund zu φ-en besteht, wenn φ-en auf eine bestimmte Art und Weise mit seinem subjektiven Motivationsprofil verbunden ist, ist noch ein wenig zu unpräzise und wirft die Frage auf: Was bedeutet „in bestimmter Art und Weise“? Für Williams müssen dafür bestimmte Umstände erfüllt sein. Diese Umstände dienen Williams zur Abgrenzung der guten Handlungsgründe von den faktischen Motiven, d.h. zur Vermeidung des Kollabierens seiner Theorie normativer Gründe in eine Theorie motivierender Gründe. Auf diese Weise versucht er, die Normativität zu bewahren, ohne die normativen Gründe so weit von den Motiven des Akteurs zu entfernen, dass sie ihre praktische Kraft verlieren. Wie genau sehen nun nach Williams diese Umstände aus? Der Akteur muss „by a sound deliberative route from the motivations that he has in his actual motivational set – that is, the set of his desires, evaluations, attitudes, projects, and so on”4 zu dem Schluss gelangen können, dass er φ-en soll. Für den Akteur besteht also nur dann ein Grund zu φ-en, wenn er nach einer rationalen Deliberation (‚a sound deliberative route‘) über ein Ziel verfügt, das durch φ-en erreicht werden kann.5 Ausgangspunkt dieses Deliberationsprozesses ist dabei das subjektive Motivationsprofil des Akteurs.
Wie sieht für WilliamsWilliams, B. dieser rationale Deliberationsprozess aus? Zunächst einmal muss der Akteur über alle relevanten Informationen verfügen, d.h. er darf keine falschen Überzeugungen in Bezug auf die Entscheidungssituation haben und muss alle relevanten wahren Überzeugungen besitzen.6 Was die Art und Weise des Deliberationsprozesses angeht, möchte Williams sie möglichst umfassend verstehen: Nicht allein instrumentelle Rationalität spielt dabei eine Rolle, sondern auch die Gewichtung konfligierender Zwecke, die Spezifizierung eines allgemeinen Zwecks sowie die Erschließung neuer Zwecke durch Vorstellungskraft und Ratschläge anderer Personen.7 Um die Existenz externer Gründe zu vermeiden, schließt Williams prudentielle und moralische Gesichtspunkte als Kriterien für den Verlauf des Deliberationsprozesses aus und bestimmt ihn rein formal-prozedural. Eine Überzeugung, die gegen eine moralische Norm verstößt wird demnach nur dann korrigiert, wenn die Orientierung an dieser Norm bereits zum subjektiven Motivationsprofil des Akteurs gehört.8 Hat der Akteur auf der Grundlage seines Motivationsprofils diesen rationalen Deliberationsprozess durchlaufen, schafft er eine Distanz zwischen sich und seiner motivationalen Ausgangslage und damit einen Ort für normative Gründe. Die Möglichkeit für Kritik an seinem Handeln ergibt sich dann, wenn der rationale Deliberationsprozess nicht ganz durchlaufen worden ist, wodurch der Akteur nicht aus den Gründen gehandelt hat, die sich ergeben hätten, wenn er den Prozess bis zum Ende durchlaufen hätte – den normativen Gründen für sein Handeln. Auf diese Weise, glaubt Williams, sowohl die Normativität als auch die praktische Kraft guter Gründe sicherstellen zu können – was ihm freilich, wie gleich deutlich werden wird, nicht gelungen ist.
Williamsʼ Überlegungen liegen nach eigener Aussage im Wesentlichen zwei Motivationen zugrunde.9 Zum einen stützt er sich auf ein Argument, das von der oben angesprochenen internalistischen Bedingung (P1) ausgeht, dass normative Gründe in der Lage sein müssen, eine Person zum Handeln zu motivieren, und folgende Form besitzt:
Wenn der Akteur einen normativen Grund zu φ-en haben soll, dann muss er sich auch zu φ-en motivieren lassen können.
(P2)Der Akteur kann nur durch Bestandteile seines subjektiven Motivationsprofils motiviert werden zu φ-en.
(P3)Externe Gründe bestehen unabhängig vom subjektiven Motivationsprofil des Akteurs.
(K)Es kann keine externen Gründe geben, da sie die in (P1) formulierte internalistische Bedingung nicht erfüllen.
Aus (P2) und (P3) ergibt sich, dass externe Gründe ungeeignet sind, den Akteur zu φ-en zu motivieren. Sie verstoßen daher gegen die in (P1) formulierte internalistische Bedingung und kommen damit als normative Gründe nicht in Frage (K). Alle normativen Gründe sind WilliamsWilliams, B. zufolge demnach interne Gründe.10
Die zweite Motivation, die WilliamsWilliams, B. Überlegungen zugrunde liegt, speist sich aus dem Phänomen der Indifferenz gegenüber einem guten Grund und der Reaktion, mit der Vertreter einer Theorie interner bzw. externer Gründe darauf reagieren. Der Externalist wird dem Indifferenten vorwerfen, irrational zu sein.11 Williams zufolge verzerrt dieser Vorwurf den wahren Fehler und ist ein bloßer ‚Bluff‘12. Der Akteur mag vielleicht unklug, grausam oder selbstsüchtig handeln, nicht jedoch irrational. Der Vorwurf der Irrationalität ließe sich nur dann einlösen, wenn man unabhängig vom subjektiven Motivationsprofil zeigen könnte, dass jeder Mensch einen guten Grund hat, sich prudentiell klug zu verhalten. Dies hält Williams jedoch für unmöglich und folgert daraus, dass es keine externen Gründe geben kann.13
II.3.1.2Kritik an WilliamsWilliams, B.’ Argument für interne Gründe
Verteidiger externer Gründe haben Williamsʼ Argumentation immer wieder angegriffen.1 Die beiden Grundfragen, die Externalisten dabei aufwerfen, sind die folgenden:
Kann jemand in einer Situation, in der er nicht zu φ-en motiviert werden kann, einen Grund haben zu φ-en?
(2)Wenn jemand durch einen Grund motiviert werden kann, der nicht im subjektiven Motivationsprofil verankert bzw. aus ihm ableitbar ist, warum sollte dieser Grund erst in dem Augenblick entstehen, in dem er motivational wirksam wird?
Externalisten beantworten (1) mit Ja und versuchen, in Bezug auf (2) zu zeigen, dass das Bestehen eines normativen Grundes unabhängig von seiner motivationalen Wirksamkeit ist und die Motivation allein von der Einsicht abhängt, dass man einen guten Grund zu φ-en hat – d.h. einen Grund, der unabhängig von dieser Einsicht schon vorher bestanden hat, jedoch nicht erkannt worden ist.
John McDowellMcDowell, J.2 verteidigt mit seinem Argument aus der Konversion die These, dass allein die Einsicht in einen normativen Grund motivational wirksam werden könne, und kritisiert Williamsʼ Argumentation dahingehend, dass WilliamsWilliams, B. annehme, dass sich diese Einsicht einem deliberativen Prozess verdanken müsse. Für McDowell ist diese Einsicht auch ohne einen vorhergehenden Deliberationsprozess möglich. Als Beispiel führt er ein Konversionserlebnis an, in dessen Folge ein Akteur zur richtigen Einsicht in die Gründe gelangt, ohne dass sich diese Einsicht einem Prozess rationaler Deliberation verdanke.3 Die Konversion ermöglicht vielmehr das korrekte praktische Überlegen.4 Durch die Konversion und der mit ihr verbundenen Einsicht in das Bestehen externer Gründe wird McDowell zufolge eine neue Motivation erworben.5 Die neue Motivation wird also allein durch die richtige Einsicht in die Handlungsgründe generiert. Ein Problem dieser Kritik könnte jedoch darin bestehen, dass ein Internalist einwenden mag, dass es sich im Falle eines Konversionserlebnisses um einen Ausnahmefall handle, der unmöglich als paradigmatisch für die Ausarbeitung einer adäquaten Theorie normativer Gründe und praktischer Rationalität allgemein verwendet werden könne.
Über diese Kritik an der Notwendigkeit eines Deliberationsprozesses zur Einsicht in das Bestehen normativer Gründe hinaus weist McDowellMcDowell, J. mit dem Argument aus dem Psychologismus auch auf die im Kontext einer Theorie interner Gründe bestehende Gefahr der psychologistischen Verkürzung des Begriffs eines normativen Grundes hin.6 So komme dem Begriff eines normativen Grundes neben seinem erklärenden Potential notwendig auch eine kritische Dimension zu.7 McDowell wirft die Frage auf, ob WilliamsWilliams, B. die richtige Distanz herstelle zwischen der Grundlage für die Kritik an der Art und Weise, wie die Handlungen einer Person aus ihren psychologischen Zuständen hervorgehen, und der Art und Weise, wie seine psychologische Verfassung zufällig ist. Zwar führe das Einschalten des Deliberationsprozesses zu einer gewissen Distanz zwischen den beiden Aspekten, doch werde der kritische Standard nach wie vor von den Motivationen des Akteurs, wie sie nun einmal sind, festgesetzt. Insofern sei das resultierende Bild der kritischen Dimension des Konzepts praktischer Rationalität psychologistisch.8 Die Sicherung der kritischen Dimension des Konzepts praktischer Rationalität verlange es daher, die bloßen Tatsachen der individuellen psychologischen Verfasstheit des Akteurs zu transzendieren.9 Diese Überlegungen lassen auch den Vorwurf der Irrationalität im Falle von Indifferenz gegenüber einem normativen Grund auf Seiten des Externalisten verständlich werden, den Williams als bloßen ‚Bluff‘10 bezeichnet hatte. Wird ein externer Grund nicht motivational wirksam, zeigt dies für den Externalisten keineswegs, dass überhaupt kein guter Grund besteht, sondern vielmehr, dass die Person, für die es ein guter Grund ist, dem Anspruch des Grundes nicht gerecht wird.11 Williams nimmt nun an, dass der Externalist eine solche Person als irrational bezeichnen müsse, was jedoch ein bloßer ‚Bluff‘ sei und daher gegen die Existenz externer Gründe spreche.12 Williamsʼ Vorwurf des ‚Bluff‘ hängt mit seinem Irrationalitätsbegriff zusammen, so dass zunächst der Irrationalitätsbegriff zu klären ist, bevor man darüber entscheiden kann, ob Williamsʼ Vorwurf des ‚Bluff‘ gerechtfertigt ist.
Für die Klärung des Irrationalitätsbegriffs soll von zwei grundlegenden Irrationalitätsverständnissen ausgegangen werden, um in Abgrenzung von diesen Williamsʼ eigenes Verständnis zu bestimmen. Thomas ScanlonScanlon, T. M. führt einen engen Sinn von Irrationalität in die Diskussion ein, dem zufolge jemand dann irrational ist, wenn er gegenüber Gründen gleichgültig ist, die er selbst jedoch ausdrücklich anerkannt hat.13 Nach diesem Verständnis ist also jemand als irrational zu bezeichnen, der zwar ausdrücklich anerkannt hat, dass er einen Grund hat, das Portemonnaie seinem Besitzer zurückzugeben, und keine anderen Gründe dagegen sprechen, es aber nicht tut und sich weiter daraus bedient. Diesem engen Verständnis steht das weite Irrationalitätsverständnis Derek Parfits gegenüber, der alle Fälle, in denen sich etwas rational kritisieren lässt, als irrational charakterisiert.14 Diesem Verständnis zufolge ist beispielsweise ein Jugendlicher, der abgeschirmt in einem religiös-fundamentalistischen Umfeld aufgewachsen ist, irrational, wenn er eine kritikwürdige kosmologische Meinung vertritt. Es scheint jedoch zumindest problematisch einen solchen Jugendlichen als irrational zu bezeichnen, da er gar nicht die Möglichkeit hatte, die epistemischen Bedingungen für die Bildung einer begründeten Meinung über den Ursprung des Kosmos zu erfüllen.15
Welcher Irrationalitätsbegriff steht nun im Hintergrund der WilliamsWilliams, B.’schen Diskussion? Das weite Irrationalitätsverständnis im Sinne Parfits scheint Williams nicht im Blick zu haben, da der Irrationalitätsvorwurf durch den Externalisten, sollte eine Person einen externen Grund nicht einsehen, nicht erhoben wird, weil sie dafür allgemein rational kritisiert werden kann, sondern weil sie eine Möglichkeit nicht ergreift, die für sie als rationales Wesen besteht.16 Allerdings schreibt Williams dem Externalisten auch nicht den engen Irrationalitätsbegriff im Sinne Scanlons zu. Schließlich hat die uneinsichtige Person nicht geurteilt, dass ein guter externer Grund für sie bestehe. Es wäre jedoch für sie möglich gewesen, ein solches Urteil zu fällen.17 Der Irrationalitätsbegriff, den Williams dem Externalisten zuschreibt, deckt sich also weder mit dem Parfits noch mit dem Scanlons, doch besteht eine größere Nähe zum ScanlonScanlon, T. M.’schen Irrationalitätsbegriff: Bleibt jemand einem externen Grund gegenüber indifferent, so ist er zwar in Bezug auf seine eigenen Urteile über die Gründe, die für ihn bestehen, nicht irrational, in Bezug auf die Möglichkeit, durch rationale Deliberation zur Einsicht in diese Gründe zu kommen, ist er jedoch als irrational zu bezeichnen.18
Weshalb sollte der Externalist jedoch auf dieses Verständnis von Irrationalität festgelegt sein? Nichts zwingt den Externalisten, diesen stärkeren Begriff von Irrationalität zu gebrauchen. Ein Externalist, der von Scanlons Irrationalitätsbegriff ausgeht, wird in dem von WilliamsWilliams, B. geschilderten Fall gar keinen Irrationalitätsvorwurf erheben, so dass ihn Williamsʼ Vorwurf des ‚Bluff‘ gar nicht trifft. Für den Externalisten genügt es, eine Person, die einem externen Grund gegenüber indifferent bleibt, insofern als rational kritisierbar zu betrachten, als sie einen Grund nicht erkennt, der tatsächlich für sie besteht. Der Externalist muss sie nicht als irrational bezeichnen.19 Die bloße Verteidigung externer Gründe ist keineswegs entscheidend für die Frage, ob der Vorwurf der Irrationalität erhoben wird. Sollte ein Externalist den weiten Irrationalitätsbegriff Parfits übernehmen, kann er eine Person, die einen externen Grund, der für sie besteht, nicht erkennt, zu Recht als irrational bezeichnen, wenn auch mit der Gefahr, den Begriff der Irrationalität soweit zu überdehnen, dass wichtige Differenzierungen unkenntlich werden, wie oben bei der Diskussion des ParfitParfit, D.