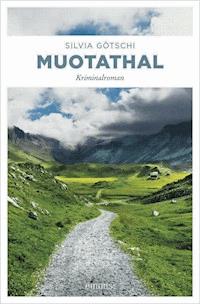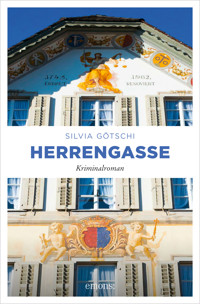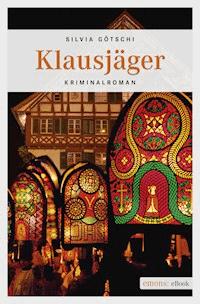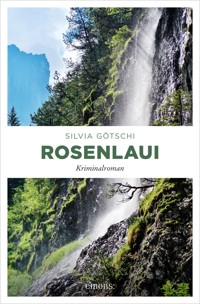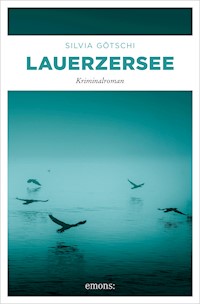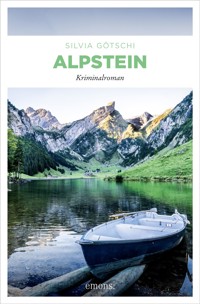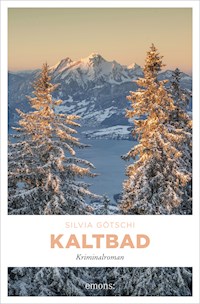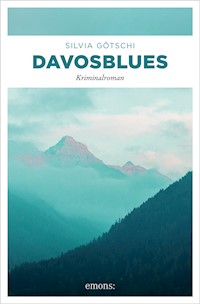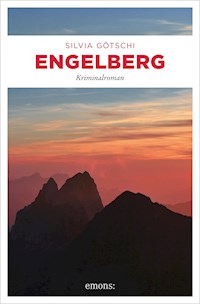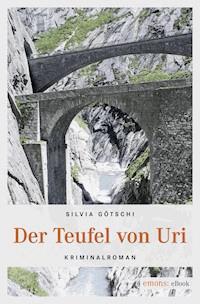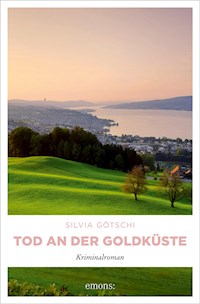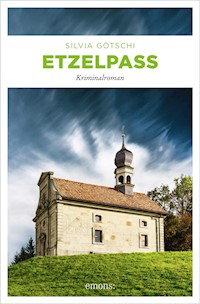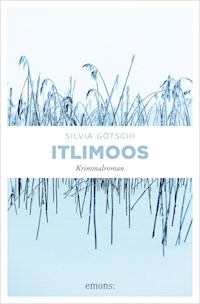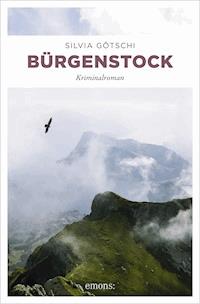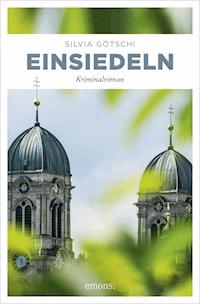Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Speech Studio Schweiz
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein heisser Sommer in Luzern und eine Frauenleiche im Stadtpark. Woher weiss die Reporterin der Luzerner Zeitung über die brisante Neuigkeit? Andy Walker, ein verschrobener Kriminalbeamter, steht vor dem schwierigsten Fall seines Lebens. Kennt er die Tote? Welche Rolle spielt der Frührentner, der auf der Treppe des Hotels Schweizerhof tot zusammengebrochen ist? Und wer ist die geheimnisvolle Fremde auf dem Friedhof? Walkers Ermittlungen gestalten sich schwierig. Geplagt von Gewissensbissen und der Angst, selber in den Kreis der Verdächtigen zu geraten, versucht er verzweifelt gegen die Zeit und die sengende Hitze zu recherchieren. Dabei greift er zu ungewöhnlichen Massnahmen. Seine Recherchen führen ihn nach Vitznau am Vierwaldstättersee...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Götschi, 1958 in Stans geboren, zählt heute zu den erfolgreichsten Krimiautorinnen der Schweiz. Mit „Einsiedeln“ und „Bürgenstock“ landete sie in der ersten Woche nach Erscheinen auf dem ersten Platz der Schweizer Bestsellerliste (Taschenbücher). Sie erhielt je einen GfK No 1 Book Award.
Nach ihrer ersten Veröffentlichung „Am Anfang ist die Sehnsucht“ 1999, erschienen zwei Romane „Und trotzdem nicht Olivia“ und „Sonnensturm“. „Mord im Parkhotel“ war ihr erster Kriminalroman im Verlag Literaturwerkstatt. Im Cameo Verlag erscheint er in überarbeiteter Form und in Neuauflage.
Seit ihrer Jugend zählen Schreiben, Fotografieren und Psychologie zu Götschis Leidenschaften. Nach der Handelsschule und dem Abschluss der Kaufmännischen Berufsschule, arbeitete sie während längerer Zeit in der Hotellerie und Gastronomie. Seit 1998 ist sie freischaffende Schriftstellerin und Mitinhaberin einer Werbeagentur. Götschi hat drei Söhne und zwei Töchter und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Luzern.
www.silvia-goetschi.ch
Silvia Götschi - Mord im Parkhotel
Silvia GötschiMord im ParkhotelKriminalroman
Für Silvan, Melanie, Graziella, Reto und Andrea
– meine Söhne und Töchter
Samstag, 2. August 2003
Der erste Schlag kam so schnell, dass ich ihn kaum spürte.
Rasch schlug meine Überraschung in Wut und Bestürzung um. Eine Irrfahrt aufgewühlter Sinneswahrnehmungen. Das Wechselbad durchlebter Emotionen. Im Empfinden, meine tiefsten Gefühle ihr gegenüber in diesem Moment aufzuspalten. Zu verlieren.
Sie schlug ein zweites Mal zu, was mich mehr schmerzte. Genauso unerwartet, mit einem stumpfen Gegenstand, den ich nicht zu identifizieren vermochte. Warm rann es mir über die Wangen. Bis ich merkte, dass es mein eigenes Blut war, bildete sich vor mir ein roter See, als hätte jemand versehentlich einen Kübel Ölfarbe auf den Teppich gegossen. Dieser Vergleich schien mir allerdings unangebracht im Angesicht des Todes, den zu realisieren ich noch im Hinfallen imstande war. Wieder schlug sie zu. Emotionslos. Eiskalt. Ich war unfähig, mich von der Stelle zu rühren und aus ihrem Blickfeld zu gehen. Ich begriff nicht, wie sie mir das antun konnte. Die Frau, die ich liebte, die ich begehrte. Sie, deretwegen ich meine Persönlichkeit aufzugeben bereit war, deren Abwesenheit mir als irrationaler Entzug in meiner Körperlichkeit erschien. Wurde mir dies erst jetzt bewusst?
Ob sie meine Angst spürte? Ich sah sie durch einen Schleier von Tränen an. Ihre Augen waren leer, ausgehöhlt, der Glanz war verschwunden. Sie hatten etwas Raubtierhaftes an sich. Etwas Bedrohliches.
Wieder schlug sie mich. Ein schreckliches Geräusch, als trennte jemand einen Fetzen Stoff durch. Ein messerscharfes Zischen, das Bersten von Haut. Ich spürte, wie es mir die Schädeldecke aufriss und noch mehr Blut herausströmte.
Brennend, glühend wie der Strom heisser, klebriger Lava ...
Weshalb ich erwachte, wusste ich nicht genau. Von draussen vernahm ich den Schrei einer liebeskranken Katze. Es hörte sich wie das Wimmern eines Kindes an. War es dieser Laut, der mich aufgeweckt hatte? Ich drehte mich auf die andere Seite und versuchte, wieder in die Abgründe zurückzukehren, aus denen ich schweissgebadet aufgewacht war, um die Antwort auf das Erlebte zu finden. Es gelang mir nicht, zu aufgewühlt war ich. Ich hatte schlecht geträumt. Das war alles. Ich träumte selten. Oder zumindest nicht so, dass ich mich am Morgen danach erinnerte. Dennoch sass der Schreck der letzten zwei, drei Minuten an der Oberfläche meines Unterbewusstseins. Vielleicht deshalb diese Unruhe? Mechanisch griff ich in mein Gesicht, fühlte die wuchernden Bartstoppeln. Mein Kopf war unversehrt. Hatte sie mir nicht eines über den Schädel gezogen? Lächerliches Unbehagen.
Ich stand auf, ging auf den Balkon und zündete eine Zigarette an.
Die Stadt schlüpfte aus einem unruhigen Schlaf. Irgendetwas von ihrem schweren, abgasgeschwängerten Körper war immer in Bewegung. Lichtströme von Autoscheinwerfern, die durch ihre Adern pulsierten. Ich lauschte in den frühen Morgen hinein. An die Geräusche um mich hatte ich mich so gewöhnt, dass ich sie kaum noch wahrnahm. An die metallenen Schläge von der Güterabfertigung gegenüber meiner Strasse, wenn Waggons aneinandergekoppelt wurden. An die gurrenden Laute einzelner Tauben auf dem Dach, die sich ins Quartier verirrt hatten. Oder an das Liebesgestöhn aus der Wohnung unter mir. Morgens um sechs. Nichts war mehr fremd, was mich nach diesem Albtraum mit Genugtuung erfüllte.
Langsam verwischte die Dämmerung. Zaghaft überflutete warmes Licht die Hausdächer und Fassaden. Weiter hinten die Schienen des Hauptbahnhofes. Wie riesige Schlangen krochen die Züge aus dem Schoss der Stadt. Vom Pilatus aus ging ein Glanz, der mir fast unwirklich vorkam. Die Felsen flammend rot. Der Ort zu ihren Füssen glitzerte im Licht der aufgehenden Sonne als flüssiges Gold oder von Feuer durchbrochene Kristalle.
Ich warf schnell die Zigarettenkippe über die Balkonbrüstung. Mit dem Tageslicht kam auch der Wind auf. Er stiess schon jetzt seinen heissen Atem aus. Ich blieb noch eine Weile draussen. Beobachtete, wie das Morgenlicht die letzten Geheimnisse der Nacht wegwischte. Ich hörte den Glockenschlag einer Kirche, von der ich nicht wusste, wo sie stand. Von irgendwoher das Martinshorn eines Polizeiwagens. Als das Telefon klingelte, kehrte ich ins Wohnzimmer zurück. Ich nahm den Hörer zur Hand.
»Walker«, brummte ich, weil ich so früh keinen Anruf erwartet hatte.
Korners Stimme: »Wir haben eine Tote vor der Zentralbibliothek.« Es kam selten vor, dass mich der Boss persönlich anrief. »Beeilen Sie sich! Ich brauche Sie.«
»Soll ich gleich in die Zentrale kommen?« Ich wartete, bis Korner etwas hinzufügte. Aber es war, als spräche er gleichzeitig mit mehreren Personen, wobei er mich nicht mehr wahrzunehmen schien. Im Hintergrund hörte ich unbekannte Stimmen. Ein Knacken. Ein Schleifen, als schöbe jemand Stühle über einen Parkettboden. Dann Korner: »Bringen Sie Betschard mit und fahren Sie danach zur Zentralstrasse.«
Ich wollte etwas sagen, doch Korner hatte schon aufgelegt. Das war typisch für ihn. Bevor man merkte, dass er da war, war er schon wieder weg. Er war Chef der Kriminalabteilung bei der Kantonspolizei, ein Kopf, der es auch in der Schweizer Armee bis zum Major geschafft hatte. Ein Mann mit unsagbar schnellem Verstand. Dominant im Auftreten und im Umgang mit seinen Mitarbeitern. Ein hochrangiges Kaliber, dem kaum einer aus unseren Abteilungen das Wasser reichen konnte. Jeder wusste, dass er in der Politik mitmischte, aber parteilos blieb, wie er stets betonte. Trotzdem spürte man einen tendenziellen Hang in jene Richtung, die man in den oberen Gefilden der Luzerner als heisses Eisen proklamierte. Er stehe ausschliesslich dort, wo es sich für einen Polizisten gehöre, sagte er. Es umgab ihn die Aura des entschlossenen Mackers, der es sich vorgenommen hatte, aus der Stadt Luzern ein Pflaster freien Bewegens und Denkens zu schaffen, wenngleich Köpfe rollen sollten. Seine Arbeit hatte schon längst über die Grenzen seiner eigentlichen Tätigkeit gegriffen. Er beschäftigte sich knallhart mit den Medien, weil nach seinem Ermessen Gewalt und Verbrechen gezielt durch diese Zusammenarbeit in den Griff zu bekommen wären. Er diktierte den Redaktoren geradezu, was ihm nicht immer Sympathien einbrachte. Früher oder später würde man den Unterschied von damals zu heute schon bemerken. Es blieb offen, was er damit wirklich meinte.
Unter der Dusche erwachte ich erst richtig. Ich war kein Morgenmensch. Zum Rasieren blieb mir keine Zeit. Ein kurzer Blick in den Spiegel über dem Lavabo stimmte mich auch nicht positiver. Meine Haut war hell, trotz des Sommers. Ich mied die Sonne grundsätzlich. Salomé meinte letzthin, dass mir diese Blässe einen etwas frivolen Ausdruck verleihe und den Betrachter schon der Jahreszeit wegen provoziere. Egal. Immerhin gefielen ihr meine Grösse von 1,78 m, meine blauen Augen und die braunen, kurz geschnittenen Haare – Schweizer Durchschnitt hatte ich mal gelesen.
Ich schritt ins Schlafzimmer, holte meine Hose und ein frisches Hemd aus dem Schrank und zog sie mir über. Vergessen war meine Wut auf Korner, der mein freies Wochenende gestört hatte. Auf dem Weg zum Parkplatz rutschte ich in meine Schuhe. Nicht das erste Mal, dass ich mit akrobatischem Geschick meine Wohnung verlassen musste. Ich bemerkte, dass ich die Zigaretten oben liegen gelassen hatte, was mich ärgerte.
***
Daniel Betschard wohnte am anderen Ende der Brücke. Ich rief ihn auf dem Weg dorthin an. Der Festnetzanschluss wurde nach wiederholtem Klingeln auf sein Mobiltelefon umgeleitet, was Daniel ähnlich sah. Möglichst kompliziert. Er klang verschlafen und nicht sehr erfreut.
»Ich weiss, ich sollte mich beeilen«, knurrte er ins Telefon. »Habe die Nachricht soeben erhalten. Du kannst am üblichen Ort auf mich warten.«
Ich fuhr zum Kino Capitol, wo ich meinen Wagen parkte. Ich stieg aus. Während ich wartete, sah ich mir beim Kinoeingang den Aushang der neuesten Vorstellungen an. Zwei Typen in gestreiften Trainerhosen schlurften an mir vorbei. Sie sahen nicht danach aus, als gingen sie zur Arbeit. Sie warfen mir einen abschätzigen, wenn nicht arroganten Blick zu. Ich kannte diese feindseligen Augen, in denen sich wahrscheinlich meine eigene Feindseligkeit widerspiegelte. Das waren die Momente, in denen ich mir wie ein Fremder im eigenen Land vorkam. Ich ging zurück zum Wagen. Ich sah Daniel über den Zebrastreifen hasten. Sein Hemd hing ihm wie immer aus der Hose. Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen.
Er begrüsste mich schlaftrunken. Aus purem Mitleid öffnete ich ihm die Türe auf der Beifahrerseite. »Bist du überhaupt einsatzfähig?«, fragte ich, um ein Gespräch zu beginnen. Ich sah ihm an, dass er mit dem Reden Mühe hatte. Er blinzelte mich mit seinen grünen Augen an. Sein Gesicht wirkte fahl, sein rotblondes Haar zerzaust.
»Ich nehme an, dass du heute einen klaren Kopf brauchst«, sagte ich. »Hat dir Korner nicht mitgeteilt, worum es geht?«
»Wohin fahren wir denn?«
Eigenartig, dass mir erst heute auffiel, wie nervös Daniel wirkte. »Zum Sempacherpark«, sagte ich. »Zum Vögeligärtli. Man hat eine Tote gefunden. Die erste Leiche in diesem Sommer.«
»Wir hatten erst letzte Woche eine«, entgegnete Daniel lakonisch. Ich sah ihn im Augenwinkel das Hemd zuknöpfen.
»Das war eine männliche«, sagte ich, was Daniel das erste nette Lächeln entlockte.
***
Ich fuhr über die Hirschmattstrasse bis zur Murbacherstrasse. Vor der Zentralbibliothek stellte ich meinen Wagen ab. Ein Polizeiauto und ein Krankenwagen waren schon vor Ort. Das blaue Licht kreiste wie ein Karussell über die Fassaden und Bäume im nahen Umkreis. Der Park war mit rot-weissen Plastikbändern weiträumig abgesperrt. Leute drängelten an die Schranken heran. Die Schaulustigen nahmen ihre Plätze ein – wie Statisten in einem Kriminalfilm. Ich bemerkte über zehn mit Mobiltelefonen bewaffnete Zuschauer. Auch die Presse war da: Daniela Schneider von der Luzerner Zeitung, die mit ihrer Digitalkamera umherwirbelte. Es war eine ehemalige Schulkollegin von mir. Auch heute sah sie aus, als wäre sie gerade von einer Strandparty hierhergekommen. Ihre hochgesteckten Haare mit hellgrünen Strähnen fielen mir auf. Ich überlegte mir, woher sie von der Tat erfahren haben könnte. Ich ging ihr aus dem Weg. Korner war nicht anwesend. Dafür zwei Kollegen der Stadtpolizei. Ich blieb einen Moment stehen, um mich über die aktuelle Lage zu orientieren: Die übliche Hektik fehlte, Ratlosigkeit machte sich bemerkbar.
Später sah ich den Camion des Technischen Dienstes in die Murbacherstrasse einbiegen. Hinter der Frontscheibe erkannte ich Werner Dubach und war beruhigt. Daniel schritt auf ihn zu, verschwand im hinteren Teil, wo sie, er und Werner, bald darauf mit sterilen Anzügen wieder zum Vorschein kamen. Zwei Astronauten gleich oder in weisse Overalls gepackte Comicfiguren. Voll beladen mit Koffer, Kamera und den üblichen Utensilien übergingen sie die erste Schranke. Die Diener des gewaltsamen Todes.
Ich näherte mich den beiden Kollegen der städtischen Polizei und den Sanitätern, die eng beieinanderstanden. Hinter den Flatterbändern verharrte ich, nahe genug, um zu erkennen, was da los war.
Nur auf den ersten Blick sah es aus, als schliefe sie. Der seltsam verdrehte Kopf, das lange Haar, das ihr Gesicht zur Hälfte verdeckte, bezeugte jedoch, dass mit der Frau auf der Parkbank etwas nicht stimmte. Sie sass schräg da, ihr rechter Arm lag über der Lehne. Sie trug ein enges schwarzes Kleid, das ihr weit über die Knie gerutscht war, darunter schwarze Strümpfe; die Halter kamen teilweise zum Vorschein. Ihre Füsse steckten in offenen Schuhen mit hohen Bleistiftabsätzen. Neben ihr auf der Bank lag eine schwarze Lackhandtasche.
»Ein Clochard hat sie heute Morgen so gefunden«, erfuhr ich von einem der anwesenden Polizisten.
»Wo ist er?«, fragte ich.
»Er wartet hinten im Dienstwagen«, sagte der Polizist und drehte seinen Kopf seitlich über die linke Schulter.
»Hat man ihn schon befragt?«
»Nein.«
»Sind sonst noch unmittelbare Zeugen da?«
»Nein, niemand sonst.«
Ich musste mich um seine Antworten bemühen, was mich ärgerte. »Und die Leute hinter der Absperrung?«
»Die sind alle im Nachhinein gekommen.«
Die kamen immer im Nachhinein. Dann lauerten sie wie Aasgeier oder Hyänen, gierig auf den Rest der Beute starrend. Der Blick darauf wurde ihnen jedoch bald verwehrt: Die Techniker montierten eine Schutzwand.
»Sind die schon befragt worden?« Langsam wurde ich ungeduldig.
Der Polizist grinste mich blöd an. Ich schien nicht der Einzige zu sein, der mit dem Einsatz an einem Samstagmorgen Mühe hatte. »Unsere Leute sind dran«, sagte er und entfernte sich von mir, weil man ihn anderswo dringender brauchte.
Ich schaute mich um. In dieser frühen Morgenstunde erschien alles wie einbalsamiert. Die Häuser rund um den Park waren in diffuses Licht getaucht, die Jalousien geschlossen.
»Du solltest mal herüberkommen«, rief mir Daniel winkend zu und verschwand hinter der blickdichten Wand. Ich folgte ihm.
Später, nachdem Daniel mit den ersten Untersuchungen fertig war, trat ich an die Tote heran und betrachtete sie.
Manchmal gibt es einschneidende Momente im Leben, die kommen ohne Vorwarnung aus heiterem Himmel, und sie schlagen wie eine Bombe ein, reissen ein tiefes Loch in die Seele und man weiss, dass man dann nichts mehr rückgängig machen kann; man kann es nicht einmal wegdenken. Als ich in das Gesicht der Frau sah, traf es mich so hart, dass ich glaubte, es ziehe mir den Boden unter meinen Füssen weg. Ich verlor den Halt. Unbegreiflich. Salomé!
Der Name zuckte wie ein Blitz durch mein geistiges Auge, schlug brutal in mein Herz. Ich verdrängte den Gedanken. Sie sah ihr nur ähnlich. So unglaublich ähnlich. Ich würde den Namen der Toten gleich erfahren. Würde im Nachhinein über meine Hysterie lachen. Sonderbar, wenn man plötzlich neben sich selbst steht und sich aus der Perspektive des Aussenstehenden betrachtet. Das passierte mir heute zum ersten Mal. Ich fasste mich schnell wieder und richtete mich auf. Ich spürte, wie mir kalter Schweiss aus den Poren schoss, wie ein flaues Gefühl meinen Magen füllte. Ich versuchte, mich auf eine Bagatelle zu konzentrieren. Auf den Baum über mir, den ich durch die Zeltluke sah. Eine jahrhundertealte Buche, die ihre Äste weit und üppig über den Park breitete. Abwechselnd stieg mir der Geruch von Hundekot und trockenem Laub in die Nase.
»Wurde sie umgebracht?«, fragte ich Daniel. Er trug ein Diktafon bei sich, worauf er seine Feststellungen sprach.
»Siehst du diese Striemen da?« Er schob die Haare etwas zur Seite und zeigte mir zwei nebeneinanderliegende violette Vertiefungen. »Sie wurde stranguliert. Womit, kann ich nicht klar erkennen. Das ist dann Sache der Gerichtsmedizin.«
»Und die Todesursache?« Ich beugte mich über die Tote. Sie sah aus wie Salomé.
»Wahrscheinlich durch Ersticken«, sagte Daniel. »Ich muss jetzt weitermachen. Dazu kann ich dich nicht gebrauchen.«
»Wer hat sie gefunden?« Meine Selbstsicherheit zerrann wie Eis in meiner Hand. Ich griff mechanisch in meine Hemdtasche und erinnerte mich, dass ich die Zigaretten zu Hause liegen gelassen hatte. Jetzt hätte ich sie gebraucht, um mich an irgendetwas festzuhalten.
»Ein Kollege der Stadtpolizei sagte mir, dass sie kurz vor sechs Uhr einen Anruf aus dem Hotel neben der Zentralbibliothek bekommen haben.«
»Von wem?«
»Keine Ahnung. Scheinbar wollte er seinen Namen nicht nennen.«
Ich war erstaunt über das Tempo der Stadtpolizei. Möglicherweise war eine Patrouille in der Nähe oder sie war im Quartier auf Streife gewesen.
»Kann ich jetzt mit meiner Arbeit anfangen?«, rief Werner. Er kam zielstrebig ins Zelt. Seine Kamera hing ihm über den Bauch. Er sah nicht sehr glücklich aus. Einsätze an Wochenenden waren anstrengend und stellten die Betroffenen auch vor Bewährungsproben innerhalb ihrer Familie. Ich hatte einmal gelesen, dass die meisten Geschiedenen unter Polizisten zu finden seien.
Ich musste immerzu auf die schwarze Handtasche starren, auf den Lackbeutel neben der Toten. Ich stellte mich zu Daniel und schaute ihm bei der Arbeit zu. Seine Handgriffe waren Routine, ihn erschütterte kaum mehr etwas – oder er hatte ganz einfach die Gabe, solches wegzustecken. Die Leiche hier war beinahe unversehrt. Daniel hatte sich weiss Gott schon mit anderen Körpern auseinandersetzen müssen, mit fast bis zur Unerkenntlichkeit entstellten Mordopfern, mit zerschlagenen Gesichtern und abgetrennten Extremitäten. Jeder Normalsterbliche hätte in einem solchen Moment seinen Beruf hinterfragt. Daniel aber nahm seinen Job gelassen und überspielte seine Eindrücke gekonnt mit trockenem Humor. »Du kannst jetzt nach draussen gehen!«, befahl Daniel. »Du bist nicht steril genug.«
»Nur noch einen Augenblick. Wolltest du mir nicht noch etwas sagen?«
Hatte er die Handtasche schon gesehen? Mir ging sie nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht würde man etwas darin finden, was nicht jedermann zu Gesicht bekommen sollte. Vor allem nicht meine Kollegen. Ich verabscheute den Gedanken.
Daniel richtete sich auf. Sein Gesicht war rot angelaufen. »Wie kann man eine so schöne Frau kaltblütig umbringen?« Er besass also doch eine Seele.
Ich unterliess es, darauf etwas zu erwidern. Ich hätte auch kaum einen Ton herausgebracht. Die Handtasche beschäftigte mich. Vielleicht hätte ich sie einfach wegnehmen sollen. Daniel hätte es nicht bemerkt. Ich versuchte, ihn abzulenken, während ich mich der Sitzfläche wieder ein Stück näherte. Die Tasche war so klein, dass sie zwischen meinem Hemd und dem Bauch genug Platz hatte. Jetzt war ich plötzlich froh über meine Bier-Physiognomie. Ich war mir bewusst, dass ich mit diesem Griff einen gravierenden Fehler in Bezug auf die kriminaltechnischen Aufgaben machte. Hoffentlich schaute mir Werner nicht zu.
»Du entschuldigst mich«, sagte ich an Daniel gewandt. »Ihr könnt mich rufen, wenn ihr fertig seid. Ich werde mich da hinten mal ein wenig umsehen.« Ich verliess die Abdeckung.
Ich schaute Werner an, der die nähere Umgebung des Fundortes kritisch absuchte und fotografierte. Vielleicht würde er später verdächtige Dinge entdecken, die jetzt an Ort und Stelle nicht zu sehen waren oder ganz einfach nicht wahrgenommen wurden. Und die Tasche? Ich realisierte meine momentane Fahrlässigkeit, ohne genau zu benennen, warum das so war.
Mir schnürte es die Kehle zu. Ich musste hier weg. Ich ging zurück zu meinem Wagen.
Es war schwülheiss. Die Brise aus dem Süden mutete wie ein trockener Atem an, der mir das Atmen erschwerte. Meine Zunge fühlte sich an wie Fliesspapier, worauf kleine Staubpartikel klebten oder Sand aus der Wüste Nordafrikas. Seit Anfang Mai hatte es nicht mehr geregnet. Die Luft hing wie eine Glocke über der Stadt.
Im Wageninneren war es noch unerträglicher. Ich legte die Lackhandtasche der Toten vor mich auf die Knie und betrachtete sie. Ich hatte noch nie eine solche Tasche gesehen. Sie war aus teurem Material gefertigt, es war keine aus diesem billigen Lack, wie man sie in den Warenhäusern kaufen konnte. Ich drehte den Verschluss und kippte den Inhalt auf meine Beine. Zum Vorschein kamen eine kleine Geldbörse, ein Lippenstift, ein farbiges Kondom, zwei verschiedene Wohnungsschlüssel, ein angebrochenes Zigarettenpäckchen und ein vergoldetes Feuerzeug. Ich hätte mir am liebsten eine Zigarette angezündet, konnte aber der Versuchung widerstehen. Im Portemonnaie befanden sich ausser ein paar Münzen dreihundert Franken in Scheinen und eine Kreditkarte. Raubmord war schon einmal auszuschliessen. Es schien eher so, dass der Mörder bewusst wollte, dass man die Tote an Ort und Stelle nach ihrem Namen identifizierte. Ich hatte gedacht, etwas mir Vertrautes zu finden, und fühlte Erleichterung, weil es nicht der Fall war. Ich überprüfte die beiden Schlüssel, deren Nummerierung mir nicht bekannt vorkam. Ich schaute die Kreditkarte näher an. Sie war auf den Namen Catherine Mahler ausgestellt. Das Foto am unteren linken Rand auf der Rückseite der Karte konnte mit der Toten übereinstimmen. Sollte ich aufatmen? Sie hiess Catherine und nicht Salomé. Ich zwang mich, ruhig zu bleiben. Und genau dieser Zwang bewirkte, dass es mir den Boden erneut unter den Füssen wegzog. Das Bild war nicht sehr scharf. Aber es kam mir bekannt vor. Eine dunkelhaarige Frau mit aussergewöhnlichen Augen. Salomés Augen. Irgendwo hatte ich dieses Bild schon einmal gesehen. In einem grösseren Format.
Gestern noch war sie bei mir gewesen. Ihr Name war Sehnsucht. Begehren. Lebenslust. Wir hatten uns regelmässig in meiner Wohnung getroffen. Dann gab es nichts, worüber wir sprachen. Unsere Körper sprachen für sich. Ich erlebte sie jedes Mal wie beim ersten Mal. Ich sah sie vor mir, ihre olivefarbene Haut, diese zarten, feinen Läppchen, die sie hemmungslos vor meinen Augen aufblätterte.
Ich ertappte mich dabei, wie ich lange und nachdenklich auf das kleine Bild auf der Kreditkarte starrte. Das hier war nicht Salomé. Nicht meine Salomé. Ich wollte nicht, dass sie es war. Da glaubte ich, eine Frau zu kennen, ihren Körper, ihre verborgensten Winkel. Und auf einmal erschien sie mir wie ein fremdes Wesen. Eine seltsame Leere breitete sich in mir aus. Ich hatte nicht einmal den Familiennamen von ihr. Das war so nebensächlich gewesen. Sie arbeite im Kantonsspital, hatte sie mir gesagt. Insgeheim hatte mich ihr Beruf beruhigt, und ich nahm ihre Schichtarbeit genauso in Kauf wie sie meine.
Ich stieg wieder aus. Die Tasche liess ich im Wagen liegen, mir keiner Konsequenz bewusst. Ich ging zurück in den Park. Daniela Schneider war verschwunden. Alle anderen mir bekannten Gesichter waren noch da. Und eine Menschentraube, die sich ständig vergrösserte: neugieriges Volk, das sich am Leid ergötzte, erregt darauf wartend, dass sie die Tote sehen würden.
In der Zwischenzeit war auch Conradin Caflisch, der Chef des Ermittlungsdienstes eingetroffen. Ich sah, dass er sich mit Daniel unterhielt. Ich ging zu ihm und grüsste ihn knapp. Nach mehr war mir nicht zumute. Conradin war mein unmittelbarer Vorgesetzter, gross, schlank und agil, der es mich immer wieder unverblümt wissen liess, dass er in der Leiter der Hierarchie eine Sprosse höher stand als ich. Er war bündnerischen Ursprungs, schnauzbärtig und dunkelhaarig, ein etwas sturer Mensch, der fast zur gleichen Zeit wie ich zur Kapo gekommen war. Die einengenden Berge im Prättigau hatten seinen Charakter geprägt; die Weitsicht fehlte ihm. Trotzdem schätzte man ihn in der Abteilung, weil er wie niemand sonst mit einer unerschütterlichen Vehemenz an eine Sache herangehen konnte.
»Hast du schon Zeugen befragen können?« Conradin bugsierte mich zur Seite.
Plötzlich erinnerte ich mich an den Clochard, der sicher immer noch im Dienstauto der Stadtpolizei wartete, falls ihn nicht schon jemand anderer befragt hatte. »Ich werde mit der ersten Zeugenbefragung anfangen«, wich ich aus.
Conradin schaute auf seine Armbanduhr. »Ich möchte, dass du dir danach den Empfangschef des Hotels da drüben mal unter die Lupe nimmst. Er hat die Stadtpolizei benachrichtigt. Ich kümmere mich um den Rest.«
»Wann werden wir uns wiedersehen?«
»Wenn hier alles erledigt ist«, antwortete Conradin. »Spätestens um elf in Hellers Büro. Bis dahin wissen wir vielleicht mehr.«
Später traf der Leichenbestattungsdienst ein, um die Tote in die Gerichtsmedizin nach Zürich zu bringen.
Den Polizeiwagen fand ich auf dem Parkplatz neben der Bibliothek. Im Wageninneren sass ein Mann in abgewetzten Hosen und mit nacktem Oberkörper. Ich setzte mich zu ihm. »Haben Sie die Frau gefunden?«
Der Mann reagierte zuerst nicht. Er starrte wie gebannt auf seine Hände. Helle, feingliedrige Hände. Die Hände eines Akademikers, durchfuhr es mich. »Sie müssen mir ein paar Fragen beantworten«, sagte ich.
Der Mann erschrak. Sein Blick war feindselig. »Ja, ich habe sie gefunden«, antwortete er mit Verzögerung. Ein saurer Geruch von abgestandenem Alkohol ging von ihm aus.
Ich lehnte mich zurück. »Und etwas anderes haben Sie nicht bemerkt oder gehört? Ein Auto oder Personen?«
»Ich habe da hinten geschlafen«, sagte er, »... tief geschlafen«, ergänzte er und machte eine ausschweifende Körperbewegung gegen die Fensterscheibe.
Das nahm ich an, weil er mit Sicherheit betrunken gewesen war.
Ich reichte ihm einen Schreibblock. »Notieren Sie Ihren Namen und Ihre genaue Anschrift«, sagte ich und wusste im gleichen Moment, dass er dies wahrscheinlich nur zur Hälfte erledigen würde. Ich sah ihm zu, wie er mit zittrigen Buchstaben seinen Namen auf das Papier kritzelte »Max Sommerhalder«, lächelte der Clochard verzerrt. »Wollen Sie die Sommer- oder die Winteradresse wissen?«
Ich nahm ihm den Block aus der Hand. »Das reicht fürs Erste.« Seine Schrift wäre ein spannendes Austüfteln für die Grafologen gewesen. »Vielleicht sollten Sie zuerst ausnüchtern«, schlug ich vor.
In Sommerhalders Augen trat ein Leuchten. »Sie halten mich wohl für einen Vollidioten.« Er lächelte, während er dies sagte. »Ich sehe zwar aus, als hätte ich von den Dingen des Lebens keine Ahnung, aber immerhin habe ich einmal studiert. Lassen Sie sich von meiner Schnapsfahne nicht irreführen. Aber mit irgendetwas muss man sich schliesslich sein Leben versüssen.«
Doch ein verhinderter Akademiker. Ich ging nicht weiter darauf ein. »Wem haben Sie den Fund gemeldet?«, fragte ich und erhielt nur ein unverständliches Kopfschütteln.
»Ich mag mich nicht erinnern.«
Sein Kurzzeitgedächtnis schien ein paar Sprünge zu haben und gab meinem Gefühl, dass er nicht mehr auf seinem geistigen Hoch war, recht. Oder machte er das absichtlich? Wusste er am Ende mehr, als er zugab? »Melden Sie sich am Montag um neun Uhr bei der zuständigen Instanz«, wiederholte ich. Ich reichte ihm meine Karte. Meine Unterhaltung mit ihm war somit beendet. Meine Energie am Nullpunkt angelangt, und es schien, als hätte ich noch einen langen Tag vor mir. »Sie können wieder gehen«, sagte ich und stieg aus dem Wagen.
Noch im Davongehen hörte ich den Clochard von seiner unfeinsten Art. Er schoss mir eine Salve Flüche hinterher, die an Obszönem nichts unterliessen. Ich verstand ihn.
***
An der Ecke, wo sich Sempacher- und Murbacherstrasse kreuzten, befand sich ein Hotel mit einem Restaurant im Keller, in das man von der Strasse aus durch eine schräg gestellte Fensterfront sehen konnte. Ich war in The Hotel noch nie eingekehrt. Aber mein Kollege Werner war dort einmal eingeladen gewesen. Wie nicht anders zu erwarten, hatte er sich damit mir gegenüber gebrüstet.
Schon in der Empfangshalle witterte ich den Geruch von Putzmittel. Es roch steril. Genauso kam mir der Mann hinter der Rezeption vor. Er grinste mir künstlich entgegen. Er tat so, als hätte er von der Hektik draussen nichts bemerkt. »Guten Morgen, was kann ich für Sie tun?« Ein professionelles Lächeln. Einstudierte Gestik. Auf eine bestimmte Gattung Gäste mochte das positiv wirken. Mich provozierte es. Er hatte keine Ahnung von der harten Realität des Lebens. Es fand ausserhalb des Hotels statt. Hier drinnen herrschte Bühnenromantik, und der Mann hinter dem Tresen wirkte so, als wäre er derjenige, dem die wichtigste Rolle seiner Karriere zugefallen war. Er war mittelgross, blond, selbstsicher und roch penetrant nach Rasierwasser, was ich bei meinem Nähertreten bemerkte. Es übertraf alles. War er derjenige, der die Tote gemeldet hatte? Ich räusperte mich. »Wann haben Sie Ihren Dienst angetreten?«
»Wie bitte?« Jetzt war er verdattert und das gefiel mir. Schnell fiel er ins Klischee zurück. »Was meinen Sie damit?«
Ich rückte meinen Ausweis heraus und hielt ihn nahe an seine Augen. »Sie haben mich schon richtig verstanden.«
Er machte einen Schritt zurück. »Ich kann nicht hellsehen«, sagte er in gebrochenem Deutsch und setzte wieder dieses kitschige Lächeln auf. Ich spürte instinktiv, dass er nicht gewillt war, mehr von sich preiszugeben. Ohne auf seine Bemerkung einzugehen, was mir allerdings schwerfiel, wiederholte ich meine Frage.
»Ich beginne meine Arbeit um sechs«, antwortete er.
»Haben Sie die Polizei benachrichtigt?«
Er schwieg eisern, was ich nicht verstand.
»Ich kann Sie vorladen, wenn Ihnen das lieber ist«, sagte ich lauter.
Das missfiel ihm offensichtlich. »Okay, ich habe die Stadtpolizei angerufen. Der Zigeuner aus dem Park hatte wohl keine andere Wahl, als mich um Hilfe zu bitten. Ist das ein Verbrechen?«
»Nein, aber Ignoranz.«
»Ich habe nicht gewusst, wie wichtig es für Sie sein würde.«
»Wollen Sie mich zum Narren halten?«
»Sie müssen wissen, dass das hier ein renommiertes Hotel ist und die Gäste ...«
Ich liess ihn nicht aussprechen. »Zum Teufel. Da drüben ist eine Frau tot aufgefunden worden. Und Sie machen sich Sorgen um Ihre Gäste?«
»Ich tue meinen Job wie Sie auch«, kam es barsch zurück.
Mir genügte es, noch bevor ich richtig angefangen hatte. »Gibt es noch andere Mitarbeiter, die vor sechs ins Haus kommen?«, fragte ich.
»Nein, niemand sonst. Die anderen fangen erst nach sechs an.« Seine Stimme hatte sich wieder normalisiert.
»Gut, am Montagmorgen um zehn haben Sie Zeit, sich in unserem Büro eingehend mit dem Thema zu beschäftigen.«
»Aber dann muss ich arbeiten.«
Wir blickten uns an, als wären wir Bluthunde, die einander nächstens an die Kehle springen wollten. Ich hatte den Mann vom ersten Augenblick an verachtet, als er mir seine Gleichgültigkeit demonstrierte. Ich wandte mich von ihm ab und ging. Unter der Türe drehte ich mich noch einmal nach ihm um. »Wie heissen Sie eigentlich?«
Er hüstelte: »Dante Ripiosi.«
Ich nahm meinen Notizblock zur Hand, um den Namen zu notieren, weil ich ihn wohl kaum behalten konnte.
»Ich bin gebürtiger Sizilianer«, rief er mir nach. Beim ersten Moment klang es so, als wollte er mich mit seiner Herkunft warnen. Ich verwarf den Gedanken. Er hatte mir schlichtweg eine Erklärung seines kuriosen Namens geben wollen. Vielleicht würde ich ihn doch nicht vergessen.
Zurück in meinem Wagen, stellte ich die Nummer von Salomés Mobiltelefon ein, bekam aber ausser der Dienststimme des Betreibers nichts zu hören. Ich wusste nicht, ob ich beruhigt aufatmen oder mir Gedanken machen sollte. Ich verspürte plötzlich ein starkes Bedürfnis, Salomé in die Arme zu nehmen.
***
Später fuhr ich zur Kasimir-Pfyfferstrasse, zur Einsatzzentrale. Der Verkehr hatte zugenommen. Die Stadt war so abrupt erwacht wie jeden Tag. Nicht einmal während der Wochenenden schien Ruhe einzukehren. Die Autokolonnen wälzten sich doppelspurig zwischen den Häusern durch. Fahrradfahrer schlängelten sich todesmutig um die Wagen herum, schlossen die Lücken, die von den Linienbussen entstanden, wenn sie an den Haltestellen stoppten. Der Tag versprach, wieder heiss zu werden, wie alle die Sommertage zuvor. Ich dachte an die Badenden im Lido oder beim Alpenquai, an schattige Plätze unter Linden, an ein kühles Bier. Aber ich musste mich wohl auf viel Arbeit einstellen.
Wer war die Frau, die mich an Salomé erinnerte? War sie verheiratet? Hatte sie Familie? Im Büro würde ich ihre Adresse ausfindig machen können. Ausser meiner Mitarbeiterin Nina Buholzer war noch niemand anwesend. Und meinen Kollegen Julien Roduit hatte ich an diesem Morgen noch nicht erreicht. Ich erinnerte mich, dass er dieses Wochenende keinen Bereitschaftsdienst hatte.
Nina schaute mich mit ihren kugelrunden, dunklen Augen an, als ich in ihr Büro trat, wo sie vor dem Computerbildschirm sass. Sie galt als das Argusauge der Abteilung schlechthin. Sie war bald sechzig, sah aber jünger aus, was sicher an ihrem sportlichen Kurzhaarschnitt und dem dezent geschminkten Gesicht lag. Ich war mir nie sicher, wie diese Frau es schaffte, in allen Lagen, und waren sie noch so verzwickt, mit ihrer ansteckend guten Laune präsent zu sein. Ich lächelte ihr zu. Ein schwacher Versuch, ihrer sympathischen Art näherzukommen. »Könntest du mir ein paar Dinge abklären?«
Sie nickte kurz und strich sich mit der Hand durch ihre flippige Frisur. »Klar doch. Geht es um die Tote im Sempacherpark?«
»Du weisst davon?«
Mein Erstaunen quittierte sie mit einem heftigen Kopfnicken. »Der Chef hat mich schon darüber informiert. Leider haben wir sie noch nicht identifizieren können.«
Verdammt, die Handtasche. Ich musste mich setzen.
»Ist dir nicht gut?« Nina sah mich besorgt an.
»Ich komme gleich wieder«, sagte ich und stand auf.
Auf dem Korridor rief ich auf Daniels Mobiltelefon an. Er meldete sich mit Verzögerung.
»Bist du allein?«
»Ja, wo brennt’s? Wir haben gerade die Tote zum Transport bereit gemacht.«
»Erinnerst du dich an die Handtasche auf der Parkbank?« Meine Hände fühlten sich feucht an, der ganze Rücken, die Brust.
»Was für eine Handtasche?«
Ich war überrascht. Das konnte doch nicht sein, dass Daniel sie übersehen hatte. Ich befürchtete, dass er die Nacht nicht ganz im Trockenen verbracht hatte. Vielleicht mein Glück. »Hat Werner sie erwähnt?«
»Was erzählst du da?« Daniel war hörbar erstaunt.
»Hör’ zu«, sagte ich. »Ich habe da ein kleines Problem. Die Handtasche ist in meinem Wagen. Ich weiss nicht, was ich mir dabei gedacht habe, als ich sie von der Bank weggenommen habe.«
«Bist du bescheuert?» Daniel geriet ausser sich. »Hast du wenigstens Handschuhe getragen?«
»Nein, woher sollte ich die denn haben?«
Ich hörte lange nichts mehr. Jetzt dachte er über meine Dummheit nach und wie er mich aus dieser miserablen Lage wieder befreien konnte. »Gut«, sagte er nach einer Weile. »Du kannst die Tasche in mein Büro bringen. Lege sie in die oberste Schreibtischschublade.« Er unterbrach die Verbindung.
Ich kehrte zu Nina zurück. »Ihr Name ist Catherine Mahler«, sagte ich, um den Eindruck zu hinterlassen, dass ich deswegen vor der Tür gewesen war. »Bitte überprüfe, wo sie wohnt und ob sie Familie hat.«
Ich ging wieder auf den Korridor und ärgerte mich erneut, dass ich keine Zigaretten dabeihatte. Ich liess einen lauwarmen Kaffee aus dem Automaten und trank ihn in einem Zug aus. Mein Körper reagierte mit einem Schweissausbruch. Mir wurde schwindlig. Nur ganz unterschwellig verspürte ich eine Unsicherheit, die so schnell vorüber war, wie sie sich bemerkbar gemacht hatte.
***
Der erste Lagebericht fand in Hellers Büro statt. Toni Heller war der Untersuchungsrichter und zuständig für die Stadt. Ein rundlicher Mann mit grauen Geheimratsecken. Korner war jetzt da. Seine charismatische Erscheinung übertraf alle, selbst den korpulenten Heller. Er hatte sich die Haare geschnitten, was mir als Erstes auffiel. Etwas zwischen Bürstenschnitt und Radikalrasur, wohl der Hitze wegen. Er war dann auch der einzige Anwesende, der nicht schwitzte. Den anderen stand die harte Arbeit des Morgens ins Gesicht geschrieben. Daniel erschien etwas später. Er zwinkerte mir zu, was für mich wieder alles ins Lot brachte. Ich atmete auf.
»Meine Damen, meine Herren«, sagte Heller, was mir in Erinnerung rief, dass wir auch ein paar weibliche Mitarbeiter in unserer Abteilung hatten. Es würde uns guttun, hatte Korner gesagt, als irgendwann einmal zur Diskussion stand, ob die Frauen der Arbeit in der Kripo überhaupt gewachsen wären, ob sie dem Druck psychisch standhalten würden. Immerhin hatten wir im letzten Halbjahr gleich vier neue Mitarbeiterinnen bekommen. Vier Frauen, die die Polizeischule mit Bravour gemeistert hatten. Vier Polizistinnen, die jene Auflockerung in unsere Büros brachten, die Korner prophezeit hatte. Seit die Damen hier arbeiteten, waren die Herren in ihrer Ausdrucksweise um einiges gesitteter geworden. Wenn man es aus dieser Sicht betrachtete, so hatte die Gleichberechtigung doch etwas gebracht.
»Wir haben eine weibliche Leiche auf einer Bank im Sempacherpark«, sagte Heller. »Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir lediglich, dass die Frau nicht am Fundort umgebracht worden ist. Es sind Reifenrückstände gefunden worden, die nicht aus dem Park stammen. Sie werden im Labor untersucht.« Heller räusperte sich hinter vorgehaltener Hand. »Fest steht, dass die Frau durch Strangulieren oder durch einen Genickbruch ums Leben gekommen ist.«
Das war neu für mich. Davon hatte Daniel nichts erwähnt. Ich schaute ihn zwischen den glänzenden Köpfen der Anwesenden hindurch an. Aber er bemerkte mich nicht.
»Die genaue Todesursache wird in der Rechtsmedizin abgeklärt«, sagte Heller.
»Gibt es Zeugen?« Die Stimme kam aus der linken Ecke. Sie gehörte Marcel Jenny, dem Kommunikationschef. Soweit ich im Bilde war, hatte er Germanistik studiert, war dann während rund fünf Jahren Sekundarlehrer in einer ländlichen Gegend gewesen und hatte dann zur Kapo gewechselt. Ein intellektueller Medienmann, ein schlanker stattlicher Typ um die vierzig, genau die richtige Person für Korner und nicht für ein Dorf am Ende der Welt.
»Leider konnten erst zwei Zeugen ermittelt werden«, fuhr Heller fort. »Ein Dauergast aus dem Sempacherpark und der Empfangschef von The Hotel gleich nebenan. Es wird sich herausstellen, wie nützlich diese sind.« Er machte eine Pause. »Es ist nicht viel, meine Damen und Herren, und ich hoffe auf Ihren gewohnten Einsatz.«
Daniel hielt auf einmal die schwarze Lacktasche in den Händen und kippte deren Inhalt vor Korner auf den Tisch. »Vielleicht sollte man die Zylinder zu den Schlüsseln hier ausfindig machen«, sagte er.
»Die Schlüssel zur Wohnung der Toten«, stellte Korner fest.
»Es sind zwei verschiedene Schlüssel«, berichtigte Daniel, »jeder anders nummeriert.«
»Wir werden die Schlüssel überprüfen«, sagte Korner und steckte sie in einen Plastikbeutel. Insgeheim hoffte ich, dass er den Beutel nicht verlegte.
»Andy!« Conradins Stimme neben mir riss mich aus meinen Gedanken. »Du wirst zusammen mit Julien an die Sache herangehen und vorerst das nähere Umfeld der Toten ausfindig machen.«
Ich wusste, was das hiess: Zeugenbefragungen im Umfeld der Ermordeten. Akribisch genaue Analysen der Personen und deren familiärer Strukturen. Und da ich an diesem Samstag nicht mit Julien rechnen konnte, musste ich mich auf einen Alleingang vorbereiten. Auf den weiteren Verlauf des Rapportes konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich hörte zwar Hellers Stimme, Korners Einwände und Befehle, aber an deren Wortlaut erinnerte ich mich im Nachhinein nicht mehr. Meine Gedanken waren wie aufgelöst. Meine Sinne durcheinander. Wo steckte Salomé?
Erst später informierte Conradin die Leute meiner Abteilung über ihre Arbeit und wies uns entsprechend zu. Viel gab es nicht zu sagen. Und die Möglichkeit, dass sich dies kurzfristig ändern sollte, war gering. Ich fühlte mich leer und stand nicht einmal an einem Anfang. Ich machte mich auf den Weg zur Hertensteinstrasse und parkierte dort meinen Wagen im Autosilo.
Die Altstadt war sehr belebt. Menschen hasteten, spazierten, verweilten. Ihnen schien die Hitze nichts auszumachen. Sie waren unterwegs und freuten sich offensichtlich über das tolle Wetter. Lachende Münder. Krause Nasen. Schlitzaugen. Ein Strom aus bunten Stoffen, weil Sommer war. Eine Gruppe Schüler kam mir entgegen, Fähnchen schwenkend und die Schweizer Nationalhymne singend, alle mit einem roten Shirt bekleidet, auf dem ein grosses Schweizerkreuz prangte. Eidgenössisch nationalsozialistisch. Ich musste über diesen aufgesetzten Patriotismus schmunzeln, wo wir doch in einer Zeit lebten, in der Globalisierung und Fusionierung über die Landesgrenzen hinaus in aller Munde waren. War das die neue Rebellion gegen zu viel Glasnost im eigenen Land? Eine Opposition gegen den Liberalismus? Wie hatten sich die letzten zehn Jahre verändert!
***
Die Adresse hatte ich schnell gefunden. Mit dem Aufzug fuhr ich in den fünften Stock. Mahler stand auf dem kleinen Türschild rechts des Einganges. Ich drückte die Glocke. Sie klang schrill, aber es passierte nichts. Ich klingelte noch einmal. Nach einer Weile wurde die Tür zögerlich geöffnet. Ein blonder, ungekämmter Wuschelkopf kam zum Vorschein, dann nahm ich den ganzen Körper wahr. Ein langes, schlaksiges Mädchen in zerschlissenen Jeans und einem bauchfreien Top, das ein blaues Bauchnabelpearcing zum Vorschein brachte.
»Sie wünschen?« Eine zarte Mädchenstimme.
Ich nannte meinen Namen und musste mich im Nachhinein räuspern. Sie war sehr jung, hatte aber trotzdem etwas Anrüchiges an sich. Ich versuchte ein krampfhaftes Lächeln, was mir in der jetzigen Situation doch nicht gerade passend erschien. Ich musste schliesslich eine sehr traurige Nachricht überbringen. »Ich komme wegen Catherine Mahler«, sagte ich mit trockenem Mund.
»Meine Mutter ist nicht hier«, kam es spontan zurück.
Ich wich einen Schritt rückwärts und blickte die junge Frau an. Mit einer Tochter hatte ich nicht gerechnet. »Kann ich Ihren Vater sprechen?«, fragte ich, in der Annahme, dass es einen Vater gab.
»Der ist auch weg.«
»Darf ich einen Moment reinkommen?« Ich erklärte, wer ich war, und zeigte ihr meinen Dienstausweis. Sie warf kaum einen Blick darauf und öffnete stattdessen die Türe ganz.
»Kommen Sie herein.«
Ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen, schritt sie voraus in die Küche. Sie hatte lange, schmale Beine. Dieser wippende Gang kam mir bekannt vor. Ich sah, wie sie vom Küchentisch eine Zigarette aus einem angebrochenen Päckchen angelte. »Wollen Sie auch?«
»Ich bin im Dienst«, erwiderte ich und merkte gleichzeitig, wie banal das klang. Ich lechzte geradezu nach Tabak.
Sie machte grosse Augen, schöne Augen, was mir nicht missfiel. »Gilt das auch für Nikotin?« Sie war nicht auf den Mund gefallen. »Was wollen Sie von meiner Mutter?« Sie zündete die Zigarette an, machte einen tiefen Zug und blies den Rauch gleich wieder heftig aus. Sie lehnte jetzt lässig an der Kombination. Sie tat übertrieben selbstbewusst. »Ich heisse übrigens Sophia Glorianda, aber Sie können mich ruhig Sophie nennen.« Ich hatte das Gefühl, sie versuchte, eine innere Unsicherheit geschickt zu kaschieren. »Habe ich mein Fahrrad falsch parkiert oder haben Sie mich beim Kiffen erwischt?«
Da war es schon. Sie lachte. Ihre eingezäunten Zähne entgingen mir dabei nicht. Die heutigen Zahnärzte proklamierten ein perfektes Gebiss. Der Oberkiefer musste etwas über den Unterkiefer hinausstehen, damit die Speisen richtig zermahlt werden konnten. Ich fragte mich nur, was die heutigen Kinder zu zermalmen hatten, wo ihnen doch diese aufgummierten Schnellimbiss-Brote kein Kauen mehr abverlangten und die Jugend nicht mehr gewillt war, auf die Zähne zu beissen. »Ich bin nicht deswegen hier.« Ich würde sie Sophie nennen und meinen ersten Eindruck korrigieren.
»Ach, etwa wegen der Vormundschaftsbehörde? Hören Sie mal, ich bin seit einem Monat volljährig. Ich brauche keine Anstandsbeihilfe.« Sie stiess sich von der Kombination weg und kam einen Schritt auf mich zu. »Hat sie etwas Dummes angestellt?«
»Wer?«
»Meine Mutter.« Abrupter Themenwechsel, als wollte sie mich irreführen. Sie blies mir den Zigarettenqualm ins Gesicht. »Ich sage Ihnen, mein Vater ist ein armes Schwein. Er arbeitet wie der grösste Trottel, und meine Mutter führt ein Leben in Saus und Braus. Immer die neuesten Klamotten, die besten Kosmetika, Fitnessclubs und all den Scheiss, der die Hausfrauen glauben lässt, dass nur dieses Zeugs sie attraktiv hält. Aber wenn man erst mal dreissig ist, so ist der ganze Kram doch gelaufen. Da schaut dir keiner mehr nach.« Die Sätze sprudelten aus ihr heraus, als hätten sie vom eigentlichen Thema ablenken müssen, was mich wiederum misstrauisch werden liess. Ein Charakterzug, der zu meinem Job gehörte, eine Folge auch von einem abgebrochenen Psychologiestudium. Täter sind wie Kinder, welche die Flucht nach vorn in Augenschein nehmen. Hatte sie ihre Mutter umgebracht?
»Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Ihre Mutter heute früh tot aufgefunden worden ist«, sagte ich monoton.
Ein gefährliches Schweigen herrschte zwischen uns. Ganz gedämpft vernahm ich das Stimmengewirr auf der Strasse unterhalb der Wohnung, Kindergeschrei, das Bellen eines Hundes. Die ganze Farbe aus Sophies Gesicht war verschwunden. Sie zwang sich zu einem krampfhaften Lächeln. »Das ist wohl ein Irrtum«, brachte sie zögernd heraus. »Meine Mutter ist gestern Abend ins Konzert gegangen. Sie wollte in einem Hotel übernachten, um mich spätnachts nicht zu stören.« Sophie rang um Haltung. »Machen Sie das immer so?« Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Setzen Sie sich erst einmal hin«, schlug ich vor. »Haben Sie ein Auto?«
Sophie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. »Wie kommen Sie darauf?«
»Können Sie Auto fahren?«
»Wie man’s nimmt«, sagte sie. »Ich übe noch.«
Sollte ich ihr glauben? Sie verschwand in einem Zimmer. Ich schaute mich um. Die Wohnung war grosszügig ausgestattet, modern eingerichtet und sauber. Durch das Küchenfenster erkannte ich einen Teil der Museggmauer, einen Turm und Wäsche auf einer Dachterrasse. Ich dachte an meine Zweizimmerwohnung beim Bahnhof und nahm dies hier neidvoll zur Kenntnis.
Nach einer Weile kam Sophie mit einem Bilderrahmen in der Hand zurück. »Das ist meine Mutter«, sagte sie und reichte mir ein gerahmtes Porträt.
»Kann ich das Bild mitnehmen?« Sophie nickte. Ich schaute es an. Genau wie Salomé. Ich merkte, wie meine Beine wegzusacken drohten. Gleichzeitig wunderte ich mich über Sophie, die keine Anstalten machte, Näheres über den Umstand des Todes zu erfahren. Vielleicht stand sie unter Schock und verdrängte die Tatsache ganz einfach.
»Hat sie noch eine Schwester?« Ein trostloser Versuch, meine innere Spannung zu beruhigen.
»Nein, sie ist Einzelkind«, sagte Sophie. Es fiel ihr sichtlich schwer zu sprechen.
»Wann kommt Ihr Vater zurück?«
»Der ist auf einer Geschäftsreise und vor Montagabend nicht da.«
»Kann ich ihn erreichen?«
»Kaum, er ist im Ausland. Ich weiss nicht einmal, wo.«
»Hat er Ihnen keine Adresse hinterlassen?«
»Wozu? Wir sind erwachsene Leute in diesem Haushalt. Wir können tun und lassen, was wir wollen, ohne dem anderen Rechenschaft abzulegen.«
Ich räusperte mich. »Was hat Ihre Mutter beruflich gemacht?«
Es dünkte mich, als lachte Sophie gequält auf. »Sie hat ihr Leben auf Kosten meines Vaters voll ausgeschöpft. Sie ist immer unterwegs gewesen, hat sich mit Freunden getroffen und sich die Nächte in Bars um die Ohren geschlagen ...«
Meine Frage war damit nicht beantwortet. Sophie zündete eine neue Zigarette an, nachdem sie die heruntergebrannte im Ascher ausgedrückt hatte.
»Ging das immer so?«
»Ja, schon eine Ewigkeit.« Sie machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Wie alt war ihre Mutter?«
»39.«
»Und wie war die Ehe?«
»Wie soll die schon gewesen sein?« Sophie zog ihre Schultern hoch. »Meine Eltern haben sich auseinandergelebt. Das ist doch wohl normal, oder?«
»Kann ich einmal ihr Zimmer sehen?«
»Mein Zimmer oder das meiner Mutter?« Sophie drehte sich um.
»Das von Ihrer Mutter selbstverständlich.«
Das Zimmer lag gleich neben der Küche mit einem Fenster auf den Hinterhof. Ein französisches Bett stand darin, frisch bezogen und unbenutzt. Und an der Wand ein modernes Pult mit Computer und Bildschirm. Nicht etwas, was mir bekannt vorkam. »Darf ich mal?« Ich schritt auf die Einbauschränke rechts der Türe zu. Ich öffnete den ersten Türflügel. Fünf Gestellbretter, die spärlich mit Pullover, Shirts und Unterwäsche belegt waren. Im nächsten Stauraum hingen Kleider in meist dunklen Farben, im letzten Hosen, Jacken und ein Mantel – alles sorgsam sortiert und aufgehängt. Kein mir bekanntes Teil. Nicht der feinste Geruch, an den ich mich erinnern konnte. In einer Schuhschachtel auf dem Schrankboden allerlei Papierkram. Vielleicht wurde ich da fündig. »Die nehme ich mit«, sagte ich und klemmte sie mir unter den Arm. »Hat Ihre Mutter irgendwelche Kontakte gepflegt?«
»Natürlich hat sie das. Aber nicht solche, wie Sie denken.«
»Ich meine, hat sie einen Freund gehabt?« Vielleicht hätte ich mich mit dieser Frage selbst mit Problemen belastet. Was, wenn Sophie die Frage mit Ja beantwortete? Wollte ich es überhaupt wissen? Sophie schaute mich verblüfft an. Sie öffnete den Mund, um mir etwas zu sagen, wie es schien, hielt dann aber abrupt inne. Ich stellte fest, dass sie mich auf gar keinen Fall schon einmal gesehen hatte.
»Sie ist eine attraktive Frau gewesen«, sagte ich, auf das Foto zeigend.
»Sie hat gemeint, sie sei attraktiv«, entgegnete Sophie altklug. Es kam mir vor, als hätte sie soeben die Rolle mit der ihrer Mutter vertauscht. »Aber sie hat in Visionen gelebt. Sie hat sich mit Oberflächlichkeiten abgegeben. Irgendwie war sie nicht die Mutter, die man sich unter einer Mutter vorstellt. Eher wie eine Kollegin. Ich glaube, sie hatte irgendwelche Probleme mit sich selber. Nur hat mich das nie interessiert.« Sophie zog die Schultern hoch, als begriffe sie das, was sie sagte, selber nicht. Vielleicht hatte sie ein typisches Konkurrenzdenken. So etwas sollte es scheinbar zwischen Mutter und Tochter geben. »Aber ich kann Ihnen beim besten Willen keine bessere Auskunft erteilen.«
Wieder diese Zweifel. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass Sophie mehr über ihre Mutter wusste, als sie zugab.
»Hat Ihre Mutter den Computer oft benutzt?«
»Manchmal hat sie bis spät in die Nacht hinein gearbeitet, hat sie zumindest gesagt. Was genau das gewesen ist, weiss ich nicht. Vielleicht hat sie Spiele gemacht oder E-Mails verschickt. Aber ich weiss es wirklich nicht.« Sie wippte jetzt ungeduldig auf den Zehenspitzen.
»Kann ich den mal in Betrieb setzen?«
»Meinetwegen, wenn Ihnen das weiterhilft.«
Ich startete den Rechner auf. Aber beim Passwort kam ich nicht mehr weiter.
»Kennen Sie den Code?«
»Schreiben Sie doch einfach Sophie oder Hans, so heisst mein Vater. Aber sie wird wohl ein pfiffigeres Schlüsselwort verwendet haben, Loveparade oder so.«
Ich hörte einen zynischen Unterton aus ihrer Stimme.
»Sie haben ihre Mutter nicht besonders gern gehabt«, stellte ich fest.
»Merkt man das?«, Sophie schniefte. »Sie hat meinen Vater zugrunde gerichtet. Wie ist sie umgekommen?«
Themenwechsel. Diese Frage kam für mich unvorbereitet.
»Man hat sie erdrosselt.«
Sophie blieb ruhig. Ich staunte über ihre plötzlich gefasste Haltung. »Kann ich meine Mutter noch einmal sehen?«
»Ich glaube, es ist besser, wenn Sie warten, bis Ihr Vater zurück ist.« Um die nächste Frage kam ich nicht herum. »Was haben Sie von gestern Abend bis heute Morgen gemacht?«
»Das ist wohl ein Scherz?« Sophie schaute mich verblüfft an.
»Ich muss alles in Erwägung ziehen«, antwortete ich. »Das bringt leider mein Beruf mit sich.«
»Ich war da in der Wohnung.« Sie zog die Augenbrauen hoch und spitzte den Mund, tat, als wäre sie sehr überrascht.
»Allein?«, fragte ich.
»Nein, nicht allein. Mit einem Lover. Wir haben die ganze Nacht durch…«, sie schmunzelte und schaute mich mit einem kecken Blick an, »…gebumst.« Sie verschränkte ihre viel zu langen Arme. In diesem Moment kam sie mir wie eine riesige Spinne vor. »Sie sollten sich wieder mal rasieren«, sagte sie. Das veranlasste mich, im Spiegel neben dem Eingang unbemerkt einen Blick von meinem Gesicht zu erhaschen. Was ich da im Bruchteil einer Sekunde erkannte, liess die Frage offen, ob ich in den letzten Tagen zu wenig geschlafen hatte. Salomé. Ich musste mich im Krankenhaus nach ihr erkundigen, obwohl sie das nie gewollt hatte. Ich streckte Sophie meine rechte Hand hin, zog sie jedoch wieder zurück, als sie keine Anstalten machte, die Geste zu erwidern.
»Ersparen Sie sich das«, sagte sie stattdessen. »Solange Sie mich verdächtigen, bleiben wir Feinde.« Sie bückte sich, um ihre Hosenbeine über den hohen Schuhen zu ordnen, ein völlig sinnloses Vorhaben, wie mir schien. Dabei rutschte ihr kurzes Top über ihre linke Brust, die praktisch flach war. Sie hatte eine helle Haut und rosa Knospen. Ich dachte an eine berechnende Absicht, die hinter ihrer Bewegung steckte. Sie warf dann auch den Kopf provozierend in den Nacken, bevor sie sich wieder vor mir aufrichtete. Ihre Augen blitzten. Sie hatte ungewöhnliche Augen.
Im Hinausgehen drehte ich mich noch einmal um. »Hat Ihre Mutter im Krankenhaus gearbeitet?«
Sophie reagierte schneller als erwartet. »Nein. Von Blut wurde ihr schlecht.«
Ich ging. Mein Hemd war nass vor Schweiss und dies nicht nur der Hitze wegen.
***
Ich hätte das Recht gehabt, einen Dienstwagen der Kantonspolizei zu fahren. Eine dieser Zwei-Liter-Limousinen. Aber da mir nun einmal mein alter schäbiger Golf lieber war und ich aufgehört hatte, die Beulen an der Karosserie zu zählen, zeigten auch meine Arbeitskollegen viel Verständnis dafür. Die Versicherung zahlte längst nicht mehr.
Den Weg zum Kantonsspital nahm ich über meine bekannten Abkürzungen und war froh, dass ich wenigstens am Ziel gleich einen Parkplatz fand.
Das Krankenhaus war ein riesiger Bau aus den späten Sechzigerjahren und ragte über ganz Luzern. Seit Jahren war da oben eine Baustelle, und ich fragte mich, wie die Patienten bei so viel baulicher Tätigkeit genesen konnten. Es schien wohl eher so, als wären sie die Mitfinanzierer dieses ewigen Projektes.
In der Eingangshalle ging es geschäftig zu und her. Patienten kamen, Patienten gingen. Vor den Informationsschaltern standen die Leute Schlange. Es war auch hier drinnen schwül und roch stark nach Chloroform. Ich wusste nicht, wo ich mich hinbegeben sollte. Ich musste allerdings endlich Gewissheit haben, dass Salomé hier war und noch lebte. Gleich würde sie mir um den Hals fallen, mich dafür schelten, dass ich, gegen unsere Abmachung, an ihren Arbeitsplatz gekommen war. Das würde nicht mehr wichtig sein, wenn ich sie nur sah und meinem inneren Kampf ein Ende bereiten konnte.
Die Schwester mit dem blauen Haarband kam gerade richtig. Ich stellte mich ihr in den Weg. »Hallo, haben Sie Zeit für mich?«
Sie zeigte ein zaghaftes Lächeln. Ihre Augen rollten unsicher. Eine Schwesterschülerin, ahnte ich und ich hielt sie sachte am Ärmel fest, damit sie mir ja nicht entkommen konnte. »Sie können mir sicher helfen. Ich suche Schwester Salomé.«
Die junge Frau mit dem Haarband nahm eine abwehrende Haltung ein. »Ich bin noch nicht so lange hier«, sagte sie und ihr Lächeln verstärkte sich noch ein wenig.
»Aber können Sie mir wenigstens sagen, wo ich mich nach ihr erkundigen kann?«
»Da gehen Sie am besten zur Anmeldung«, sagte sie und bewegte ihren Kopf in die Richtung, in der die Leute Schlange standen. Ich bedankte mich und stellte mich bei der Anmeldung hinten an.
Zwei Krankenpfleger eilten mit einer Bahre Richtung Ausgang, wo soeben ein schwarzes Taxi gehalten hatte. Hinter mir stellten sich weitere Personen in die Reihe. Ein kleines Mädchen hielt tapfer seinen Teddy im Arm und unterdrückte ein paar Tränen. Ich sah es an seinem zuckenden kleinen Mund. Die grosse, geschminkte Frau, bestimmt seine Mutter, beachtete es kaum und redete stattdessen ununterbrochen mit ihrer Nachbarin. Ich schaute die Kleine an, weil sie mir in diesem Moment leid tat. Als sich bei ihr doch eine Träne löste, nahm ich rasch ein Taschentuch aus meiner Hosentasche und gab es dem Kind. Ich erntete dafür ein dankbares Lächeln.
»Wie heisst du?«, fragte ich leise und kauerte mich vor ihm hin. Aber bevor mir das Mädchen Antwort geben konnte, riss es die Frau von mir weg. Langsam begann ich doch, an meinem Aussehen zu zweifeln.
Die Dame bei der Anmeldung war künstlich nett. Sie konnte mir auch meine Frage schnell beantworten. »Salomé hat soeben ihre Arbeit angetreten«, informierte sie mich, nachdem sie einen prüfenden Blick auf den Computer-Bildschirm geworfen hatte. »Sie finden sie im ersten Stock im Ambulatorium.«
»Ich dachte, sie habe Nachtdienst?«
Die Sekretärin schaute mich lächelnd an. »Vielleicht ist sie anders eingeteilt worden.«
»Können Sie bitte auch nachschauen, ob eine Catherine Mahler hier arbeitet oder gearbeitet hat?« Vielleicht kannte ich ihre Antwort bereits.
Ihre rechte Hand fegte die Maus über das Pad. Klickte an. »Nein, tut mir leid.« Sie fragte nach keinem Grund, was mich irritierte. »Sie müssen gehen. Sie sehen ja, was los ist«, sagte sie jetzt nicht mehr künstlich.
»Ist das immer so?«
»Ja, das ist immer so«, seufzte sie. »Die Krankheit nimmt keine Rücksicht auf Jahreszeiten.«
»Wenigstens gibt es hier keinen Stellenabbau«, sagte ich.
»Das liegt nicht in meiner Hand, auf Wiedersehen.«
Das war eine klare Aufforderung. Ich bedankte mich und ging. Vielleicht lag es schlussendlich doch in ihrer Hand.
Ich begab mich in den hinteren Bereich zum Aufzug. Es roch nach Sterilium, nach gewachsten Linoleumböden, nach Milchkaffee. Die beiden Krankenpfleger kehrten mit der Trage zurück, auf der jetzt ein Patient lag, und verschwanden in einem der Aufzüge.
Wenig später standen wir uns gegenüber: ich und eine mollige kleine Frau mittleren Alters mit einem kugelrunden, gutmütigen Gesicht und Wangen, die wie Äpfelchen im Herbst kurz vor der Ernte rot glänzten.
»Wo finde ich Schwester Salomé?«
»Haben Sie sich schon angemeldet?« Die erfahrene, emsige Art einer Alteingesessenen. Wenn sie sprach, kam dies einem Donnern gleich.
»Ich bin wegen Schwester Salomé hier«, berichtigte ich.
»Sie stehen vor ihr.« Wenn sie lachte, bebten ihre Falten auf dem vollen Gesicht. Da Vinci hätte die grösste Freude an ihr gehabt.
»Die Frau, die ich suche, ist ein wenig jünger als Sie«, versuchte ich, höflich zu dokumentieren.
»Wir haben sonst keine andere Angestellte mit diesem Namen hier im Haus. Und ich kenne mich aus, mein Lieber. Ich bin schon seit mehr als vierzig Jahren im Dienste der Kranken.«
»Aber vielleicht erinnern Sie sich an eine Krankenschwester mit langen, schwarzen Haaren ...« Ich hielt inne, weil mir in diesem Moment bewusst wurde, wie hilflos und komisch das klang.
»Ja?«, fragte sie. Ihr Mund klaffte vor Neugierde weit auf.
»Eine Schönheit von einer Frau«, sagte ich und verhaspelte mich. Ich bemerkte, welch eigenartigen Eindruck ich hinterliess.
»Wer sind Sie eigentlich, und weshalb suchen Sie die Frau?« Salomé griff nach meinem Arm und schob mich auf die Seite des Korridors, weil ein betagtes Paar an uns vorbeiging. »Ich ermittle in einem Mord«, flüsterte ich.
»Grosser Gott, und die Spur führt zu mir?« Sie schaute mich skeptisch an. Bevor ich mich auf eine Diskussion einliess, suchte ich jedoch das Weite. Ich bedankte mich mit ausgesucht netten Argumenten, entschuldigte mich für meinen Irrtum.
Ich fühlte mich so elend, als wäre ich soeben auf das fiese Vorgehen eines Komplotts gegen mich aufmerksam geworden. Die Leere, die ich schon am Morgen verspürt hatte, kehrte zurück. Ich hatte in meiner Tätigkeit als Kriminalbeamter grundsätzlich gelernt, über den Dingen zu stehen und Distanz zu wahren, und merkte jetzt unweigerlich, dass diese Prinzipien an Boden verloren, wenn persönliche Aspekte in den Vordergrund traten. Da nützte einem auch die Fähigkeit nichts, Dinge des Lebens einzugrenzen und voneinander zu unterscheiden. Noch einmal versuchte ich, meine Salomé zu erreichen, hatte aber wieder kein Glück.
***
Am frühen Nachmittag rief mich Gaby an. Sie hatte ich am allerwenigsten erwartet. Gaby, meine verflossene grosse Liebe, die mir vor zwei Jahren einen reichen Industriellen aus Basel vorgezogen hatte. Ich hatte mich oft gefragt, wie lange diese Ehe wohl dauern würde. Immerhin war ihr Angetrauter dreissig Jahre älter als sie. Aber aus Frauen wird man nie wirklich klug und was sie dazu veranlasst, gewisse Schritte in entgegengesetzte Richtungen zu tun, bleibt wohl immer ein Geheimnis. Sie klang nicht sehr glücklich, als ich ihre Stimme auf meinem Mobiltelefon vernahm.
»Gott sei Dank habe ich dich erreicht«, meldete sie sich und seufzte tief und anhaltend.
Es beruhigte mich, dass sie sich ihre Theatralik noch immer nicht abgewöhnt hatte. Sie hatte es schon zu meiner Zeit ausserordentlich gut verstanden, ihre Probleme durch wirkungsvolle Geräusche zu unterstreichen. Und dass sie ein Problem hatte, merkte ich an ihrer Stimmlage. Schliesslich hatte ich mit dieser Frau fast sieben Jahre zusammengelebt.
»Schön, dich zu hören«, log ich und schluckte meinen Kloss herunter. »Was verschafft mir die Ehre?«
»Wie kannst du aus meiner Notlage auch noch Scherze machen?«, schniefte sie beleidigt. »Mir geht es nicht gerade gut. Ich bin von zu Hause ausgerissen.«
Das hörte sich nach verletztem Teenager an. Ich unterliess es, ihr zu sagen, dass ich damit vom ersten Tag ihrer Ehe an gerechnet hatte. »Und da bin ich dir als rettender Engel in den Sinn gekommen?«, fragte ich stattdessen.
»Ich weiss nicht, wo ich hin soll. Aber ich halte es bei Karl nicht mehr aus.«
»Jetzt alles der Reihe nach«, versuchte ich, sie zu beruhigen. »Ich nehme an, dass du ein wenig Kleingeld bei dir hast und dich irgendwo in einem Hotel absetzen kannst.«
Ich hörte sie wieder seufzen. »Das ist es ja, ich habe keinen roten Cent bei mir. Ich bin Hals über Kopf geflüchtet. Kann ich zu dir kommen?«
In meinem Kopf rasselte es. Wenn ich ihr jetzt zusagte, war es mit meiner Ruhe vorbei. Spontan dachte ich an Salomé, an ihre sinnliche Art, an ihren Duft, wenn sie am Morgen nach dem Duschen zu mir in die Küche kam und sich auf meine Knie setzte, noch feucht vom Wasser und benommen von der Nacht. Ich wusste nicht, ob ich Gaby ertragen würde. »Du kannst kommen«, sagte ich zu ihr und hörte sie entspannt aufatmen.
»Das werde ich dir ein Leben lang danken«, entgegnete sie. »Ich kann ja dann wieder für dich da sein.«
Das hatte ich nicht erwartet. »Ich meine«, korrigierte ich, »dass du vorerst bei mir wohnen kannst, bis man eine geeignete Lösung gefunden hat. Du musst wissen, dass ich auch kein Mönch gewesen bin nach deinem Abgang.«
Ich hörte Gaby kichern. »Ich werde dir bestimmt keine Umstände machen«, versprach sie, und ich glaubte ihr. »Kannst du mir einen Schlüssel hinterlegen?« Sie tönte so, als wären wir nie getrennt gewesen.