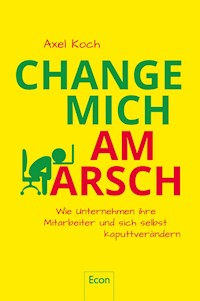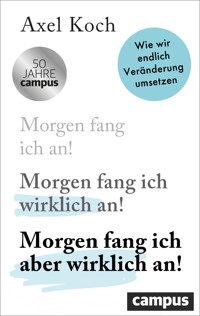
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Alle beschäftigen sich ständig damit, WAS sie verändern müssten in ihrem Leben, in ihrem Job und vernachlässigen dabei, WIE es funktionieren kann. Es liegt nicht an mangelnder Willenskraft oder Motivation, wenn wir in einer Veränderungslähmung gefangen sind, sondern an mangelnder Technik, sagt der Psychologe und Bestsellerautor Axel Koch. Mit der von ihm nach den Gesetzen der Veränderungspsychologie entwickelten Transferstärke-Methode kann die Veränderungsdynamik endlich Tempo aufnehmen! -Potenziale unserer individuellen Veränderungskompetenz heben -Verhaltensänderung lernen durch Selbststeuerung -Uns bremsende Spielregeln erkennen und ändern
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Axel Koch
Morgen fang ich aber wirklich an!
Wie wir endlich Veränderung umsetzen
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Alle beschäftigen sich ständig damit, WAS sie verändern müssten in ihrem Leben, in ihrem Job und vernachlässigen dabei, WIE es funktionieren kann. Es liegt nicht an mangelnder Willenskraft oder Motivation, wenn wir in einer Veränderungslähmung gefangen sind, sondern an mangelnder Technik, sagt der Psychologe und Bestsellerautor Axel Koch. Mit der von ihm nach den Gesetzen der Veränderungspsychologie entwickelten Transferstärke-Methode kann die Veränderungsdynamik endlich Tempo aufnehmen!- Potenziale unserer individuellen Veränderungskompetenz heben- Verhaltensänderung lernen durch Selbststeuerung- Uns bremsende Spielregeln erkennen und ändern
Vita
Axel Koch, geboren 1967, ist promovierter Diplom-Psychologe und Professor für Training und Coaching an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning. Er arbeitet seit über 30 Jahren als Redner, Trainer und Coach. In seiner Forschung befasst er sich mit dem Thema »Lerntransfer & nachhaltige Veränderung« und hat mit seiner mit dem Deutschen Weiterbildungspreis ausgezeichneten Transferstärke-Methode® einen neuartigen und wissenschaftlich fundierten Ansatz entwickelt, damit Trainingsmaßnahmen mehr Praxiswirkung bringen. Er hat mehrere Bücher zu seinem Spezialgebiet veröffentlicht, darunter zwei Bestseller.
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Kapitel Prolog
Prolog: Erstarrt zu Eis
Kapitel 1
— Wir wissen, was wir verändern müssen, tun es aber nicht
Die Ohnmacht im Angesicht des Musters
Schön wäre es: Gesunde Gewohnheiten
Bad Habits in der Arbeit
Wir sind Zahnrädchen im großen Getriebe
Mogelpackung Gehirn?
Sei dir deiner Reize bewusst
Die Räderwerke unserer Gedanken
Verdrahtet wie ein Maschendrahtzaun
Die fleischgewordene Wurstfabrik im Körper
Von geduckten Dackeln und Körperpanzern
Blind für die richtige Lösung
Kapitel 2
— Die Überschätzung des inneren Schweinehundes
Dein Wille geschehe, aber was ist überhaupt Wille?
Du kannst alles schaffen, wenn du nur willst
Wie ein Ball unter Wasser – wenn der Willensakku leer ist
Über diesen Fluss musst du gehen
Kapitel 3
— Der psychologische Nutzen und die Folgen
Deine Chefin ist nicht immer nur die Böse
Das innere Hindernis auf dem Weg zum Ziel
Der Preis des Handelns
Ruhe in Frieden – oder lieber doch nicht?
Liebe deine Feindin
Das innere Team in Einklang bringen
An der Wurzel anpacken
Der fieseste Feind von allen
Kapitel 4
— Normen sind der Tod jeder Veränderung
Allein gegen alle – zermahlen im Mühlrad
Die Wucht der Abwehrmuster
Das System schlägt zurück
Der Wunsch nach einer »biologischen Lösung«
Krank machende Raketenstufen
Wie Minderheiten die Welt verändern
Sich selbst immunisieren
Andere als unterstützendes Umfeld einbinden
Verhalten ändern ohne Anstrengung
Verhalten steuern durch Gamification
Kapitel 5
— Die veränderungsresistente Persönlichkeit – und nun?
Alles begann mit einem Traum
In der Selbstoptimierungsschmiede
Verleugne nicht deinen Kern
Erkenne deine Veränderungsgrenzen
Die Moral von der Geschichte
Kapitel 6
— Transferstärke – das Geheimnis veränderungsstarker Menschen
Schluss mit Sisyphos
Schritt 1 – Altes Verhaltensmuster beschreiben
Schritt 2 – Neues Verhaltensmuster beschreiben
Schritt 3 – Vorboten für das alte Verhaltensmuster identifizieren
Schritt 4 – Definiere dein Stoppsignal
Schritt 5 – Erarbeite für jeden einzelnen Vorboten einen Notfallplan
Ein Beispiel für einen Rückfallplan
Das 8-Wochen-Programm mit der Umsetzungskurve
Sei nett zu dir und erkenne die kleinen Erfolge
Das Transferstärke-Toolbox
Faktor »Rückfälle in alte Muster managen«
Faktor »Positives Selbstgespräch bei Rückschlägen«
Faktor »Abwehr aus dem Umfeld parieren«
Kapitel 7
— Wie wir uns als Gesellschaft aus der Veränderungslähmung befreien
Wir kommen nicht vom Fleck
Verzichtsforderungen und Prinzip Buhmann
Die gemeinsame Sprache der Veränderungspsychologie
Die Perspektive von Mini-Deutschland statt Machtinteressen
Veränderungsstarke Politikerinnen und Politiker – wie toll wäre das?
Wirf den Stein ins Wasser
Epilog: Eisschmelze
Anmerkungen
1 | Das Veränderungsparadoxon
2 | Reine Willenssache
3 | Der Feind in meinem Kopf
4 | Das Lemminge-Phänomen
5 | Dagegen ist kein Kraut gewachsen
6 | Update für unser Gehirn
7 | Keim erkannt, Keim gebannt
Epilog | Eisschmelze
Kapitel PrologProlog: Erstarrt zu Eis
Es streicht ein kühler, frischer Wind über mein Gesicht, als ich eintrete. Wir bewegen uns in Zweierreihen hintereinander. Es ist ganz schön eng hier. Fast beklemmend. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mit dem Kopf an den scharfen Felskanten über mir anstoße. Ob es wohl eine richtige Entscheidung war, hier hineinzugehen? Unsere Schritte knirschen auf dem steinigen Untergrund. Mich fröstelt es. Wir dringen weiter nach innen vor in die Rieseneishöhle im Dachsteingebirge in Österreich. Es ist dunkel, nur wenig Licht, das von einigen Strahlern kommt. Vor mir zieht sich wie ein schlafender Riese eine kühle, glitzernde Fläche über den Boden. Und da: Ein sagenhafter Monolith erhebt sich fast mannshoch in wilden Zacken. Strahlend weiß türmt er sich über mir auf und ich fühle mich plötzlich ganz klein. Alles voller Eis. Als hätte jemand riesige Eimer voll Wasser ausgeschüttet, das sofort gefroren ist. Eine erstarrte Welt, schießt es mir durch den Kopf. Ohne jede Lebendigkeit! Und ich muss an die vielen Menschen denken, die zu mir als Coach gekommen sind, eingefroren in ihren Gewohnheiten. Alles verhärtet, kein Millimeter Bewegung möglich.
Ja, denke ich, Gewohnheiten sind wie ein Eispanzer. Es bröckelt nichts, auch wenn das Leiden, das sie mit sich bringen, groß ist. Es geht keinen Schritt vor und keinen zurück. Es ist eine Welt, die stillsteht, wie hier. Ich schaue mich in der Höhle um. Tonnen von Wasser, riesige Eisflächen, unendlich scheinende Eislandschaften. Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende alt liegen sie hier tief verborgen im Berg. Faszinierend, aber irgendwie auch schaurig, wenn ich daran denke, dass Gewohnheiten über Jahre bis Jahrzehnte genauso stabil sein können wie dieses Eis. Nichts bewegt sich.
Wenn ich versuchen würde, mit dem Eispickel etwas von dem Eis hier abzutragen, würde ich kaum durchdringen. Der Eispickel würde abprallen, vielleicht könnte ich winzige Eissplitter lösen. Ich weiß, so fühlt es sich für viele Menschen an, wenn sie Gewohnheiten loswerden wollen. Jede Veränderungsbemühung prallt ab. Auch ich kenne dieses Gefühl nur zu gut. Wie die eisige Hand der Gewohnheiten mich in die Tiefe des Eislochs zieht, aus dem ich endlich herauswill. Ich weiß genau, wie das ist. Alles in mir schreit: Ich will raus!
Ich schüttele mich und löse mich von diesen Gedanken. Meinen Blick richte ich wieder nach außen. Aufpassen, da ist diese lange Passage über das Eis aus Metall. Jetzt geht es zurück. Da vorne ist Licht, da geht es raus.
Kapitel 1
Wir wissen, was wir verändern müssen, tun es aber nicht
»ACH, AXEL, DU SETZT DAS JA EH NICHT UM. Wir haben schon so oft darüber gesprochen.« Meine Frau schaut mich verschmitzt aus ihren großen braunen Augen an. Sie sitzt mir gegenüber auf unserem Sofa und grinst mit einer Wonne, als hätte ich ihr einen Cappuccino mit Glühwein kredenzt. Sie hat ein sonniges Gemüt, doch ich fühle diesen harten Kern der Wahrheit. Ihre Aussage sitzt. Das Wort ist mächtiger als das Schwert. Es ist ein Stich mitten ins Herz, sie hat mich an meinem wundesten Punkt erwischt. Und noch viel schlimmer: Ich fühle mich ertappt. Eben war ich noch voller Zuversicht. Ich war zu ihr ins Wohnzimmer geeilt, um ihr zu sagen, dass nun endlich alles besser würde. Ich hatte einen Plan. Doch offenbar läuft gerade vor ihrem geistigen Auge ein Film aus der Vergangenheit ab. Die vielen Versprechen. Die neuen Anläufe. Immer wieder die Hoffnung, dass ich es endlich schaffen würde: mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für meinen Sohn … Das klingt so einfach und ist doch so schwer.
Ich rechne es ihr hoch an, dass sie ihren Humor noch nicht verloren hat. Sie hat ja so recht. So viele Vorsätze, so wenig Besserung. Aber ich mache das ja nicht aus böser Absicht. Ich stelle mich auch nicht jeden Morgen vor den Spiegel und sage mir mit Inbrunst: »So, heute setze ich mal wieder rein gar nichts um. Das wird ein Spaß. High five.« Es passiert einfach. So wie kürzlich, als ich zu meinem Sohn gesagt hatte: »Ich bin um halb vier unten.« Später erfahre ich von meiner Frau: »Der hat die ganze Zeit auf dich gewartet.« Oh ja. Mir fallen meine Sünden ein. Ich hatte das dann ganz vergessen. Ich war in einem Online-Meeting und es war noch dies und jenes zu tun. Und so tauchte ich erst eine Stunde später als ankündigt auf. Ich hätte ihm zumindest sagen können, dass es später wird. Dazu hätte ich nur einmal kurz die Treppe hinuntergehen müssen, denn mein Arbeitszimmer befindet sich im Obergeschoss und eine Etage darunter ist sein Zimmer. »Macht nichts, Digga«, kam es lässig über die Lippen meines pubertierenden Sohnes, als ich mich entschuldigte. Und schon war er wieder in den Sphären eines anderen Gedankens unterwegs. Doch selbst wenn er es offenbar leichtnahm, so schmerzte es mich doch.
Ganz zu schweigen davon, dass ich aufgrund meiner Arbeit zeitweilig tageweise unterwegs bin. Dann bin ich weg und nicht mal eben greifbar, wenn mein Sohn seinen Vater braucht. Es geht nicht um Stunden, die ich Zeit für ihn habe. Das würde ihn sogar nerven. Nein, es geht darum, präsent zu sein, wenn er gerade den Kontakt braucht und mir etwas erzählen möchte. Es wäre eigentlich so einfach, wenn ich ihm bestimmte Zeiten sagen würde, in denen ich voll und ganz für ihn da bin und er sich dann darauf verlassen kann. Klappt aber nicht. Intensive Arbeitstage kosten Energie. Ich bin danach leer. Deshalb brauche ich auch Abstand und Zeit für mich. Ich gehe deshalb zweimal die Woche ins Fitnessstudio. Doch wenn ich dann abends sage: »Ich bin dann mal weg zum Sport«, treffen mich die überraschten Blicke meiner Frau. Echt jetzt? Da schwingt diese Enttäuschung mit. Wieder keine Familienzeit.
Verdammt. Ich weiß, was ich ändern möchte. Ich nehme es mir auch immer wieder fest vor. Doch ich rutsche da immer wieder rein. Ich fühle mich ohnmächtig, geradezu hilflos. Ich habe es nicht im Griff. Ein scheußliches Gefühl.
Die Ohnmacht im Angesicht des Musters
Vielleicht kennst du solch ein Gefühl. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du dieses Buch in den Händen hältst. Du hoffst, genau davon loszukommen. Du möchtest endlich machen, was du dir so sehnlichst vorgenommen hast.
Nun, nachdem ich dir meine kleine Story erzählt habe, magst du dich vielleicht fragen: Wie soll der Autor mir helfen, wenn er selbst nicht dagegen gefeit ist? Ganz einfach: Weil die Botschaft ist, dass auch Psychologen wie ich keine Superhelden der Veränderung sind. Sie unterliegen denselben Mechanismen wie alle anderen Menschen auch. Doch mit einem kleinen Unterschied – ich habe durch meine Ausbildungen, meine langjährige Arbeit als Trainer und Coach und durch meine Forschung viel darüber gelernt, was dabei hilft, Gewohnheiten zu verändern. Dazu gehört auch anzuerkennen, dass manche Veränderungsthemen »Millimeterarbeit« sein können. Warum das so ist, erfährst du in diesem ersten Kapitel.
Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen kann ich aber auch nur zu gut verstehen, wie es anderen Menschen geht, die diese Ohnmacht erleben, wenn sie in den Sog unliebsamer oder sogar schädigender Denk- und Verhaltensmuster geraten. Das ist wie ein überdimensionaler Staubsauger, der einen gnadenlos in seinen Schlund zieht. Es gibt kein Entrinnen. Doch lass dir von mir sagen: Das ist normal. Du musst dich dafür nicht verurteilen. Wobei – nun ja, ich gebe zu, die Versuchung dazu ist schon da. Und manchmal gönne ich mir auch die neunschwänzige Peitsche, wenn ich mal wieder einen Rückschlag erlebt habe. Aber nur, wenn die nicht gerade zum Trocknen auf der Leine hängt. Spaß beiseite. Es ist bedrückend, wenn blitzschnell das volle Programm abläuft. Du bist wie ferngesteuert, obwohl du weißt, dass ein anderes Verhalten besser wäre. Die Gewohnheit erfasst dich wie ein vorbeifahrender Zug und reißt dich in den Abgrund. Und hinterher sitzt du da mit deinem schlechten Gewissen. Es ist wieder passiert. Du hast es wieder einmal nicht geschafft. Dabei ist dir doch völlig klar, dass du damit aufhören willst. Dir ist auch völlig klar, was du anders machen willst. Und dann passiert es doch noch einmal. Und täglich grüßt das Murmeltier – wie in der gleichnamigen Filmkomödie wiederholt sich die unangenehme Situation wieder und wieder. Was für ein Mist.
Dabei ist es ganz egal, um welche Gewohnheiten es sich handelt. Es sind die kleinen und die großen Dinge, die uns stören – sei es im Privat- oder im Berufsleben. Mal betrifft es nur uns selbst, mal auch den Umgang mit unseren Mitmenschen. Ein Blick in die Topliste der Silvestervorsätze offenbart fast jedes Jahr das gleiche Bild an Themen: mehr Geld sparen, mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren, mehr Zeit mit Familie beziehungsweise Freunden verbringen, abnehmen, weniger Stress bei der Arbeit oder mit dem Rauchen aufhören. Mittlerweile hat es auch das Thema »Mehr für die Umwelt beziehungsweise das Klima tun« auf die Liste geschafft. Wenn es um unliebsame Gewohnheiten geht, fallen den meisten von uns Verhaltensweisen ein, die unseren Lebensstil und unsere Gesundheit betreffen. Vielleicht, weil uns aus allen Ecken warnende Worte entgegenschallen. Weg mit dem Alkohol, weg mit den Zigaretten, weg mit hochverarbeiteten, industriellen Lebensmitteln und Fast Food!
Schön wäre es: Gesunde Gewohnheiten
Auch in der Welt der Wissenschaft ist das Interesse an einem gesunden Lebensstil groß, da die Art, wie wir leben, das Risiko birgt, uns vorzeitig ins Grab zu bringen. So warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit eindringlichen Prognosen, dass die Zahl der Krebserkrankungen weltweit bis 2050 rasant steigen wird – um bis zu 77 Prozent. Die Hauptursachen: Rauchen, Alkohol, Fettleibigkeit und Luftverschmutzung.1 Oft hören wir aber auch, dass unser Lebensstil das Risiko für Herzerkrankungen oder Diabetes erhöht. Schlechte Gewohnheiten sind todsicher unser Tod, wenn wir nichts dagegen tun. Und nicht nur das. Wenn wir alle krank sind, dann töten die ganzen Kosten obendrein noch unser Gesundheitssystem. Das ist schon eine schwere Kost. Zur Beruhigung habe ich mir gerade ein paar Chips geholt und knabbere die vor mich hin. Kauen beruhigt. Und ich brauche viel Beruhigung …
Doch Schluss mit dem Galgenhumor. Essgewohnheiten sind ein ernstes Thema, und vielleicht leidest du da auch an dir selbst – ähnlich wie Angelika, die ich eines Tages im Coaching habe. Sie will gerne ihr Gewicht reduzieren und Fettgewebe abbauen. Deshalb hat sie sich vorgenommen, als ersten Schritt abends nur noch Basenkost zu sich zu nehmen, also vor allem Gemüse und Obst, da diese Ernährungsform nicht nur die Pfunde purzeln lässt, sondern auch gut für den Säure-Basen-Haushalt des Körpers ist. Das klingt erst mal nicht nach Raketenwissenschaft. Einfach nur etwas anderes am Abend essen als sonst? Easy. Sie hat ein klares Ziel vor Augen, wie die neue Gewohnheit aussehen soll. Auf geht’s! Doch ihr natürlicher Feind ist das leckere Wurstbrot. Dieses knusprige, dunkle Holzofenbrot. Schon das Schmieren des Brotes ist ein Fest, wie sie mir erzählt. Wie es da vor ihr liegt. Wie sie die weiche Butter auf die Scheibe aufträgt. Dann kommt noch die herzhafte Hausmacherleberwurst darauf. Allein der Geruch. Sie spürt dann schon, wie ihr das Wasser im Munde zusammenläuft. Und dann der Biss in diese Köstlichkeit. Eine Explosion der Geschmacksknospen. Eine Serenade nach einem langen Arbeitstag.
Und wie geht es ihr, wenn dann das Brot in ihrem Magen verschwunden ist? »Ich fühle mich wohl, aber gleichzeitig ist da auch ein schlechtes Gewissen, es wieder einmal nicht geschafft zu haben«, erzählt sie mir mit einem Gesichtsausdruck, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. Und warum lässt sie es nicht einfach sein? »Es ist ja bequem, sich einfach ein Brot zu holen, an den Kühlschrank zu gehen und es mit Butter und Wurst zu bestreichen.« Und wie ein Mantra wiederholt sie es nochmal: »Es ist echt bequem.«
Während sie mir das erzählt, spüre ich den inneren Kampf, der in ihr tobt. Ihr ist klar, dass sie mehr Zeit in die Vorbereitung ihrer Mahlzeit investieren muss, wenn sie ihr Basenkost-Ziel erreichen will. Eine unschöne Erkenntnis. Sie rückt nachdenklich ihre Brille zurecht. Veränderung ist anstrengend. Und noch etwas fällt ihr auf: »Ein Wurstbrot hat sowas Belohnendes. Du hast es dir verdient nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag. Ich esse das total gerne«, schwelgt sie mit einem Lächeln. »Dieser Geschmack.« Sie ist entzückt. Längst hat sie mich mit ihrem Wurstbrot in ihren Bann gezogen. Mir läuft jetzt auch schon selbst das Wasser im Mund zusammen, wenn ich ihren Worten lausche. Sie könnte Werbung für Wurstbrote im Fernsehen machen. Ich würde ihr den ganzen Laden leer kaufen.
Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, wie gut Gewohnheiten in uns verankert sind und welche inneren Kämpfe wir durchleiden, wenn wir etwas anders machen wollen. Also keine Sorge, wenn du das bei dir auch erlebst. Du machst weder etwas falsch, noch bist du unfähig. Aus diesen inneren Konflikten herauszukommen, ist Teil des Prozesses, wenn du Gewohnheiten verändern willst.
Doch jetzt bin ich neugierig. Wie ist das eigentlich bei dir?
Boxenstopp
LEBENSSTIL UND GESUNDHEITSVERHALTEN
Bitte nimm dir einen Moment Zeit und überlege einmal, welche ungünstigen Gewohnheiten du hast, die deinen Lebensstil und deinen Umgang mit deiner Gesundheit betreffen. Im Folgenden nenne ich dir ein paar Themen zur Auswahl:
Was ist typisch für deine Ernährung? Welche Lebensmittel landen in deinem Einkaufskorb? Eher fett- und kalorienreiche beziehungsweise industriell verarbeitete Nahrungsmittel? Viel Obst und Gemüse? Greifst du gerne zu Fast Food?
Wie sind deine Essgewohnheiten? Isst du regelmäßig zu viel? Liebst du Süßigkeiten, Chips & Co? Hast du Übergewicht?
Wie sieht es mit Bewegung und Sport aus? Bewegst du dich gerne oder ist die sportliche Betätigung für dich ein Fremdwort?
Gehörst du zu den Menschen, die regelmäßig Alkohol trinken oder rauchen?
Putschst du dich mit bestimmten Mitteln wie Energydrinks auf?
Bist du jemand, der riskantes Verhalten an den Tag legt, wie z. B. Aktivitäten mit deutlich erhöhter Unfallgefahr, ausgiebiges Sonnenbaden, ungeschützter Sex mit verschiedenen Partnerinnen oder Partnern?
Sorgst du für ausreichend Pausen, Erholung und Schlaf, um deinen Akku wieder zu laden, oder stehst du unter permanentem Stress und Anspannung?
Gehst du zu Vorsorgeuntersuchungen für die Früherkennung von Krebserkrankungen?
Ziehe zum Schluss ein Fazit: Inwiefern gibt es bei deinem aktuellen Lebensstil beziehungsweise Gesundheitsverhalten ein Verhaltensmuster, das du auf jeden Fall ändern möchtest, weil es dir nicht guttut: …
Aber ungünstige Gewohnheiten können ja nicht nur den eigenen Lebensstil und die Gesundheit betreffen, sondern auch das Arbeitsleben. Aus meiner langjährigen Erfahrung als Trainer und Coach kann ich sagen, dass es da einiges gibt, was die eigene Leistung oder die Karriere behindert. Allerdings fällt das vielen überhaupt nicht auf. Vielleicht geht es dir auch so, wie es mir jemand mal sagte: »Ich bin in meinem Trott. Man reflektiert sich auch selten. Die Dinge schleichen sich einfach so ein.« Deshalb lade ich dich jetzt ein, mal über deine Arbeitsgewohnheiten nachzudenken.
Bad Habits in der Arbeit
Bei einer Arbeitswoche von 37,5 bis 40 Stunden hast du eine Menge Zeit für schlechte Gewohnheiten. Du weißt nicht, wovon ich rede? Frage mal deine Kolleginnen und Kollegen. Die können meistens ein Lied davon singen.
Eine Bekannte von uns arbeitet im Kundenservice und hat eine Kollegin, die die Königin der schlechten Schwingungen ist. Wo sie ist, wabert der schwarze Rauch der schlechten Laune. Die Arbeit ist blöd, die Kundinnen und Kunden sind doof, die Vorgesetzten sind Vollpfosten und die Kolleginnen und Kollegen verstehen nichts. Dass sie selbst mit ihrer Art und Weise der Schrecken des Großraumbüros ist, weiß sie nicht. Und es traut sich auch keiner, ihr das zu sagen. Dann würden nämlich die Bürostühle wackeln und die Zornesröte in ihr rundes Gesicht schießen, wie rot-lodernde Lavaströme aus einem Vulkan.
Doch hier geht es um ein anderes Thema, nämlich darum, dass es uns an der Offenheit und der Erkenntnis mangelt, wie wir mit unseren Gewohnheiten anecken oder uns das Leben schwermachen. Hier in diesem Buch bist du richtig, wenn bei dir das Problembewusstsein schon gereift ist und du ehrlich gewillt bist, Dinge anders zu machen. So wie Rainer, eine Führungskraft, Anfang 40, der sich bei mir mit einem Veränderungsthema meldete. Er kam zu mir, weil er unter einem zu hohen Arbeitspensum litt. Früh in die Arbeit, spät abends heim. »Das hat einen selbstausbeuterischen Charakter und ich merke, dass ich da gegensteuern muss.« Als ich mehr über seine Situation wissen wollte, sprudelte es aus ihm heraus: »Ich bin in zu vielen Einzelthemen drin. Ich delegiere auch viel zu zögerlich. Es gibt Punkte, da könnte ich abends auch einfach mal was liegenlassen. Aber das fällt mir schwer. Ich glaube, ich bin auch gewohnt, viel zu arbeiten. Ich mag es, gefragt zu werden, wie ich etwas sehe, und bringe auch Themen gerne voran, weil sie mich interessieren. Ich habe zudem die Ambition weiterzukommen und finde es gut, wenn ich Anerkennung für das erhalte, was ich erreiche.« Mir brummte schon beim Zuhören der Kopf. Die Intensität seines Arbeitspensums schwappte direkt zu mir herüber und mich wunderte nicht, dass er schlecht schlief und sich ausgelaugt fühlte. »Viele Sachen sind mir eigentlich schon klar. Ich müsste einfach besser delegieren und mit meinen Leuten die Aufgaben klar und ordentlich besprechen. Es muss nur umgesetzt werden«, schloss er schließlich seine Lagebeschreibung ab.
Ich habe in meinen Trainings und Coachings viel mit Führungskräften zu tun, und das Thema mangelnde Delegation ist ein echter Klassiker. Anstatt die Aufgaben abzugeben, machen die Chefs ganz viel selbst. Eine Bad Habit, wie sie im Buche steht. Schlechte Gewohnheiten im Job drehen sich typischerweise um die eigene Arbeitsweise, das Verhalten im Team oder den zwischenmenschlichen Kontakt und Umgangston. Ganze Heerscharen von Trainerinnen und Trainern sind unterwegs, um Menschen fit für die Arbeit zu machen und Verhaltensweisen auszubügeln, die sich nachteilig auf die Leistung und die Zusammenarbeit auswirken. Themen sind kundenorientiertes Verhalten, Führung, Verkauf, Konflikt- oder Zeitmanagement und vieles mehr. Wenn Menschen ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen und dafür Geld bekommen, sollen sie schließlich das Beste leisten.
Mit den verschiedenen Formen des Arbeitsverhaltens befasst sich die Arbeits- und Organisationspsychologie. Richtig üble Gewohnheiten sind unter dem Sammelbegriff »kontraproduktives Verhalten« zusammengefasst,2 also wenn sich jemand unzivilisiert verhält, mobbt, sabotiert, Schuld auf andere schiebt oder beschimpft. Aber die – sagen wir mal – ganz alltäglichen schlechten Gewohnheiten sind nicht Gegenstand der Forschung, wie ich bei meinen Recherchen feststellte. Zu dieser Einschätzung kommt auch die Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie Sabine Sonnentag von der Universität Mannheim.3 Sie bewertet dies als »schwerwiegendes Versäumnis«, da viele Gewohnheiten am Arbeitsplatz (z. B. häufiges Abrufen von E-Mails oder Aufgabenhopping) oft eng mit der tatsächlich zu erledigenden Arbeit verbunden sind und am Ende negative Folgen auf die Arbeitsleistung haben.
Und noch ein Punkt ist spannend, wenn du gerade mal über dich selbst und deine Arbeitsweise nachdenkst: Schlechte Angewohnheiten sind ein zweischneidiges Schwert. Ich hatte mal einen Coachee, der die »Politik der offenen Tür« pflegte. Jeder konnte also jederzeit bei ihm in sein Büro hereinplatzen und etwas von ihm wollen. Was gut bei den Kolleginnen und Kollegen ankam, bescherte ihm selbst Bauchschmerzen. Ständig musste er seine Aufgaben unterbrechen. »Ich komme zu keinem klaren Gedanken«, klagte er. Aus der Arbeitspsychologie ist bekannt, dass häufige Unterbrechungen Gift für die Arbeitsleistung sind und eine psychische Belastung darstellen.4,5,6 Kurzum: Für ihn war die Angewohnheit schlecht, für die Kolleginnen und Kollegen gut.
Nach der Recherche hat mich die Frage nicht mehr losgelassen, was es eigentlich alles an schlechten Arbeitsgewohnheiten gibt und welche Folgen sie haben. Und so schrieb ich dieses Thema für eine Abschlussarbeit an meiner Hochschule aus und freute mich riesig, als die Wirtschaftspsychologie-Studentin Maren Schultheiss7 Lust hatte, Licht ins Dunkel zu bringen. Für ihre Bachelorarbeit mit dem Titel »Die Kosten von Bad Habits in der Arbeit« hat sie Führungskräfte befragt und kommt zu der Erkenntnis, dass es nicht die eine spezielle Sorte von schlechten Gewohnheiten gibt, sondern dies auch immer im Auge der Betrachtenden liegt. Das erwähnte zweischneidige Schwert lässt also auch hier grüßen.
Ein großes Thema betrifft die ineffiziente Meeting-Kultur. Es sind Verhaltensweisen wie diese, die nerven: Meetings sind nicht vorbereitet, eine Agenda fehlt, Kolleginnen und Kollegen kommen unvorbereitet oder sagen bei Besprechungen weder zu noch ab. Durch ausgedehnte Wortbeiträge dauern Besprechungen länger als geplant oder am Ende kommt kein greifbares Ergebnis heraus. Weiterhin beklagen die befragten Führungskräfte bei ihren Mitarbeitenden zu lange Rauch- und Kaffeepausen, unangemessene Kleidung, egoistisches Handeln, mangelnde Teilnahme an Team-Events, fehlendes Interesse daran, was andere Abteilungen machen, einen unaufgeräumten Arbeitsplatz oder dass jemand einfach die Räume lüftet, ohne sich mit den Kolleginnen und Kollegen abzustimmen. Sicherlich alles Themen, die du auch kennst.
In ihrer Bachelorarbeit hat Maren Schultheiss dann gefragt, welche Auswirkungen die schlechten Gewohnheiten haben. Auch hier ist das Spektrum der Antworten groß. Was sich aber deutlich abzeichnet, ist, dass dadurch Zeit verloren geht, die die Mitarbeitenden für andere Aufgaben nutzen könnten. Wichtige Arbeiten bleiben liegen. Aber auch eine schlechte Außenwirkung und Imageschaden sind die Folgen. Bedenklich ist auch, wenn bestimmte Arbeitsgewohnheiten dazu führen, dass die anderen Teammitglieder unzufrieden oder sogar demotiviert sind und der Teamspirit verloren geht.
Und jetzt lade ich dich ein, dir mal zu deinen Arbeitsgewohnheiten bewusst ein paar Gedanken zu machen.
Boxenstopp
ARBEITSGEWOHNHEITEN UND DEREN AUSWIRKUNGEN
Überlege einmal, welche Arbeitsgewohnheiten du hast und welche Auswirkungen diese auf dich selbst, deine Kolleginnen und Kollegen oder auf den Erfolg deiner Firma haben. Im Folgenden ein paar Themen zur Auswahl:
Was nervt dich an dir und deiner Art, wie du deine Aufgaben erledigst? Neigst du zu Aufschieberitis? Hast du Probleme beim Zeitmanagement? Verzettelst du dich oder springst du von einer Aufgabe zu anderen?
Wie sieht die Qualität deiner Arbeit aus? Müssen andere für dich nacharbeiten? Machst du häufig Fehler? Hängst du zu lange an einer Aufgabe fest, weil du eine perfektionistische Ader hast?
Wie ist dein Kommunikationsverhalten? Sprichst du Themen an, die dich stören, oder vermeidest du Konflikte? Sprichst du vorwurfsvoll und beschuldigst gerne andere?
Wie ist dein Umgang mit Kundinnen und Kunden? Stellst du Fragen, um deren Bedarf genau zu erkunden, oder textest du sie zu? Eskalieren die Gespräche mit unzufriedenen Kundinnen und Kunden? Wirkst du freundlich und bemüht oder spüren sie eine »Ist-mir-doch-egal«-Haltung bei dir?
Wenn du deine Kolleginnen und Kollegen fragen würdest: Was für ein Feedback bekämst du? Was finden sie gut beziehungsweise welche Veränderungen in deinem Verhalten wünschten sie sich? Bist du ein Teamplayer oder eine Einzelkämpferin?
Wie ist dein Verhalten in Besprechungen? Leistest du Beiträge oder bleibst du lieber still, weil du dich nicht traust, deine Meinung zu sagen?
Welches Verhalten loben deine Vorgesetzten bei dir beziehungsweise wo sehen sie Verbesserungsbedarf?
Welche Gewohnheiten in deiner Arbeit betreffen Freunde und Familie? Machst du viele Überstunden? Arbeitest du daheim und die Arbeit hat immer Vorrang vor allem anderen? Kreisen deine Gedanken ständig um die Arbeit?
Welche Erkenntnisse hast du bereits in Schulungen gesammelt, die dir gezeigt haben, wie du dich in deiner Arbeit oder auf dem Karriereweg verbessern kannst?
Ziehe zum Schluss ein Fazit: Inwiefern gibt es bei deinen aktuellen Arbeitsgewohnheiten ein Verhaltensmuster, das du unbedingt ändern möchtest, weil es zu Nachteilen für dich führt? Welche Nachteile sind dies genau? Sorgt diese Arbeitsgewohnheit für Zeitverschwendung und macht dich oder deine Kolleginnen und Kollegen unproduktiv? Lässt sich in etwa beziffern, was die Gewohnheit an Geld kostet (z. B. wenn Fehler passieren)? Inwiefern schädigt dein Verhaltensmuster deinen guten Ruf? Hemmt dein Verhalten vielleicht sogar dein berufliches Vorankommen?
Durch den Boxenstopp ist dir vermutlich noch deutlicher bewusst geworden, dass wir mit unseren Arbeitsgewohnheiten nicht im luftleeren Raum sind. Die Art, wie wir arbeiten, bedeutet Wohl und Wehe für die Firma, die uns angestellt hat, sie berührt aber auch unser Privatleben, insbesondere wenn uns die Abgrenzung zwischen Arbeit und Familie nicht so gut gelingt. Doch wie ist das eigentlich, wenn du es noch ein Stück größer denkst?
Wir sind Zahnrädchen im großen Getriebe
»Hilfe, ich komme nicht von der Tube los!« Ja, ich muss es dir gestehen. Ich quetsche mit Begeisterung die Zahnpasta aus der Tube. Morgens und abends kommt sie auf die Zahnbürste. Wenn ich die schäumende Substanz im Mund spüre, habe ich das Gefühl, dass der Karies der Garaus gemacht wird. Ich fühle mich blitzblank und sauber. Leider ist das eine echt blöde Gewohnheit, was mir aber erst bewusst wurde, als ich einen Zeitungsartikel von Lea Hampel las.8 Davor griff ich ganz automatisch ins Regal des Supermarktes. Nichts Böses ahnend. Die Auswirkungen meiner Zahnhygiene-Gewohnheit auf uns alle hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Doch der Reihe nach. Das Thema Nachhaltigkeit ist seit etlichen Jahren in aller Munde. Es geht um den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen wie Wasser, Umweltschutz oder die Bekämpfung von Armut. Aber groß sich damit befassen, das tun die wenigsten. Oder kennst du die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung?9 Sie hat 2017 festgelegt, wie wir die Nachhaltigkeitsziele in Deutschland erreichen wollen, und hat aufbauend auf der Agenda 2030 dafür 169 Unterziele beschlossen.10 In diesem Zusammenhang gab es auch die Kampagne »Die Glorreichen 17«.11 Schon mal gehört, magst du jetzt denken. Aber Vorsicht. Ich spreche hier nicht von dem Film »Die glorreichen Sieben«. Das ist ein Western von 1960, in dem eine böse Banditenbande ein armes mexikanisches Dorf terrorisiert.
Zurück zur Zahnpastatube. Die erwähnte Autorin hat sich die Tube mit Zahnpasta ausgewählt, um die Zusammenhänge sichtbar zu machen, warum wir es mit der Nachhaltigkeit nicht hinbekommen. Der Tubenverbrauch ist laut ihrer Recherche allein von 2005 bis 2018 um 20 Prozent gestiegen. Sie schreibt: »Die Zahnpastatube ist vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner der umweltverschmutzenden Völker dieser Erde. Sie macht nur einen Bruchteil des globalen Mülls aus, und sie allein korrekt zu recyceln, wird die Welt sicher nicht retten. Aber wo, wenn nicht hier, sollte Umweltschutz beginnen?« Recht hat sie. Aber wo ist das Problem?
Das hat mit unseren Vorstellungen als Verbraucherinnen und Verbraucher zu tun und auch mit Qualitätskriterien, wie etwa den Anforderungen an das Mindesthaltbarkeitsdatum. Im Ergebnis haben wir eine Tube, die außen aus Plastik besteht und innen aus einer dünnen Schicht Aluminium. Für den Deckel braucht es noch einen anderen Kunststoff. Diese Gesamtkomposition ist nicht recycelbar. Also ab in die Müllverbrennung. Auch wenn es Ideen gibt, etwas an dieser Situation zu verbessern, so bleibt doch alles beim Alten. Denn der Autorin zufolge gibt es zu viele Stationen in der gesamten Kette von Produktion, Kauf bis Entsorgung, wo es einer Änderung und eines Umdenkens bedarf. Hier die gewohnten Routinen zu verändern, sei sowohl zu kosten- als auch zu zeitaufwendig. Aber halt mal. Im Prinzip ist die Lösung doch recht einfach: Wir könnten uns zurück zu den Wurzeln der Zahnreinigung begeben. Wir kaufen einfach Zahnpulver, etwa in Glasbehältnissen. Zahnpulver ist in seinen Ursprüngen schon seit Römerzeiten bekannt. Erst im Laufe der Zeit machte es den Wandel zur Zahnpasta in der Tube durch, den wir heute ausbaden müssen. Und während die Zahnpastatube im Jahr 185012 als Innovation gefeiert wurde, ist sie heute ein Symbol für eine müllproduzierende Gewohnheit. Die fällt bei uns als Einzelperson erst mal nicht so groß ins Gewicht, aber kollektiv gesehen richtet sie einen Riesenschaden an. Dabei ist ihr Anteil am Verpackungsmüll eher der Tropfen im Wasserfall – mehr noch: der Tropfen einer Sintflut von Verpackungsmüll, den wir produzieren. 237 Kilogramm Verpackungsmüll fallen in Deutschland jedes Jahr pro Kopf an, sagt das Statistische Bundesamt. Seit 2005 ist danach die Pro-Kopf-Menge an Verpackungsmüll um 26 Prozent gestiegen.13 Noch eindrucksvoller liest sich eine andere Zahl. Die Produktion von Plastik hat ihren Beginn Anfang der frühen 1950er-Jahre. Mittlerweile haben wir nach einer Hochrechnung von Forscherinnen und Forschern die Welt mit kaum vorstellbaren 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff beglückt. Das sind 822 000 Eiffeltürme.14 Ist schon irre, wenn ich mir das bewusst mache. Wie allein dieses eine Beispiel zeigt, macht es Sinn, dass wir unsere Gewohnheiten auch im Licht des großen Ganzen betrachten. Es sind ja nicht nur Verpackungsgewohnheiten, die uns ausmachen.
Ein anderes Thema betrifft unser Urlaubs- und Freizeitverhalten, zum Beispiel Ski- und Snowboardfahren. Ein Heidenspaß für alle, die gerne über die Pisten sausen, doch zugleich umweltschädlich und wenig nachhaltig. Sei es, dass die Natur- und Pflanzenwelt den Pisten weichen muss oder es zunehmend mehr Kunstschneepisten und energiefressende Schneekanonen15 braucht, weil der Schnee ausbleibt. Dennoch ist Deutschland nach den USA die zweitgrößte Skifahrernation der Welt und 14,6 Millionen Deutsche fahren zumindest gelegentlich Ski oder Snowboard.16
Und noch eine Gewohnheit ist geradezu selbstverständlich in unserer Gesellschaft: Wir sind ein Volk von Pendlerinnen und Pendlern. Laut dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung pendeln mehr als 20 Millionen Beschäftigte. Und die Zahl steigt seit Jahren.17 Dabei nutzen 62 Prozent der Pendelnden das eigene Auto, so eine bei Statista publizierte Umfrage.18 Diese Gewohnheit hat gleich zwei Folgen. Zum einen treibt jeder einzelne Autofahrer die klimaschädlichen CO2-Werte nach oben. Zum anderen ist Pendeln bei längeren Arbeitswegen auch ungesund. Autofahren zehrt an den Nerven der Pendler. Und je länger der Arbeitsweg und die Fahrzeit, umso häufiger treten eine Reihe körperlicher Beschwerden auf, wie Rücken- und Kopfschmerzen.19 Es lohnt sich also zu überlegen, ob es wirklich das Auto braucht. Wie sieht es bei dir aus? Sind öffentliche Verkehrsmittel vielleicht doch eine Option? Oder mehr Homeoffice? Oder das Fahrrad beziehungsweise E-Bike? Ich habe einen Kollegen, der die 15 Kilometer zur Arbeit mit dem Rad zurücklegt und sich so körperlich fit hält. Er nutzt dafür das Angebot des Dienstrad-Leasings.20
Wie toll wäre es, wenn wir uns selbst und damit auch unsere Gesellschaft von ungünstigen Gewohnheiten befreien könnten! Wir müssten nur unser Gehirn richtig bezirzen, damit es in die richtige Richtung läuft und wir bessere Gewohnheiten aufbauen. Allein und als Gesellschaft.
Mogelpackung Gehirn?
Ja, unser liebes Gehirn. Befassen wir uns doch mal mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie es für uns arbeitet. Zunächst mal lässt sich festhalten, dass die Summe unserer Gewohnheiten in unserem Gehirn verdrahtet ist. Wir besitzen ein Wunderwerk der Natur mit 100 Milliarden Nervenzellen. Wir haben im Prinzip eine unglaubliche Kapazität, Neues zu lernen, wie uns die Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler lehren. »Gehirnplastizität« heißt der Fachbegriff, der das Potenzial unseres Gehirns beschreibt, sich strukturell zu verändern und sich immer wieder an veränderte Bedingungen anzupassen.21 Wenn wir uns das vor Augen halten, kann es doch nicht so schwer sein, mal eben ein paar Gewohnheiten über Bord zu werfen. Was ist nur los mit uns – vielmehr mit unserem Gehirn und dessen Plastizität? Eine Mogelpackung? Die Hirnforscherinnen und Hirnforscher loben es in den höchsten Tönen, doch wenn du es nutzen willst, hat es gleich eine Funktionsstörung. Error – wieder keine Veränderung bei deinen Gewohnheiten geschafft.
Ich arbeite jetzt seit fast 30 Jahren als Trainer und Coach und habe zigtausend Menschen in Seminaren getroffen. Manche wurden von ihren Vorgesetzten geschickt, die hatten meist keine Lust und wollten auch nichts verändern. Schade. Doch unterm Strich sind mir mehr Menschen begegnet, die gewillt waren, Gelerntes umzusetzen. Sie hatten verstanden, welchen Nutzen es ihnen bringe würde, sich von bestimmten Gewohnheiten zu trennen, um mehr Erfolg zu haben. Ganz gleich, wie für sie Erfolg definiert war.
Als Trainer siehst du die Teilnehmenden mit leuchtenden Augen und vor Motivation sprühend aus dem Raum gehen. Sie wollen die Lernerkenntnisse gleich am nächsten Tag ausprobieren. Du kannst mir glauben, wie schön es ist, das zu sehen. Denn dafür trittst du als Trainer an. So geht es nicht nur mir, sondern sicherlich auch den meisten meiner Berufskolleginnen und -kollegen. Du räumst die Sachen im Seminarraum zusammen und packst alles ein. Die Eindrücke des Seminars laufen wie ein Film vor deinem geistigen Auge ab. Du bist noch mit Adrenalin vollgepumpt. Der Tag war anstrengend, du hast alles gegeben. Deine Leidenschaft ist es, Menschen bei ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Dafür brennst du. Und du denkst innerlich: »Yes! Mega-Tag.« Und dann gibt es die Momente, in denen ich meine Schützlinge zu einem Folgetraining wiedertreffe. Voll Vorfreude. Was die wohl alles umgesetzt haben? Ich schaue in die Runde. Glasige Blicke. Und schlichte Antworten: »War schwierig.« »Keine Zeit.« »Am Anfang habe ich noch dran gedacht.« Wenn meine Kinnlade nicht am Schädel festmontiert wäre, würde sie auf den Boden aufprallen. Zu Staub zerbersten. Wo ist die ganze Umsetzungsmotivation geblieben?
Das hat mich gefuchst. Ich möchte Effekte erzielen. Ich möchte, dass meine Arbeit einen hohen Nutzen bringt. Doch die Veränderung von Gewohnheiten ist die härteste Nuss, die wir zu knacken haben. Das weiß ich als Diplom-Psychologe, aber auch aus eigener Erfahrung, wie dir meine Geschichte zu Beginn des Kapitels zeigt. Das hinzunehmen, war für mich jedoch keine Option. Also stieß ich in Regionen der Forschung vor, die ich in meinem Studium nie gesehen hatte. Ich sammelte alles an Erkenntnissen ein, wie ein Eichhörnchen Nüsse für einen harten Winter bunkert. Meine Leitfrage war: Wie kann es wirksam und nachhaltig gelingen, dass Menschen die Verhaltensänderungen auch umsetzen, die sie sich vorgenommen haben? Die Befunde stammten aus Forschungen zum Lerntransfer, zum Erfolg von Therapie, der Verhaltensökonomie, der Sozialpsychologie. Ich wühlte mich durch Tonnen von Text – Literatur, die du vermutlich als Einschlafhilfe nutzen würdest. Und auch ich kämpfte mit Gähnkrämpfen. Doch es lohnte sich.
Und ich verspreche dir, es wird sich auch für dich lohnen, wenn du dieses Buch liest. Denn dieses ganze Wissen teile ich mit dir auf anschauliche und gut verdaubare Art und Weise. Dazu findest du außerdem immer wieder Fragen zur Selbstreflexion und Übungen, die dich auf ein neues Level der Veränderungswirksamkeit bringen.
Sei dir deiner Reize bewusst
Die Sirene heult. Es ist Samstag, 12 Uhr. Ich gehe gerade mit meiner Frau durch unseren Ort. Klar habe ich den Probealarm gehört, aber nur unterschwellig. Ich genieße den Spaziergang und die herrlichen Sonnenstrahlen. Bei meiner Frau löst der Ton jedoch etwas ganz anderes aus. »Die Sirene war für uns immer das Signal: Ab nach Hause zum Mittagessen. Für die Mama war das ganz praktisch. Sie musste uns nicht suchen.« Denn sie und ihre beiden Schwestern tobten in einem großen nahegelegenen Wald oder waren bei Freundinnen zum Spielen. Es gab keine Smartphones und auch keine Ortungsmöglichkeiten. Also kaum eine Chance für die Mutter, die Mädels schnell zu lokalisieren.