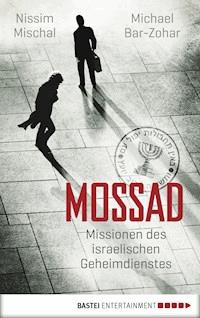
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kein Geheimdienst weltweit ist so bekannt, keiner so legendär und berüchtigt wie der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad. Gefeiert wurde er für das Aufspüren des Kriegsverbrechers Adolf Eichmann, kritisiert für die Ermordung eines marokkanischen Kellners als Vergeltung der Attentate von München 1972. Doch wie arbeitet der Mossad genau? Was sind seine Methoden?
Die israelischen Autoren Michael Bar-Zohar und Nissim Mischal zeigen ein Netz aus Spionage, Sabotage und Propaganda und sparen auch die zuletzt bekannt gewordenen Liquidierungen von hochrangigen iranischen Atomphysikern nicht aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Männer wie Eli Cohen, Isser Harel und Meir Dagan. Aktionen wie das Aufspüren des Kriegsverbrechers Adolf Eichmann, die Zerstörung eines syrischen Atomreaktors oder die Liquidation von hochrangigen iranischen Atomwissenschaftlern. Sie alle tragen das Siegel des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad. Dessen Aufgabe: Informationen bereitstellen, die für die Regierung, das Militär und die Sicherheit des Landes wichtig sein könnten. Bisweilen auch: Operationen im Auftrag der Regierung durchführen. »Der Mossad«, so schreiben es Michael Bar-Zohar und Nissim Mischal, »scheint die beste Verteidigung gegen die vom Iran ausgehende nukleare Bedrohung, gegen den Terrorismus, gegen jedwede Entwicklung infolge der Umwälzungen im Nahen Osten zu sein. Und vor allem ist der Mossad eines: das allerletzte Mittel vor dem offenen Krieg.« Effizient und nicht von Skrupeln geprägt.
Wo der Mossad aktiv war und ist, welche Zwischenfälle auf ihn zurückzuführen sind, aber auch, wo durch seine Operationen Angriffe auf israelische Interessen verhindert wurden – all das zeigen Bar-Zohar und Mischal in diesem Buch auf.
Ein aufschlussreicher Einblick in die Arbeit des meist im Verborgenen operierenden Geheimdienstes, ein spannendes Stück Zeitgeschichte
Über die Autoren
Michael Bar-Zohar ist Historiker, Politiker und Schriftsteller. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Hebräischen Universität Jerusalem und promovierte anschließend in Paris. In den 1980er-Jahren war er Abgeordneter des israelischen Parlaments. Daneben verfasste er zahlreiche Bücher, darunter die hochgelobte Biografie des Politikers David Ben Gurion und die von Schimon Peres.
Nissim Mischal gehört zu den führenden politischen Journalisten Israels. Nach dem Studium der Politikwissenschaft war er als Korrespondent für das israelische Staatsfernsehen in Washington tätig und ist inzwischen dessen Direktor. Mischal veröffentlichte diverse Bücher, unter anderem zur Geschichte Israels, und gewann zahlreiche journalistische Preise.
Michael Bar-Zohar und Nissim Mischal
Übersetzung aus dem Englischen von Katrin Harlaß
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe: »Mossad. The Greatest Missions of the Israeli Secret Service«
Originalverlag: ecco, HaperCollins, New York
Für die Originalausgabe: Copyright © 2012 by Michael Bar-Zohar und Nissim Mishal
Published by arrangement with Michael Bar-Zohar and MISHAL COMMUNICATIONS LTD.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Der Abdruck von Adolf Eichmanns Erklärung aus: Hannah Arendt: »Eichmann in Jerusalem«, Neuausgabe, Piper 1986 (S.287f.) erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Piper Verlags GmbH, München 2013.
Auszug aus: Anton Künzle & Gad Shimron (1999): »Der Tod des Henkers von Riga«. Gerlingen (Bleicher-Verlag), S.220f. © Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Psychosozial-Verlages, Gießen 2013.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2015 by Quadriga Verlag, Berlin in der Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Andrea Böltken, Berlin
Gesamtgestaltung: fuxbux, Berlin
Umschlagmotive: © iStockphoto/mevans; iStockphoto/MoreISO; iStockphoto/mementoil
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-1379-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Helden, nie besungen
Für Schlachten, nie erzählt
Für Bücher, nie geschrieben
Geheimnisse, nie preisgegeben
Und für einen Traum vom Frieden
Nie vergessen, niemals aufgegeben
Michael Bar-Zohar
Für Amy Korman
Für Rat,
Inspiration
und dafür, dass sie mir eine feste Stütze ist
Nissim Mischal
INHALT
Allein in der Höhle des Löwen
König der Schatten
Begräbnisse in Teheran
Eine Hinrichtung in Bagdad
Ein Maulwurf der Sowjets und eine Leiche auf See
»Das? Ach, das ist bloß Chruschtschows Rede ...«
»Bringt Eichmann her, tot oder lebendig!«
Wo ist Jossele?
Ein Naziheld in Diensten des Mossad
Unser Mann in Damaskus
»Ich will eine MiG-21!«
Die nie vergessen
Die Suche nach dem Roten Prinzen
Die syrischen Jungfrauen
»Heute gibt es Krieg«
Eine Sexfalle für den Atom-Spion
Saddams Superwaffe
Fiasko in Amman
Liebesgrüße aus Nordkorea
Liebe am Nachmittag
Kamera läuft
Aus dem Land der Königin von Saba
Krieg mit Iran?
Dank
Bibliografie und Quellen
Personenregister
EINLEITUNGAllein in der Höhle des Löwen
Am 12.November 2011 zerstörte eine gewaltige Explosion eine geheime Raketenbasis in der Nähe von Teheran. Siebzehn Angehörige der Revolutionären Garden wurden getötet, Dutzende Raketen verwandelten sich in einen Haufen geschmolzenen Stahls. General Hassan Tehrani Moghaddam, der »Vater« der Schihab-Langstreckenraketen und Leiter des iranischen Raketenprogramms, kam bei der Explosion ums Leben. Das geheime Ziel des Anschlags war jedoch nicht Moghaddam. Vielmehr galt er dem Antrieb einer Feststoffrakete, die in der Lage gewesen wäre, einen atomaren Sprengkopf fast 10000 Kilometer weit um den Globus zu tragen, direkt von den unterirdischen Atomsilos im Iran auf das Gebiet der USA.
Die neue von der iranischen Führung geplante Rakete sollte Amerikas Großstädte in Schutt und Asche legen und im gleichen Zug den Iran zu einer der führenden Weltmächte machen. Durch die Explosion im November wurde das Projekt allerdings um mehrere Monate zurückgeworfen.
Auch wenn die neue Langstreckenrakete sich gegen die Vereinigten Staaten richtete – für die Explosionen, welche die iranische Basis zerstörten, zeichnet aller Wahrscheinlichkeit nach der israelische Geheimdienst Mossad verantwortlich. Seit seiner Gründung vor mehr als sechzig Jahren steht der Mossad furchtlos und im Verborgenen im Dienst der Gefahrenabwehr für Israel und den Westen. Und mehr als jemals zuvor wirken sich die Informationsbeschaffung und die Durchführung verdeckter Operationen durch den Mossad auf die Sicherheit der Vereinigten Staaten aus, im In- wie im Ausland.
Gegenwärtig stellt sich der Mossad ausländischen Quellen zufolge der unverblümt und offen geäußerten Absicht der iranischen Führung entgegen, Israel von der Landkarte zu tilgen. Wie es heißt, kämpft er gegen die Bedrohung durch die atomare Aufrüstung Irans und deren Folgen für die Vereinigten Staaten und den Rest der Welt, indem er einen hartnäckigen Schattenkrieg gegen das Land führt, atomare Anlagen sabotiert, Wissenschaftler ermordet, Produktionsanlagen über Scheinfirmen mit fehlerhafter Ausrüstung und unbrauchbarem Rohmaterial beliefert, die Desertion hochrangiger Militärs und wichtiger Schlüsselfiguren der Nuklearforschung organisiert und bösartige Viren in die iranischen Computersysteme einschleust. Obgleich es dem Mossad gelungen ist, den Bau der iranischen Atombombe um mehrere Jahre zu verzögern, erreicht dieser Schattenkrieg derzeit seinen Höhepunkt. Der nächste Schritt wäre die Ultima Ratio: ein Militärschlag.
In seinem Kampf gegen den Terrorismus hat der Mossad seit den Siebzigerjahren eine ganze Reihe führender Terroristen in ihren Hochburgen in Beirut, Damaskus, Bagdad und Tunis sowie ihren Gefechtsstationen in Paris, Rom, Athen und auf Zypern gefangen genommen oder ausgeschaltet. Wie westliche Medien berichteten, waren es Agenten des Mossad, die am 12.Februar 2008 Imad Mughnija, dem militärischen Kopf der Hisbollah, in Damaskus auflauerten und ihn töteten. Mughnija war nicht nur ein Todfeind Israels, sondern führte auch die Liste der meistgesuchten Verbrecher des FBI an. Das Massaker an 241 US-Marines in Beirut am 23.Oktober 1983 hatte er geplant und ausgeführt. Hunderte tote oder verletzte Amerikaner, Israelis, Franzosen und Argentinier säumten seinen Weg. Gegenwärtig wird im gesamten Nahen Osten auf die Anführer des Islamischen Dschihad und des Terrornetzwerks al-Qaida Jagd gemacht.
Doch als der Mossad den Westen davor warnte, aus dem Arabischen Frühling könne ein Arabischer Winter werden, schien ihm niemand zuzuhören. Das ganze Jahr 2011 über feierte der Westen den vermeintlichen Anbruch einer neuen Ära der Demokratie, Freiheit und Menschenrechte im Nahen Osten. In der Hoffnung, die Zustimmung des ägyptischen Volkes zu erhalten, übte der Westen Druck auf Präsident Mubarak, seinen engsten Verbündeten in der arabischen Welt, aus, um ihn zum Rücktritt zu bewegen. Aber als die ersten Menschenmassen auf den Tahrir-Platz in Kairo strömten, verbrannten sie die Flagge der Vereinigten Staaten; später stürmten sie die israelische Botschaft, forderten ein Ende des Friedensvertrages mit Israel und stellten Aktivisten US-amerikanischer Nichtregierungsorganisationen unter Arrest. Die nachfolgenden freien Wahlen brachten die Muslimbruderschaft an die Macht, und heute taumelt Ägypten am Rand von Anarchie und wirtschaftlichem Zusammenbruch dahin. In Tunesien etabliert sich ein fundamentalistisches islamisches Regime, Libyen könnte folgen. Im Jemen herrscht das blanke Chaos. In Syrien massakriert Präsident Assad seine eigene Bevölkerung. Die gemäßigteren Staaten wie Marokko, Jordanien, Saudi-Arabien und die Emirate am Persischen Golf fühlen sich von ihren westlichen Verbündeten verraten. Und die Hoffnung auf die Durchsetzung von Menschenrechten im Allgemeinen und Frauenrechten im Besonderen, auf demokratisch legitimierte Gesetze und Regierungen, die diesen bahnbrechenden Revolutionen zugrunde lag, wurde von Parteien religiöser Fanatiker hinweggefegt, die besser organisiert sind und eine engere Verbindung zu den Massen haben als die Gemäßigten.
Dieser Arabische Winter hat den Nahen Osten in eine Zeitbombe verwandelt, die nicht nur Israel bedroht, sondern auch seine Alliierten im gesamten Westen. Und in seinem weiteren Verlauf werden die vom Mossad übernommenen Aufgaben immer gefährlicher und zugleich immer wichtiger für den Westen werden. Der Mossad scheint die beste Verteidigung gegen die vom Iran ausgehende nukleare Bedrohung, gegen den Terrorismus, gegen jedwede Entwicklung infolge der Umwälzungen im Nahen Osten zu sein. Und vor allem ist der Mossad eines: das allerletzte Mittel vor dem offenen Krieg.
Der Lebensnerv des Mossad sind seine namenlosen Krieger, jene Männer und Frauen, die ihr Leben riskieren, unter falscher Identität getrennt von ihren Familien leben, gewagte Einsätze in Feindesland durchführen, wo der kleinste Fehler Arrest, Folter oder Tod bedeuten kann. Das schlimmste Schicksal, das einen im Westen oder im Ostblock festgenommenen Geheimagenten während des Kalten Krieges erwartete, war der Austausch gegen einen anderen Agenten auf einer kalten, nebligen Brücke in Berlin. Ob Russe oder Amerikaner, Brite oder Ostdeutscher, der Agent wusste immer, dass er nicht allein war; irgendjemand würde ihn schon aus der Kälte zurückholen. Doch die einsamen Krieger des Mossad werden nicht ausgetauscht, für sie gibt es keine nebligen Brücken; sie bezahlen ihren Wagemut mit dem Leben.
In diesem Buch fördern wir die großartigsten Missionen und mutigsten Helden des Mossad ebenso zutage wie die Irrtümer und Fehlschläge, welche mehr als einmal den Ruf des Geheimdienstes beschädigten und ihn in seinen Grundfesten erschütterten. Diese Missionen waren nicht nur für das Schicksal Israels entscheidend, sondern in vielerlei Hinsicht auch für das der ganzen Welt. Die Agenten des Mossad aber verbindet vor allem eines: die tiefe, idealistische Liebe zu ihrem Land, die totale Hingabe an dessen Existenzberechtigung und Fortbestand, die Bereitschaft, dafür die höchsten Risiken einzugehen und sich den größten Gefahren zu stellen. Zum Wohle Israels.
KAPITEL 1König der Schatten
Im Spätsommer 1971 fegte ein wütender Sturm über das Mittelmeer hinweg, und riesige Wellen brandeten gegen die Küste von Gaza. Die einheimischen arabischen Fischer waren klug genug, an Land zu bleiben; an einem solchen Tag nahm man es mit der tückischen See nicht auf. Umso größer war ihr Erstaunen, als sie plötzlich ein klappriges Boot aus den brüllenden Wogen auftauchen sahen. Knirschend landete es auf dem nassen Strand. Heraus sprangen einige völlig durchnässte Palästinenser und wateten an Land. Ihre unrasierten Gesichter unter den klitschnassen Kufiyas, den Palästinensertüchern, zeigten jenen Ausdruck tiefer Müdigkeit, den eine lange Reise auf See hinterlässt. Doch sie hatten keine Zeit, sich auszuruhen – sie rannten um ihr Leben. Aus der schäumenden See hinter ihnen schoss ein israelisches Torpedoboot hervor und verfolgte sie mit Höchstgeschwindigkeit, an Bord Soldaten in voller Gefechtsausrüstung. Als es die Küste erreichte, sprangen die Männer ins flache Wasser und eröffneten sofort das Feuer auf die Flüchtigen. Ein paar Jugendliche aus Gaza, die am Strand spielten, rannten den Palästinensern entgegen und brachten sie in einem nahe gelegenen Obstgarten in Sicherheit; die israelischen Soldaten verloren ihre Spur, suchten jedoch weiterhin den Strand ab.
In dieser Nacht schlich sich ein junger Palästinenser, in der Hand eine Kalaschnikow, vorsichtig in den Garten und sah sich um. Er fand die Flüchtigen eng zusammengedrängt in einer abgelegenen Ecke. »Wer seid ihr, Brüder?«, fragte er sie.
»Mitglieder der Volksfront zur Befreiung Palästinas«, kam die Antwort, »aus dem Flüchtlingslager Tyros im Libanon.«
»Marhaba«, sagte der junge Bursche. »Willkommen.«
»Du kennst doch Abu Seif, unseren Kommandeur? Er hat uns hergeschickt. Wir sollen uns mit den Kommandeuren der Volksfront in Beit Lahia [einer Terroristenhochburg im südlichen Gazastreifen; d.Verf.] treffen. Wir haben Geld und Waffen, und wir wollen unsere Operationen koordinieren.«
»Ich werde euch dabei helfen«, erwiderte der junge Mann.
Am nächsten Morgen wurden die Neuankömmlinge von bewaffneten Terroristen zu einem abgelegenen Haus im Flüchtlingslager Dschabalija eskortiert. Man führte sie in einen großen Raum und bat sie an einen Tisch. Kurz darauf traten die Kommandeure der Volksfront ein, die sie dort zu treffen gehofft hatten. Nach einer herzlichen Begrüßung nahmen diese gegenüber ihren libanesischen Waffenbrüdern Platz.
»Können wir anfangen?«, fragte ein untersetzter junger Mann mit beginnender Glatze. Er trug eine rote Kufiya und war offensichtlich der Anführer der libanesischen Gruppe. »Sind alle da?«
»Alle.«
Der Libanese hob die Hand und sah auf seine Uhr. Das war das verabredete Signal. Blitzschnell zogen die »libanesischen Gesandten« ihre Revolver und eröffneten das Feuer. Es dauerte keine Minute, da waren die Terroristen aus Beit Lahia tot. Die »Libanesen« rannten aus dem Haus, bahnten sich einen Weg durch die gewundenen Lagergassen von Dschabalija und die überfüllten Straßen von Gaza und überquerten bald darauf die Grenze nach Israel. Noch am selben Abend unterrichtete der Mann mit der roten Kufiya, Hauptmann Meir Dagan, der die geheime Kommandoeinheit Rimon der israelischen Streitkräfte befehligte, General Ariel Scharon über den erfolgreichen Verlauf der Operation Chamäleon. Alle Anführer der Volksfront in Beit Lahia, einer äußerst gefährlichen Terrorgruppe, seien tot.
Dagan war erst 26 Jahre alt, verfügte jedoch bereits über einen legendären Ruf als Kämpfer. Er hatte die gesamte Operation geplant: die Verkleidung als libanesische Terroristen, die Fahrt über das Meer in einem alten Boot vom israelischen Hafen Aschdod aus, die lange Nacht im Versteck, das Treffen mit den Anführern der Terrorbande und den Fluchtweg nach Ausführung des Anschlags. Selbst die vorgetäuschte Verfolgung durch das israelische Torpedoboot hatte er organisiert. Dagan war der perfekte Guerillakämpfer, kühn und kreativ, keiner, der sich an die Regeln fairer Kriegsführung zu halten pflegte. »Meir«, sagte Jizchak Rabin einmal, »hat die einzigartige Gabe, sich Antiterror-Aktionen auszudenken, die einen an Actionfilme erinnern.«
Der spätere Mossad-Chef Danny Jatom erinnerte sich an Dagan als untersetzten jungen Burschen mit brauner Mähne, der sich für die prestigeträchtigste israelische Eliteeinheit, die Sajeret Matkal, beworben und dabei alle mit seiner hohen Kunstfertigkeit im Messerwerfen beeindruckt hatte. Er konnte mit seinem riesigen Kommandomesser jedes beliebige Ziel treffen, und zwar mit tödlicher Genauigkeit. Außerdem war er ein exzellenter Schütze. Trotzdem bestand er die Aufnahmeprüfungen für die Sajeret Matkal nicht und musste sich erst einmal mit den Silbernen Schwingen eines Fallschirmjägers begnügen.
Anfang der Siebzigerjahre wurde Dagan in den Gazastreifen geschickt, den Israel 1967 während des Sechstagekrieges erobert und der sich seitdem zu einem wahren Wespennest entwickelt hatte, von dem eine tödliche Bedrohung ausging. Tag für Tag ermordeten palästinensische Terroristen Israelis mit Bomben, Sprengstoff und Feuerwaffen, und zwar nicht nur im Gazastreifen, sondern auch in Israel selbst. Der Armee war die Kontrolle über die Flüchtlingslager, aus denen die Gewalt kam, beinahe vollständig entglitten. Am 2.Januar 1971 wurden die fünfjährige Abigail Arrojo und ihr Bruder Mark, acht Jahre alt, von einer Handgranate in Stücke gerissen, die ein Terrorist in das Auto der Familie geworfen hatte. An diesem Tag beschloss General Scharon, dass es ein Ende haben müsse mit dem blutigen Morden. Er rekrutierte ein paar alte kampferprobte Freunde aus seiner kriegerischen Jugendzeit sowie einige talentierte jüngere Soldaten, darunter Dagan. Der kleine, stämmige Offizier mit dem runden Gesicht hinkte, seit er im Sechstagekrieg auf eine Landmine getreten war. Während seines Genesungsurlaubs im Soroka-Hospital in Beerschewa hatte Dagan sich in Bina verliebt, seine Krankenschwester. Als er wieder gesund war, heirateten die beiden.
Offiziell existierte Scharons Elitetruppe nicht. Ihre Mission war die Vernichtung der Terrororganisationen in Gaza mithilfe hochriskanter und unkonventioneller Methoden. Dagan pflegte mit Gehstock und Dobermann, diversen Pistolen, Revolvern und Maschinenpistolen bewaffnet im besetzten Gaza umherzustreifen. Einige behaupteten, ihn als Araber verkleidet gesehen zu haben, der, lässig auf einem Esel sitzend, durch die gefährlichen dunklen Gassen geritten sei. Seine Versehrtheit minderte seine Entschlossenheit, auch die gefährlichsten Operationen selber durchzuführen, nicht im Geringsten. Für ihn war die Welt ganz einfach: Da gibt es Feinde, böse Araber, die uns töten wollen, also müssen wir sie zuerst töten.
Innerhalb der Elitetruppe schuf Dagan »Rimon«, die erste geheime israelische Kommandoeinheit, deren Mitglieder als Araber verkleidet tief in feindlichem Gebiet operierten, damit sie sich frei unter den Menschen bewegen und sich den Zielpersonen und -objekten unerkannt nähern konnten. Schnell hatte die Einheit ihren Spitznamen weg: »Ariks Killertruppe«. Es ging das Gerücht, die Männer würden gefangen genommene Terroristen oft kaltblütig töten. Manchmal, so munkelte man, eskortierten sie einen Terroristen in eine dunkle Gasse und sagten zu ihm: »Du hast genau zwei Minuten, um abzuhauen.« Versuchte der Gefangene dann tatsächlich zu fliehen, erschossen sie ihn. Ab und an, so hieß es, ließen sie auch einen Dolch oder Revolver liegen, und wenn der Terrorist danach griff, töteten sie ihn auf der Stelle. Journalisten schrieben, Dagan gehe jeden Morgen hinaus ins Freie, um sich zu erleichtern. Dabei benutze er eine Hand zum Pinkeln, während er mit der anderen auf eine leere Coca-Cola-Dose schieße. Dagan wies solche Berichte stets zurück. »An jedem von uns klebt so ein Mythos«, meinte er, »doch einiges, was da geschrieben wird, ist schlichtweg falsch.«
Die kleinen israelischen Kommandoeinheiten kämpften einen harten, grausamen Krieg, in dem sie tagtäglich ihr Leben aufs Spiel setzten. Beinahe jede Nacht verkleideten sich Dagans Leute als Frauen oder Fischer und machten sich auf die Suche nach bekannten Terroristen. Mitte Januar 1971 lockten sie, als arabische Terroristen auftretend, im Norden des Gazastreifens Mitglieder der Fatah in einen Hinterhalt. Es kam zu einem Schusswechsel, in dessen Verlauf alle Fatah-Terroristen getötet wurden. Am 29.Januar 1971 fuhren Dagan und seine Männer, diesmal uniformiert, in zwei Jeeps durch die Randgebiete des palästinensischen Flüchtlingslagers Dschabalija. Als ihr Weg den eines Taxis kreuzte, erkannte Dagan unter dessen Insassen Abu Nimer, einen berüchtigten Terroristen. Er gab Befehl anzuhalten, und seine Soldaten umstellten das Fahrzeug. Dagan näherte sich dem Wagen. In diesem Moment stieg Abu Nimer aus und hielt eine Handgranate hoch in die Luft. Den Blick unverwandt auf Dagan gerichtet, zog er den Sicherungsstift. »Handgranate!«, schrie Dagan, doch statt in Deckung zu gehen, sprang er den Mann an, warf ihn zu Boden, hielt ihn fest und riss ihm den Sprengkörper aus der Hand. Für diese Aktion bekam er die Tapferkeitsmedaille. Nachdem er die Granate weggeworfen hatte, soll Dagan Abu Nimer mit bloßen Händen getötet haben.
Dagan selbst sagte Jahre später in einem seiner seltenen Interviews zu dem israelischen Journalisten Ron Leshem: »Rimon war keine Killertruppe … Wir waren ja nicht im Wilden Westen, wo jedermann jederzeit fröhlich den Abzug betätigt. Wir taten weder Frauen noch Kindern jemals etwas zuleide … Die Menschen, die wir angriffen, waren brutale Mörder. Wir töteten sie und schreckten so andere ab. Um die Zivilbevölkerung zu schützen, muss ein Staat hin und wieder Dinge tun, die sich mit dem Vorgehen einer Demokratie nicht vereinbaren lassen. Es stimmt, dass sich in Einheiten wie unserer die Grenzen verwischen können. Ebendeshalb muss man sicher sein, dass man nur die allerbesten Leute nimmt. Die schmutzigste Arbeit sollte von den ehrlichsten Männern erledigt werden.«
Demokratisch oder nicht: Scharon, Dagan und ihren Kameraden gelang es, den Terrorismus in Gaza weitgehend zu zerschlagen. Auf Jahre hinaus wurde es in der Gegend still und friedlich. Manche behaupten hartnäckig, Scharon hätte einmal halb scherzhaft über seinen treuen Untergebenen gesagt: »Meirs Spezialität ist die Trennung eines Araberkopfes vom Körper.« Den echten Dagan kannten allerdings nur wenige. Er kam 1945 als Meir Hubermann in einem Vorort des ukrainischen Cherson in einem Eisenbahnwaggon zur Welt. Seine Familie befand sich auf der Flucht von Sibirien nach Polen. Die meisten seiner Verwandten waren im Holocaust umgekommen. Meir immigrierte mit seinen Eltern nach Israel, wo er in einem Armenviertel in Lod aufwuchs, einer alten arabischen Stadt etwa 15 Kilometer südöstlich von Tel Aviv. Viele kannten ihn als unbeugsamen Kämpfer; nur wenige wussten von seinen geheimen Leidenschaften: Der Vegetarier und begeisterte Leser von Geschichtsbüchern liebte klassische Musik und betrieb Malerei und Bildhauerei als Hobby.
Von Kindesbeinen an verfolgte Dagan das schreckliche Leid, das seiner Familie und dem jüdischen Volk im Holocaust widerfahren war. Und so widmete er sein Leben der Verteidigung des neu gegründeten Staates Israel. Schritt für Schritt machte er im Militär Karriere. Jedes Mal, wenn er ein neues Büro bezog, hängte er zuallererst ein großes Foto an die Wand. Es zeigte einen alten, in seinen Gebetsschal gehüllten Juden, der vor zwei deutschen Polizisten kniet. Der eine hält einen Knüppel, der andere ein Gewehr. »Dieser alte Mann ist mein Großvater«, pflegte er seinen Besuchern zu erklären. »Immer wenn ich mir dieses Foto ansehe, weiß ich, dass wir stark sein und uns verteidigen müssen, damit der Holocaust sich niemals wiederholt.«
Der alte Mann auf dem Foto ist Ber Ehrlich Sluschni und war in der Tat Dagans Großvater. Er wurde nur wenige Sekunden nach Entstehung der Aufnahme im polnischen Łuków ermordet.
Im Jahr 1973, während des Jom-Kippur-Krieges, war Dagan unter den ersten Israelis, die mit einer Aufklärungseinheit den Suezkanal überquerten. Während des Libanonkrieges 1982 traf er an der Spitze seiner Panzerbrigade in Beirut ein. Bald darauf wurde er Kommandeur der südlibanesischen Sicherheitszone, und ebendort kam unter der steifen Generalsuniform wieder der Guerillakämpfer zum Vorschein, der sich erneut die Prinzipien der Geheimhaltung, Tarnung und Irreführung aus der Zeit in Gaza zu eigen machte. Seine Soldaten gaben ihrem geheimniskrämerischen Chef einen neuen Namen: »König der Schatten«. Das Leben im Libanon mit all seinen Geheimbündnissen, Vertrauensbrüchen, Grausamkeiten und Schattengefechten war ganz nach Dagans Geschmack. »Noch ehe meine Panzerbrigade in Beirut einrückte«, sagte er einmal, »kannte ich diese Stadt genau.«
Seine geheimen Abenteuer gab er auch nach dem Ende des Libanonkrieges nicht auf. Mosche Levy, der damalige Chef des israelischen Generalstabs, erteilte Dagan 1984 einen offiziellen Verweis, weil dieser sich, als Araber verkleidet, in der Nähe des Terroristenhauptquartiers Bhamdun herumgetrieben hatte.
Als Dagan während der Intifada, des Palästinenseraufstands der Jahre 1987 bis 1993, als Berater von Generalstabschef Ehud Barak in das Westjordanland abkommandiert war, nahm er seine alten Gewohnheiten wieder auf und überredete Barak sogar, ihn zu begleiten. Die beiden zogen sich Trainingsanzüge über, wie es sich für echte Palästinenser gehört, beschafften sich einen himmelblauen Mercedes mit einheimischem Kennzeichen und machten einen Ausflug in die berüchtigte Kasbah von Nablus. Bei ihrer Rückkehr versetzten sie die Wachposten des militärischen Hauptquartiers in Angst und Schrecken, ehe diese erkannten, wer da auf dem Beifahrersitz saß.
1995 verließ Dagan die Armee im Rang eines Generalmajors und begab sich mit seinem alten Kumpel Yossi Ben-Hanan auf Reisen. Anderthalb Jahre wollten die beiden mit dem Motorrad die asiatischen Steppen durchqueren; sie brachen ihre Tour jedoch vorzeitig ab, als sie von der Ermordung Jizchak Rabins erfuhren. Nach seiner Rückkehr leitete Dagan eine Zeit lang die staatliche israelische Behörde für Terrorismusbekämpfung, unternahm einen halbherzigen Versuch, in der Geschäftswelt Fuß zu fassen, und unterstützte die Wahlkampagne von Scharon und dessen Likud-Block. Schließlich ging er in den Ruhestand und zog sich in sein Landhaus in Galiläa zurück, zu Büchern, Schallplatten, Malpalette und Bildhauermeißel.
Dreißig Jahre nach Gaza, als der General im Ruhestand gerade dabei war, sich mit seiner Familie bekannt zu machen – »Plötzlich wachte ich auf, und meine Kinder waren bereits erwachsen« –, bekam Dagan einen Anruf von seinem alten Kumpel Scharon. »Ich will dich an der Spitze des Mossad«, sagte der, mittlerweile Ministerpräsident, zu dem 57-Jährigen. »Ich brauche einen Geheimdienst-Chef mit einem Messer zwischen den Zähnen.«
Man schrieb das Jahr 2002, und dem Mossad schien die Luft auszugehen. Sein Prestige war durch diverse Fehlschläge in den Vorjahren erheblich angekratzt worden; das Scheitern des Mordanschlags auf ein führendes Mitglied der Hamas in Amman, das weltweit Schlagzeilen machte, und die Festnahme israelischer Agenten in Neuseeland, der Schweiz und auf Zypern hatten dem Ruf des israelischen Auslandsgeheimdienstes ernsthaft geschadet. Der letzte Chef des Mossad, Efraim Halevy, hatte die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen können. Der ehemalige Botschafter bei der Europäischen Union in Brüssel war zwar ein guter Diplomat und versierter Analytiker der politischen Verhältnisse, aber weder ein Anführer noch ein Kämpfer. Scharon wollte einen unerschrockenen, kreativen Macher an der Spitze des Mossad, jemanden, der als ernst zu nehmende Waffe gegen den islamischen Terrorismus und den iranischen Atomreaktor fungieren konnte.
Beim Mossad selbst empfing man Dagan nicht gerade mit offenen Armen. Er war ein Außenseiter, dessen Schwerpunkt auf der Durchführung von Operationen lag. Die fundierte Analyse geheimdienstlicher Informationen oder Geheimdiplomatie interessierten ihn dagegen kaum. Einige hochrangige Mossad-Offiziere stellten aus Protest ihren Posten zur Verfügung, doch Dagan kümmerte das wenig. Er baute die operativen Einheiten um, etablierte enge Arbeitsbeziehungen zu ausländischen Geheimdiensten und widmete sich insbesondere der Bedrohung durch den Iran. Als 2006 der verheerende Zweite Libanonkrieg ausbrach, widersprach Dagan als einziger israelischer Entscheidungsträger der offiziellen Strategie eines massiven Bombardements durch die israelische Luftwaffe. Er favorisierte eine Bodenoffensive und bezweifelte, dass die Luftstreitkräfte den Krieg gewinnen könnten. Damit ging er unbeschadet aus dem nachfolgenden Desaster hervor.
Die Presse kritisierte ihn trotzdem scharf, und zwar wegen seiner harten Haltung gegenüber Untergebenen. Frustrierte Mossad-Offiziere, die sich bereits im Ruhestand befanden, rannten den Medien mit ihren Beschwerden die Türen ein, und Dagan geriet unter Dauerbeschuss. »Dagan wer?«, witzelte ein bekannter Kolumnist.
Und dann, eines Tages, änderten sich die Überschriften schlagartig. In schmeichlerischen Artikeln, die von Superlativen nur so strotzten, wurde er plötzlich der »Mann, der die Ehre des Mossad wiederhergestellt hat«.
Denn unter Dagans Führung hatte der israelische Geheimdienst bis dato Unvorstellbares erreicht: die Ermordung des Hisbollah-Killers Imad Mughnija in Damaskus, die Zerstörung des syrischen Atomreaktors, die Liquidierung wichtiger Terroristenführer im Libanon und in Syrien sowie, vor allem, eine schonungslose, unerbittliche und erfolgreiche Kampagne gegen das geheime Atomwaffenprogramm des Iran.
KAPITEL 2Begräbnisse in Teheran
Am 23.Juli 2011 um 16:30 Uhr tauchten zwei Killer auf Motorrädern in der Straße Bani Hashem in Süd-Teheran auf, zogen automatische Waffen aus ihren Lederjacken, erschossen einen Mann, der gerade sein Haus betreten wollte, und verschwanden. Opfer des Anschlags war Dariusch Rezaie, 35 Jahre alt, Physikprofessor und eine Schlüsselfigur im geheimen Atomwaffenprogramm der iranischen Führung. Er war für die Entwicklung der elektronischen Schalter verantwortlich, die für die Zündung eines nuklearen Sprengkopfes benötigt werden.
Rezaie war nicht der erste iranische Wissenschaftler, der in jenen Tagen ein gewaltsames Ende fand. Offiziell hatte der Iran stets behauptet, die Entwicklung der Atomtechnologie ausschließlich für friedliche Zwecke zu betreiben, und als Beweis seiner guten Absichten den Reaktor in Buschehr angeführt, eine bedeutende, mit russischer Hilfe errichtete Anlage zur Energieversorgung. Doch darüber hinaus hatte man geheime Atomanlagen entdeckt, alle schwer bewacht und praktisch unzugänglich. Mit der Zeit musste der Iran zwar die Existenz einiger dieser Zentren zugeben, bestritt aber weiterhin konsequent, dass dort an Waffen gearbeitet werde. Allerdings waren westlichen Geheimdiensten und einheimischen Untergrundorganisationen zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere angesehene Wissenschaftler iranischer Universitäten bekannt, die man für den Bau der ersten iranischen Atombombe ausgewählt hatte. In dem Land tobte ein von »unbekannten Akteuren« geführter brutaler Krieg, um dem geheimen iranischen Atomwaffenprogramm ein Ende zu setzen.
Am 29.November 2010 tauchte morgens um 7:45 Uhr im Norden Teherans hinter dem Wagen von Dr.Madschid Schahriari, dem wissenschaftlichen Leiter des iranischen Atomprojekts, ein Motorrad auf. Als er den Wagen überholte, befestigte der durch einen Helm geschützte Fahrer etwas an dessen Heckscheibe. Sekunden später erfolgte eine Explosion. Sie tötete den 45 Jahre alten Physiker und verwundete dessen Ehefrau. Zur selben Zeit richtete ein Motorradfahrer im Süden der iranischen Hauptstadt dasselbe mit dem Peugeot 206 von Dr.Fereidun Abbassi Dawani, einem anderen führenden Atomwissenschaftler, an. Abbassi Dawani und seine Frau wurden bei dem Attentat verwundet. Die iranische Regierung machte umgehend den Mossad für die Anschläge verantwortlich.
Welche Rolle die beiden Wissenschaftler im Rahmen des iranischen Atomprogramms tatsächlich spielten, blieb geheim, doch Ali Akbar Salehi, der Leiter des Projekts, erklärte, das Attentat habe Schahriari zum Märtyrer gemacht und das Team seiner »kostbarsten Blume« beraubt.
Auch Präsident Ahmadinedschad brachte seine Wertschätzung für die beiden Opfer zum Ausdruck, und zwar auf äußerst raffinierte Weise: Als Abbassi Dawani von seinen Verletzungen genesen war, berief er ihn zum Vizepräsidenten.
Die Attentäter wurden nie gefunden.
Am Morgen des 12.Januar 2010 verließ Professor Massud Ali Mohammadi um 7:50 Uhr sein Haus in der Schariati-Straße im Stadtviertel Gheytarieh im Norden Teherans und machte sich auf den Weg zu seinem Labor an der Sharif Universität für Technologie.
Als er sein Auto aufschließen wollte, erschütterte eine gewaltige Explosion die friedliche Nachbarschaft. Den sofort herbeigeeilten Sicherheitsleuten bot sich ein schrecklicher Anblick: Die Detonation hatte Mohammadis Auto völlig zerstört und den Wissenschaftler in Stücke gerissen. Getötet hatte ihn ein Sprengkörper, der in einem neben seinem Auto geparkten Motorrad versteckt worden war. Die iranischen Medien schrieben den Mord umgehend Agenten des Mossad zu. »Dieser Mord«, erklärte Präsident Ahmadinedschad, »erinnert an zionistische Methoden.«
Der fünfzig Jahre alte Mohammadi war ein Experte auf dem Gebiet der Quantenphysik und Berater des iranischen Atomwaffenprogramms. Europäische Medien berichteten, er sei Mitglied der regierungsfreundlichen paramilitärischen Organisation Revolutionäre Garden gewesen. Doch sein Leben blieb so rätselhaft wie sein Tod. Mehrere seiner Freunde behaupteten steif und fest, er sei lediglich in theoretische Forschungen involviert gewesen, niemals in militärische Projekte; andere meinten außerdem, er habe Dissidentenbewegungen unterstützt und an Protesten gegen die Regierung teilgenommen.
Am Ende stellte sich heraus, dass beinahe die Hälfte der auf seinem Begräbnis anwesenden Trauergäste den Revolutionsgarden angehörte. Auch seine Sargträger, allesamt Offiziere, zählten dazu. Wie spätere Untersuchungen ergaben, war Mohammadi tatsächlich tief in die iranischen Atomambitionen verstrickt gewesen.
Im Januar 2007 starb Dr.Ardeschir Hosseinpour an einer radioaktiven Vergiftung, mutmaßlich umgebracht von Agenten des Mossad. Die Nachricht von seiner Ermordung brachte die Londoner Sunday Times, die Informationen von Stratfor, einer Denkfabrik für Strategie und Geopolitik mit Sitz in Texas, zitierte. Iranische Regierungsvertreter zogen den Bericht ins Lächerliche und behaupteten, der Mossad wäre niemals imstande, eine solche Operation mitten im Iran durchzuführen. Vielmehr sei »Professor Hosseinpour im Qualm eines Feuers erstickt, das bei ihm zu Hause ausgebrochen war«. Sie bestanden außerdem darauf, der 44-Jährige sei lediglich ein anerkannter Experte auf dem Gebiet des Elektromagnetismus und in keiner Weise in Atomprojekte eingebunden gewesen.
Dann jedoch stellte sich heraus, dass Hosseinpour in einer geheimen Anlage in Isfahan gearbeitet hatte, die Rohuran in Gas umwandelte. Dieses Gas wurde anschließend verwendet, um in Natanz, einer weit abgelegenen und schwer befestigten unterirdischen Anlage, mithilfe einer Zentrifugenkaskade Uran anzureichern. Im Jahr 2006 hatte Hosseinpour die höchste Auszeichnung des Iran auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie erhalten; zwei Jahre zuvor war ihm die höchste Auszeichnung des Landes für militärische Forschung verliehen worden.
Doch die Ermordung iranischer Atomwissenschaftler war nur ein Schachzug von vielen. Nach Berichten des Londoner Daily Telegraph hatte der Mossad unter Dagans Führung eine ganze Armada von Doppelagenten, Killertrupps, Saboteuren und Scheinfirmen in Stellung gebracht und über Jahre hinweg für verdeckte Operationen gegen das iranische Atomwaffenprogramm eingesetzt.
Laut Reva Bhalla, der Chefanalystin von Stratfor, konzentrierten sich die israelischen Geheimoperationen »mit Unterstützung aus den Vereinigten Staaten sowohl auf die Eliminierung von Schlüsselfiguren des Nuklearprogramms als auch auf die Sabotage der iranischen Lieferkette«. Im Irak, so Bhalla weiter, habe Israel in den frühen Achtzigerjahren eine ähnliche Taktik angewandt. Damals habe der Mossad drei irakische Atomwissenschaftler ermordet und so die Fertigstellung des Kernreaktors Osirak nahe Bagdad verzögert.
Durch seinen erklärten Krieg gegen das iranische Nuklearprogramm gelang es dem Mossad in der Tat, die Entwicklung der iranischen Atombombe so lange wie möglich hinauszuzögern und so die größte Gefahr zu vereiteln, der sich Israel jemals seit seiner Gründung ausgesetzt sah: Ahmadinedschads Drohung, den jüdischen Staat auszulöschen.
Die schlimmste Panne in seiner Geschichte konnte der Mossad durch diese kleinen Siege allerdings nicht wettmachen: das geheime iranische Atomprogramm erst aufzudecken, als es bereits zu spät war. Der Iran arbeitete bereits seit mehreren Jahren an seinem Aufstieg zur Atommacht – und Israel wusste von nichts. Der Iran investierte riesige Summen, warb Wissenschaftler an, errichtete geheime Anlagen, führte komplizierte Tests durch – und Israel hatte keine Ahnung. Von dem Moment an, als sich der Iran unter Ali Chamenei entschloss, eine Atommacht zu werden, hatte er die westlichen Geheimdienste, auch den Mossad, durch Täuschung, List und Tücke an der Nase herumgeführt.
Schah Resa Pahlewi hatte als Erster in den Siebzigerjahren den Bau zweier Atomreaktoren für friedliche wie militärische Zwecke ins Auge gefasst. Das Projekt löste damals in Israel keinerlei Beunruhigung aus; es war zu dieser Zeit ein enger Verbündeter des Iran. Im Jahr 1977 empfing der israelische Verteidigungsminister, General Eser Weizmann, den mit der Modernisierung der iranischen Armee betrauten General Hassan Toufanian im Verteidigungsministerium in Tel Aviv – als seinem Verbündeten lieferte Israel dem Iran moderne Militärausrüstung. Dem Protokoll ihres vertraulichen Treffens zufolge bot Weizmann an, dem Iran hochmoderne Boden-Boden-Raketen zu liefern, während Dr.Pinchas Zussman, der Generaldirektor des Ministeriums, Toufanian mit der Bemerkung beeindruckte, man könne die israelischen Raketen so umrüsten, dass sie in der Lage seien, atomare Sprengköpfe zu befördern. Doch ehe die Regierungsvertreter ihre Pläne in die Tat umsetzen konnten, veränderte die iranische Revolution die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nachhaltig. Die revolutionäre islamische Regierung massakrierte die Anhänger des Schahs und wandte sich gegen Israel. Ajatollah Chomeini und seine getreuen Mullahs übernahmen die Macht, während der kränkelnde Schah außer Landes floh.
Chomeini, der das Nuklearprogramm als »islamfeindlich« ansah, beendete es sofort. Der Bau der Reaktoren wurde gestoppt, die Anlagen wurden demontiert. Doch in den Achtzigerjahren brach zwischen dem Iran und seinem Nachbarn Irak ein blutiger Krieg aus. Saddam Hussein setzte Giftgas gegen die Iraner ein. Die Verwendung nicht konventioneller Waffen durch ihren ärgsten Feind bewog die Ajatollahs dazu, ihre Politik zu überdenken. Noch vor Chomeinis Tod wies dessen designierter Nachfolger Ali Chamenei das Militär an, neue Waffen zu entwickeln – biologische, chemische und nukleare –, um sich gegen die Massenvernichtungswaffen wehren zu können, die der Irak gegen das Land richtete. Bald darauf forderten willfährige Geistliche von ihren Kanzeln herunter die Aufhebung des Verbots »islamfeindlicher« Waffen.
Seit Mitte der Achtzigerjahre sickerten immer wieder bruchstückhafte Nachrichten über die iranischen Anstrengungen durch. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989 wurde Europa dann von Gerüchten geradezu überschwemmt, der Iran versuche verstärkt, mittels entlassener russischer Offiziere und darbender Wissenschaftler, die ehemals dem militärischen Establishment angehört hatten, in den Besitz von Atombomben und nuklearen Sprengköpfen zu gelangen. In dramatischen Details schilderte die westliche Presse das Verschwinden sowjetischer Wissenschaftler und Generäle, die von den Iranern rekrutiert worden seien. Mit blühender Fantasie gesegnete Reporter schilderten, wie verplombte Lastwagen unter Umgehung der Grenzkontrollen von Europa aus Richtung Naher Osten rasten. Laut Quellen in Teheran, Moskau und Peking hatte der Iran mit Russland ein Abkommen über den Bau eines Atomreaktors in Buschehr, an der Küste des Persischen Golfes, unterzeichnet sowie ein weiteres mit China über den Bau zweier kleinerer Reaktoren.
Alarmiert schickten die USA und Israel Teams von Spezialagenten durch ganz Europa, um die an den Iran verkauften sowjetischen Bomben und die angeworbenen Wissenschaftler aufzuspüren. Sie kamen alle mit leeren Händen zurück. Die Vereinigten Staaten übten starken Druck auf Russland und China aus, die Vereinbarungen mit dem Iran aufzukündigen. China gab nach und annullierte das Geschäft. Russland beschloss zwar weiterzumachen, verzögerte den Bau aber immer wieder. Bis zur Fertigstellung des Reaktors vergingen mehr als zwanzig Jahre, und seine Nutzung war durch strenge russische und internationale Kontrollen beschränkt.
Allerdings hätten Israel und die USA ihre Nachforschungen ausweiten sollen, als die Spuren kalt wurden. Den Chefs des Mossad wie der CIA war entgangen, dass es sich bei den russischen und chinesischen Reaktoren lediglich um Ablenkungsmanöver handelte, eine künstliche Nebelwand zur Abwehr der »weltbesten Geheimdienste«. Dahinter hatte der Iran in aller Stille ein Mammutprojekt gestartet, das ihn zur Atommacht machen sollte.
Im Herbst 1987 fand in Dubai ein geheimes Treffen statt. In einem kleinen, verstaubten Büro kamen acht Männer zusammen: drei Iraner, zwei Pakistaner und drei Experten aus Europa (darunter zwei aus Deutschland), die allesamt für den Iran arbeiteten.
Die Vertreter des Iran und Pakistans unterzeichneten eine geheime Vereinbarung. Den Pakistanern – genauer: Dr.Abdul Kadir Khan, dem Leiter des offiziellen pakistanischen Atomwaffenprogramms – wurde eine große Summe überwiesen.
Pakistan hatte einige Jahre zuvor sein eigenes Atomprojekt in Gang gesetzt, um militärisch mit seinem Erzfeind Indien gleichzuziehen. Dr.Khan brauchte dringend spaltbares Material für den Bau einer Atombombe. Er wollte jedoch nicht Plutonium verwenden, wie es in den klassischen Atomreaktoren gewonnen wird, sondern angereichertes Uran. Abgebautes Uranerz enthält lediglich knapp ein Prozent des für die Herstellung von Nuklearwaffen benötigten Isotops U-235. Die übrigen mehr als 99 Prozent bestehen aus wertlosem U-238. Khan entwickelte eine Methode, bei der natürlich vorkommendes Uran in Gas umgewandelt und dann in eine Reihe hintereinander angeordneter Zentrifugen, eine sogenannte Kaskade, geleitet wird. Während das Urangas in den Zentrifugen mit der irrsinnigen Geschwindigkeit von 100000 Umdrehungen pro Minute verwirbelt wird, trennt sich das leichtere Uran-235 vom schwereren Uran-238. Indem dieser Prozess tausendfach wiederholt wird, produzieren die Zentrifugen angereichertes Uran-235. Dieses Gas ergibt, wenn man es wieder in feste Materie umwandelt, genau jene Substanz, die man für den Bau einer Atombombe benötigt.
Khan hatte die Pläne für den Bau einer solchen Zentrifuge von Eurenco gestohlen, einer europäischen Firma, für die er in den frühen Siebzigerjahren gearbeitet hatte, und in Pakistan mit dem Bau eigener Zentrifugen begonnen. Khan entwickelte sich zu einem »Händler des Todes« und verkaufte sowohl seine Methode als auch die Formeln und Zentrifugen. Sein bester Kunde wurde der Iran; Libyen und Nordkorea zählten ebenfalls zu seinen Abnehmern.
Auch die Iraner kauften anderswo Zentrifugen und lernten, wie sie sie vor Ort herstellen konnten. Immer wieder trafen riesige Schiffsladungen mit Uran, Zentrifugen, elektronischem Material und Ersatzteilen im Iran ein. Ausgedehnte Anlagen zur Weiterverarbeitung von Rohuran, zur Unterbringung von Zentrifugen und zur Umwandlung von Gas zurück in festes Material wurden errichtet; iranische Wissenschaftler reisten nach Pakistan, pakistanische Experten in den Iran – und niemand bemerkte etwas.
Die Iraner achteten sehr sorgfältig darauf, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Sie verteilten ihr Atomprogramm auf zahlreiche Standorte im ganzen Land, auf Militärbasen, getarnte Labors und abgelegene Anlagen. Einige wurden tief unter der Erde errichtet und mit ganzen Batterien von Boden-Luft-Raketen gesichert. Ein Werk wurde in Isfahan gebaut, ein weiteres in Arak, das wichtigste von allen – die Zentrifugenanlage – in Natanz, ein viertes nahe der heiligen Stadt Ghom. Gab es auch nur den kleinsten Hinweis, dass ein Standort aufzufliegen drohte, wurden die atomaren Anlagen sofort verlegt; man trug sogar Erdschichten ab, von denen man vermutete, dass sie radioaktiv verstrahlt sein könnten. Darüber hinaus täuschte man die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA und führte sie geschickt in die Irre. Deren Leiter, der Ägypter Dr.Mohamed el-Baradei, agierte, als glaubte er jede einzelne der zahlreichen falschen Behauptungen vonseiten des Iran und veröffentlichte selbstgefällige Berichte, die es dem Land gestatteten, sein tödliches Projekt voranzutreiben.
Am 1.Juni 1988 wurde den US-amerikanischen Behörden zum ersten Mal das wahre Ausmaß der iranischen Anstrengungen bewusst. An jenem Tag tauchte beim FBI in New York ein pakistanischer Überläufer auf und bat um politisches Asyl. Er stellte sich als Dr.Iftikhar Khan Chaudhry vor und enthüllte den ganzen Umfang der geheimen Kooperation zwischen dem Iran und Pakistan. Er entlarvte Dr.Abdul Kadir Khan, machte detaillierte Angaben zu den Treffen, an denen er teilgenommen hatte, und nannte die Namen pakistanischer Experten, die am iranischen Projekt beteiligt waren.
Als das FBI die von Chaudhry genannten Zahlen und Fakten überprüfte, stellten sie sich als zutreffend heraus. Tatsächlich empfahl die Behörde sogar, seinem Ersuchen um politisches Asyl in den USA stattzugeben. Ansonsten aber blieb sein erstaunliches Geständnis folgenlos. Mag sein, dass es die pure Ignoranz war – jedenfalls ließ man auf höherer Regierungsebene Chaudhrys Vernehmungsprotokolle in den Akten verschwinden und unternahm gar nichts. Israel wurde nicht gewarnt. Weitere vier Jahre mussten ins Land gehen, bis die Wahrheit über den Iran endlich ans Licht kam.
Dann plötzlich, im August 2002, klärten die iranischen Volksmudschahedin (MEK), eine im Untergrund arbeitende Dissidentenorganisation, die Weltmedien über die Existenz der beiden nuklearen Anlagen in Arak und Natanz auf. In den folgenden Jahren machten die MEK immer mehr Fakten über das iranische Atomprogramm öffentlich, was hier und da den Verdacht aufkommen ließ, der Gruppe würden ihre Informationen von Dritten zugespielt. Die CIA blieb nach wie vor skeptisch und ging davon aus, Israel und Großbritannien würden auf diese Weise versuchen, die USA in gefährliche Operationen zu verwickeln. Insbesondere schien die CIA davon auszugehen, der Mossad und der britische MI6 würden die MEK mit geheimdienstlichen Informationen füttern und sich der iranischen Opposition als hoffentlich glaubwürdiger Quelle bedienen. Israelischen Quellen zufolge war es tatsächlich ein aufmerksamer Mossad-Offizier, der die riesige Zentrifugenanlage tief in der Wüste bei Natanz entdeckt hatte. Noch im selben Jahr 2002 übergab die iranische Untergrundbewegung der CIA ein Laptop, auf dem jede Menge Dokumente gespeichert waren. Die immer noch skeptischen Amerikaner hegten den Verdacht, die Unterlagen seien erst kürzlich eingescannt worden; sie beschuldigten den Mossad, Informationen aus eigenen Quellen daruntergemischt und sie dann den MEK übergeben zu haben, damit diese sie an den Westen weiterleiteten.
Doch auf den Schreibtischen der US-Amerikaner und Europäer stapelten sich inzwischen auch andere Beweise, sodass sie schließlich ihre Augen nicht länger verschließen konnten. Gerüchte über den lukrativen Handel Dr.Khans mit dem Tod verbreiteten sich über die ganze Welt. Schließlich erschien am 4.Februar 2004 ein in Tränen aufgelöster Dr.Khan im pakistanischen Fernsehen und gab öffentlich zu, in der Tat Know-how, Beratungsleistungen und Zentrifugen an Libyen, Nordkorea und den Iran verkauft und damit Millionen verdient zu haben. Die pakistanische Regierung beeilte sich, »Dr.Tod«, den Vater ihrer Atombombe, in vollem Umfang zu begnadigen.
Nun wurde Israel zu einer wichtigen Informationsquelle, was den Iran betraf. Meir Dagan und seine Behörde versorgten die US-Geheimdienste mit frischem Datenmaterial über die geheime Anlage der Iraner bei Ghom; auch hatte Israel vermutlich die Hand im Spiel, als mehrere hohe Offiziere der Revolutionsgarden sowie leitende Mitarbeiter des iranischen Atomprogramms in den Westen überliefen; außerdem hielt der Mossad diverse Staaten über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden und brachte sie so dazu, Schiffe zu beschlagnahmen, die in ihren Häfen lagen und atomare Ausrüstung für den Iran an Bord hatten.
Doch Sammeln geheimer Informationen allein würde nicht genügen. Ein fanatischer Iran drohte Israel offen mit Vernichtung, und der Rest der Welt scheute vor jeder energischen Reaktion zurück. Dem Land blieb daher nichts anderes übrig, als einen regelrechten Untergrundkrieg gegen das iranische Atomprogramm zu entfesseln.
Seine Vorgänger hatten das Problem sechzehn Jahre lang sträflich ignoriert. Dagan entschloss sich zum Handeln.
Im Januar 2006 zerschellte ein Flugzeug im Zentraliran. Bei dem Absturz kamen alle Passagiere ums Leben, darunter hochrangige Offiziere der Revolutionären Garden wie zum Beispiel Ahmad Kazemi, einer ihrer Kommandeure. Der Iran behauptete, schlechtes Wetter sei für den Absturz verantwortlich gewesen, doch die Stratfor-Gruppe deutete an, es habe sich um Sabotage durch westliche Agenten gehandelt.
Nur einen Monat zuvor war ein militärisches Transportflugzeug in ein Teheraner Wohnhaus gestürzt. Keiner der 94 Insassen überlebte. Auch in diesem Fall waren viele Revolutionsgardisten unter den Opfern, daneben einflussreiche regimefreundliche Journalisten. Im November 2006 stürzte in Teheran ein weiteres Militärflugzeug ab, dieses Mal beim Start – 36 Mitglieder der Revolutionären Garden wurden getötet. Der iranische Verteidigungsminister erklärte im staatlichen Rundfunk: »Geheimdienstinformationen zufolge können wir sagen, dass US-amerikanische, britische und israelische Agenten für diese Flugzeugabstürze verantwortlich sind.«
Dagan war mittlerweile, von der Öffentlichkeit unbemerkt, zum Hauptstrategen der israelischen Iranpolitik geworden. Am Ende, so fürchtete er, werde sein Land den Iran vielleicht tatsächlich offen und mit allen verfügbaren Kräften und Mitteln angreifen müssen. Doch das sollte wirklich der letzte Ausweg bleiben.
Die Sabotageakte begannen im Februar 2005. Die internationale Presse berichtete über eine Explosion in einer Atomanlage nahe Dialem, in die eine von einem unbekannten Flugzeug abgefeuerte Rakete eingeschlagen sei. Noch im selben Monat explodierte in der Nähe von Buschehr ein weiterer Sprengsatz in einer Pipeline, die den von den Russen gebauten Atomreaktor mit Gas versorgte.
Die Testanlage Parchin nahe Teheran wurde ebenfalls attackiert. Dort entwickelten iranische Experten die »Sprengstofflinse«, jenen Mechanismus, mit dessen Hilfe der Kern der Bombe in eine kritische Masse verwandelt und die Kettenreaktion für eine Atomexplosion ausgelöst wird. Behauptungen der iranischen Untergrundbewegung zufolge verursachte die Explosion ernste Schäden an den geheimen Labors.
Im April 2006 bildete das Allerheiligste – die zentrale Atomanlage in Natanz – den Rahmen für eine festliche Zusammenkunft. Tief unter der Erde, wo Tausende von Zentrifugen rund um die Uhr rotierten, versammelten sich eine große Schar von Wissenschaftlern und Technikern sowie die Leiter des Nuklearprogramms. Alle waren in Feierstimmung, denn sie waren gekommen, um die testweise Inbetriebnahme einer neuen Zentrifugenkaskade mitzuverfolgen. Gespannt wartete alles auf jenen Moment, in dem die Zentrifugen anspringen sollten. Der Chefingenieur drückte den Einschaltknopf – und eine mächtige Detonation erschütterte die riesige unterirdische Kammer. Mit einem ohrenbetäubenden Knall explodierten die Rohrleitungen, und die gesamte Kaskade flog in die Luft.
Außer sich vor Wut, ordneten die Chefs des Atomprogramms eine gründliche Untersuchung an. Offenbar hatten »unbekannte Personen« fehlerhafte Teile in die Anlage eingebaut. Der US-Nachrichtensender CBS berichtete, die Zentrifugen seien durch winzige Sprengladungen zerstört worden, die jemand kurz vor dem Testlauf angebracht habe. Der Sender behauptete weiterhin, israelische Geheimdienstleute hätten Agenten aus den USA bei der Vorbereitung des Anschlags in Natanz geholfen.
Im Januar 2007 wurden die Zentrifugen erneut zum Ziel einer geschickt eingefädelten Sabotage. Die westlichen Geheimdienste hatten in Osteuropa Scheinfirmen gegründet, die Isoliermaterial herstellten, wie es in den Rohrleitungsverbindungen zwischen den Zentrifugen verwendet wird – und das die Iraner aufgrund der von den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen auf dem freien Markt nicht erwerben konnten. Also wandte man sich an ebenjene Firmen in Osteuropa, die von Exil-Iranern und Exil-Russen geleitet wurden, welche insgeheim für die westlichen Dienste arbeiteten. Erst nach dem Einbau der Isolierung fanden die Iraner heraus, dass das gelieferte Material schadhaft war und nicht verwendbar.
Im Mai 2007 unterzeichnete George W.Bush einen geheimen Präsidentenerlass, der die CIA zu verdeckten Operationen ermächtigte, um das iranische Atomprojekt zu verzögern. Bald darauf entschlossen sich einige andere westliche Geheimdienste, den erforderlichen Nachschub von Teilen, Ausrüstung und Rohstoffen zu sabotieren. Im August traf sich Dagan mit dem Staatssekretär im US-Außenministerium Nicholas Burns, um seine Strategie im Umgang mit dem Iran zu besprechen.
Seit 2005 kam es in allen iranischen Anlagen immer wieder zu Pannen, Sabotage und Sprengstoffanschlägen. Eine rätselhafte Störung verursachte Probleme im Kühlsystem des Reaktors in Buschehr und verzögerte dessen Fertigstellung um zwei Jahre; im Mai 2008 fügte eine Explosion in einer Kosmetikfabrik in Arak der benachbarten Atomanlage ernste Schäden zu; eine andere Explosion verwüstete ein Hochsicherheitsgelände in Isfahan, wo Uran in Gas umgewandelt wurde.
In den Jahren 2008 und 2010 deckte die New York Times auf, dass die Tinners, eine Schweizer Ingenieursfamilie, der CIA geholfen hatten, die libyschen und iranischen Nuklearprogramme aufzudecken, und dafür von dem Geheimdienst zehn Millionen Dollar erhielten. Die CIA hatte außerdem dafür gesorgt, dass die Familie von strafrechtlichen Verfolgungen durch die Schweizer Behörden wegen des illegalen Handels mit nuklearen Bauteilen verschont blieb. Der Vater, Friedrich Tinner, und seine beiden Söhne, Urs und Marco, hatten den Iranern fehlerhafte Elektroinstallationen für die Anlage in Natanz verkauft. Fünfzig Zentrifugen wurden zerstört. Außerdem kauften die Tinners Druckpumpen von der deutschen Firma Pfeiffer Vacuum, ließen diese in Mexiko manipulieren und verkauften sie dann den Iranern.
Behauptungen der Zeitschrift Time zufolge war der Mossad in die Entführung der »Arctic Sea«involviert. Das Schiff war mit russischer Besatzung unter maltesischer Flagge von Finnland nach Algerien unterwegs, an Bord »eine Ladung Holz«. Am 24.Juli 2009, zwei Tage nach seinem Auslaufen, brachten acht Entführer den Frachter in ihre Gewalt. Erst einen Monat später erklärten russische Behörden, eine russische Kommandoeinheit habe das Schiff übernommen. Laut Berichten der London Times und des Daily Telegraph hatte der israelische Geheimdienst Alarm geschlagen. Dagans Männer, so behaupteten die Blätter übereinstimmend, hätten die Russen darüber informiert, dass das Schiff Uran geladen habe; ein ehemaliger russischer Offizier habe es den Iranern verkauft. Admiral Tarmo Kõuts wiederum, in der Europäischen Union zuständig für den Kampf gegen Piraterie, offerierte der Time eine ganz eigene Version. Die einzig plausible Erklärung, so meinte er, sei, dass der Mossad das Schiff entführt habe, um das Uran abzufangen.
Doch trotz all dieser Attacken blieben die Iraner nicht untätig. Unter strengster Geheimhaltung bauten sie in den Jahren von 2005 bis 2008 nahe der Stadt Ghom eine neue Anlage. In den unterirdischen Hallen sollten dreitausend Zentrifugen installiert werden. Allerdings mussten sie Mitte 2009 feststellen, dass die Geheimdienste der USA, Großbritanniens und Israels umfassend über das Werk informiert waren. Teheran reagierte umgehend. Im September 2009 überraschte der Iran die ganze Welt, als er die IAEA eilig über die Anlage in Kenntnis setzte. Einigen Quellen zufolge hatten die Iraner einen westlichen Agenten gefangen genommen (möglicherweise einen Spion des britischen MI6), der verlässliche Informationen über Ghom gesammelt hatte; also machten sie die Existenz der Anlage öffentlich, um die Peinlichkeit in Grenzen zu halten.
Einen Monat später sagte CIA-Chef Leon Panetta der Time, seine Organisation wüsste bereits seit drei Jahren von Ghom und Israel sei in die Entdeckung der Anlage involviert gewesen.
Die Enthüllungen über Ghom erlaubten einen kurzen Blick auf die heimliche Allianz, welche die drei am Kampf gegen den Iran beteiligten Gruppen geschmiedet hatten: die CIA, der MI6 und der Mossad. Nach französischen Angaben kooperierten die drei Geheimdienste, wobei der Mossad die Operationen im Inneren des Iran durchführte, während die CIA und der MI6 den Israelis halfen. Auf das Konto des Mossad gingen mehrere Explosionen im Oktober 2010, bei denen achtzehn iranische Techniker ums Leben kamen. Die Anschläge galten einem Werk im Zāgro-Gebirge, in dem Schihab-Raketen montiert wurden. Mithilfe seiner britischen und US-amerikanischen Verbündeten hatte der israelische Geheimdienst außerdem fünf Atomwissenschaftler eliminiert.
Diese Allianz war zum großen Teil auf Betreiben von Meir Dagan zustande gekommen. Von dem Moment an, als er Chef des Mossad wurde, hatte er immer wieder Druck auf seine Leute ausgeübt, eng mit ausländischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Seine engsten Mitarbeiter rieten ihm davon ab, geheime Informationen an Ausländer weiterzugeben, doch Dagan wies ihre Argumente zurück. »Hört auf mit diesem Unsinn«, grollte er. »Jetzt macht schon, arbeitet mit ihnen!«
Neben den Briten und den Amerikanern hatte Dagan einen weiteren wichtigen Verbündeten, der ihm wertvolle Informationen aus dem Iran liefern konnte: die Führung der iranischen Opposition. Auf ungewöhnlichen, außer Landes abgehaltenen Pressekonferenzen gaben Vertreter des Nationalen Widerstandsrates Iran den Namen des leitenden Wissenschaftlers des iranischen Atomprogramms preis, dessen Identität man bisher geheim gehalten hatte. Der 49-jährige Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi war Professor für Physik an der Universität Teheran und galt als rätselhafte, schwer durchschaubare Persönlichkeit. Die Oppositionsbewegung gab zahlreiche Details über ihn bekannt, so die Tatsache, dass er seit seinem achtzehnten Lebensjahr Mitglied der Revolutionsgarden war, seine Adresse (Schahid-Mahallati-Straße, Teheran), seine Passnummern (0009228 und 4229533), sogar seine private Telefonnummer (021-2448413). Fakhrizadehs Spezialgebiet war der komplexe Prozess zur Erzeugung einer kritischen Masse im Inneren des atomaren Sprengkörpers für das Auslösen der Kettenreaktion und damit der Atomexplosion. Sein Team arbeitete außerdem daran, die Bombe so stark zu verkleinern, dass sie in den Gefechtskopf einer Schihab-Rakete passte.
Nach diesen Enthüllungen verweigerten die Vereinigten Staaten und die EU Fakhrizadeh die Einreise, und seine Bankkonten im Westen wurden eingefroren. Die Widerstandsbewegung schilderte detailliert, welche Funktionen er bekleidete, nannte die Namen der Wissenschaftler, die mit ihm zusammenarbeiteten, und verriet sogar die Lage seiner geheimen Labors. Angesichts dieser Fülle an Einzelheiten sowie der Art, wie sie übermittelt wurden, ist man versucht zu glauben, dass auch hier wieder »ein gewisser Geheimdienst«, den der Westen seit jeher verdächtigte, seine eigenen Ziele zu verfolgen, diese Fakten mit peinlicher Genauigkeit gesammelt und der iranischen Opposition zugespielt hatte, damit diese sie an den Westen weitergab. Fakhrizadehs Enttarnung war als Warnung gedacht. Sie sollte ihm klarmachen, dass er womöglich der nächste Kandidat war, der auf der Todesliste stand, und ihn dazu bewegen, entweder abzutauchen oder sich für die bessere Lösung zu entscheiden: in den Westen überzulaufen.
Im Februar 2007 verschwand der ehemalige iranische Vize-Verteidigungsminister General Ali Resa Asgari während einer Reise nach Istanbul spurlos. Auch er war tief in das Atomprogramm verstrickt gewesen. Der iranische Geheimdienst suchte weltweit nach ihm, erfolglos. Fast vier Jahre später, im Januar 2011, wandte sich der iranische Außenminister Ali Akbar Salehi an den UN-Generalsekretär und beschuldigte den Mossad, Asgari verschleppt zu haben und in Israel gefangen zu halten.
Berichten der Londoner Sunday Times zufolge war Asgari jedoch in den Westen übergelaufen; der Mossad habe die Aktion geplant und dafür gesorgt, dass Asgari unbehelligt in der Türkei untertauchen konnte, so das Blatt. Andere Quellen behaupteten, er sei danach von der CIA befragt worden und hätte dem US-Geheimdienst wertvolle Informationen über das iranische Atomprogramm geliefert.
Im März 2007, einen Monat nach Asgaris Verschwinden, löste sich der nächste ranghohe iranische Offizier in Luft auf: Amir Schirasi. Er hatte bei »al-Quds« gedient, der mit geheimen Operationen jenseits der iranischen Grenzen betrauten Spezialeinheit der iranischen Revolutionsgarden. Eine iranische Quelle ließ die London Times wissen, dass außer Asgari und Schirasi ein weiterer hochrangiger Offizier verschwunden sei: der Kommandeur der Revolutionären Garden im Persischen Golf, Mohammad Soltani.
Im Juli 2009 tauchte mit Schahram Amiri ein weiterer Atomwissenschaftler auf der Liste der Überläufer auf. Er hatte in Ghom gearbeitet und verschwand während einer Pilgerreise nach Mekka in Saudi-Arabien. Der Iran forderte die Saudis auf herauszufinden, was mit ihm passiert war. Einige Monate später tauchte Amiri wieder auf – in den USA. Dort wurde er eingehend vernommen, bekam fünf Millionen Dollar und fand unter neuer Identität ein zweites Zuhause in Arizona. Gewährsleute der CIA gaben an, er sei seit Jahren Informant der westlichen Geheimdienste gewesen und habe diese mit »echten und substanziellen« Informationen versorgt. Amiris Enthüllungen zufolge diente die Technische Universität Malek-Asthar, an der er gelehrt hatte, als akademischer Deckmantel für eine Forschungsabteilung, die Sprengköpfe für iranische Langstreckenraketen entwickelte; geleitet wurde die Universität von Fakhrizadeh.
Nachdem er ein Jahr lang in Amerika gelebt hatte, änderte Amiri seine Meinung und beschloss, in den Iran zurückzukehren. Vermutlich war er dem Stress nicht gewachsen, den sein neues Leben mit sich brachte. In einem von ihm selbst aufgenommenen Video, das im Internet verbreitet wurde, behauptete er, die CIA hätte ihn entführt; einige Stunden später postete er ein zweites Video, in dem er die im ersten gemachten Aussagen widerrief, und dann stellte er ein drittes ein, in dem er das zweite widerrief. Er nahm Kontakt zur pakistanischen Botschaft auf, die die Interessen des Iran in den USA vertrat, und bat darum, in den Iran zurückgebracht zu werden. Die Pakistaner halfen ihm, und im Juli 2010 landete eine Maschine mit Amiri an Bord in Teheran. Er erschien auf einer Pressekonferenz, beschuldigte die CIA, ihn gekidnappt und misshandelt zu haben – und verschwand. Als Beobachter der CIA vorwarfen, das Ganze sei ein Fehlschlag gewesen, platzte einem Sprecher des Geheimdienstes der Kragen: »Wir haben wichtige Informationen bekommen und die Iraner Amiri. Also – wer hat das bessere Geschäft gemacht?«
Allerdings waren die Iraner dem Mossad gegenüber nicht vollkommen hilflos. Im Dezember 2004 hatte der Iran zehn Personen unter dem Verdacht der Spionage für Israel und die USA festgenommen; drei von ihnen arbeiteten in den iranischen Atomanlagen. 2008 gab das Land bekannt, man habe eine weitere Mossad-Zelle ausgehoben: drei iranische Staatsangehörige, die vom israelischen Geheimdienst im Umgang mit komplizierter Kommunikationsausrüstung, Waffen und Sprengstoff ausgebildet worden seien. Im November 2008 wurde Ali Aschtari gehängt, den man für schuldig befunden hatte, für Israel spioniert zu haben. Er hatte während seines Prozesses gestanden, in Europa drei Agenten des Mossad getroffen zu haben. Angeblich hatten diese ihm Geld und elektronische Ausrüstung übergeben. »Die Mossad-Leute verlangten von mir, speziell gekennzeichnete Lieferungen von Computern und elektronischen Geräten an den iranischen Geheimdienst zu verkaufen und Abhörgeräte in die Kommunikationsanlagen einzubauen, die ich verkaufte«, hatte Aschtari zu Protokoll gegeben.
Am 28.Dezember 2010 hängten iranische Offiziere im düsteren Innenhof des Evin-Gefängnisses in Teheran einen weiteren Spion, Ali-Akbar Siadat. Man hatte ihn für schuldig befunden, für den Mossad gearbeitet und diesen mit geheimen Informationen über die militärische Schlagkraft des Iran und das von den Revolutionsgarden betriebene Atomprogramm versorgt zu haben. Siadat hatte sich während der vergangenen sechs Jahre in der Türkei, Thailand und den Niederlanden mit israelischen Agenten getroffen und jeweils 3000 bis 7000 Dollar pro Begegnung erhalten. Die iranische Regierung machte unmissverständlich klar, dass weitere Verhaftungen und Hinrichtungen folgen würden.
Doch ausgerechnet 2010 erlitt das iranische Atomprogramm seinen größten Rückschlag. War er dem Mangel an qualitativ hochwertigen Ersatzteilen für die entsprechenden Anlagen zuzuschreiben? Den fehlerhaften Komponenten und minderwertigen Metallen, welche die Scheinfirmen des Mossad den Iranern verkauft hatten? Den abgestürzten Flugzeugen, den in Flammen aufgegangenen Labors, den Explosionen in den Raketenwerken und Atomanlagen? Den desertierten hochrangigen Regierungsbeamten und Führungsoffizieren, dem Tod von Topwissenschaftlern, den Revolten und Aufständen von Minderheiten im ganzen Land – all jenen Ereignissen und Phänomenen also, welche der Iran (mal fälschlich, mal nicht) Dagans Leuten zuschrieb?
Oder war Dagans letzter »großer Coup« dafür verantwortlich, wie die europäische Presse schrieb? Im Sommer 2010 wurden Tausende von Computern, die das iranische Atomprogramm steuerten, mit dem heimtückischen Stuxnet-Virus infiziert. Das Virus galt als eines der raffiniertesten weltweit. Es befiel die Computer, die die Zentrifugen in Natanz steuerten, und richtete immensen Schaden an. Seine komplexe Struktur ließ keinen Zweifel daran, dass ein großes Expertenteam damit befasst gewesen sein und es enorme Summen gekostet haben musste. Zu seinen herausragenden Merkmalen zählte, dass das Virus gezielt auf bestimmte Systeme angesetzt werden konnte, auf seinem Weg dorthin jedoch keinerlei Schaden anrichtete. Zudem war es auf einem Computer nur äußerst schwer zu entdecken. Einmal im iranischen System angekommen, war es in der Lage, die Rotationsgeschwindigkeit der Zentrifugen zu beeinflussen und so deren Endprodukt nutzlos zu machen, ohne dass es jemandem auffiel. Beobachter brachten die Namen zweier Staaten ins Spiel, welche über die Fähigkeiten und die Mittel verfügten, ein solches Cyber-Virus zu erschaffen: die USA und Israel.
Präsident Ahmadinedschad versuchte, Stuxnets Auswirkungen herunterzuspielen, und erklärte, der Iran habe die Lage unter Kontrolle. Tatsache war jedoch, dass zu Beginn des Jahres 2011 etwa die Hälfte aller iranischen Zentrifugen stillstand.
Offenbar waren es Dagans Leute, die das iranische Atomprogramm durch ihre permanenten Attacken an zahlreichen Fronten über so viele Jahre hinweg entscheidend verzögerten. Da gab es diplomatischen Druck und Sanktionen durch den UN-Sicherheitsrat; Gegen-Proliferation, um zu verhindern, dass der Iran die für den Bau einer Bombe benötigten Materialien erhielt; Wirtschaftskrieg, indem die Banken in der freien Welt an Geschäften mit dem Iran gehindert wurden; den Versuch, einen Regimewechsel durch das Anheizen und Unterstützen politischer Unruhen sowie das Schüren der im Iran schwelenden ethnischen Konflikte zwischen Kurden, Aserbaidschanern, Belutschen, Arabern und Turkmenen herbeizuführen, die zusammen mehr als 50 Prozent der Bevölkerung stellen, außerdem Aktionen mit ganz unmittelbarer Wirkung: direkt gegen das iranische Atomprojekt gerichtete verdeckte Einsätze, Geheim- und Spezialoperationen.
Allerdings gelang es Dagans Leuten bei aller Cleverness und Unterstützung nicht, das Programm dauerhaft zu stoppen. »Dagan ist der ultimative James Bond«, bemerkte ein hochstehender israelischer Experte, doch nicht einmal James Bond wäre in diesem Fall imstande, die Welt zu retten. Er könnte die Iraner höchstens behindern. Nur eine iranische Regierungsentscheidung oder eine massive Attacke von außen können dem Traum des iranischen Regimes ein Ende bereiten, dort, wo sich einst das Persische Reich erhob, einen gewaltigen Atomgiganten zu erschaffen.
Doch immerhin: Als Dagan zum ramsad ernannt wurde (ramsad steht für rosh hamossad – Chef des Mossad), sagten Experten voraus, der Iran würde 2005 über Atomkraft verfügen. Dieses Datum wurde später erst auf 2007 korrigiert, dann auf 2009, dann auf 2011. Als Dagan am 6.Januar 2011 in den Ruhestand trat, hatte er eine Botschaft für sein Land: Das iranische Atomprogramm hat sich bis mindestens 2015 verzögert. Aus diesem Grund empfahl er eine Fortsetzung seiner Strategie, die sich in den vergangenen acht Jahren als so effektiv erwiesen hatte, und sprach sich für das Einfrieren jeglicher Pläne zu einem offenen militärischen Angriff auf das Land aus. Erst wenn die Klinge des Messers in unser Fleisch zu schneiden beginne, so Dagan, sollten wir angreifen. Bis dahin habe man noch vier Jahre Zeit.
Dagan diente achteinhalb Jahre als ramsad – länger als die meisten seiner Vorgänger. Sein Nachfolger wurde Tamir Pardo, ein altgedienter Offizier des Mossad, der seine Karriere im operativen Einsatz als enger Vertrauter von Joni Netanjahu begonnen hatte, dem Helden der israelischen Operation Entebbe in Uganda 1976, bei der überwiegend jüdische Geiseln aus der Hand arabischer und deutscher Terroristen befreit wurden. Später hatte er sich vor allem als draufgängerischer Agent ausgezeichnet, als Experte für die neuen Technologien und als kreativer Kopf bei der Planung von ungewöhnlichen Operationen.
Bei seiner Amtsübergabe an Pardo sprach Dagan von der schrecklichen Einsamkeit jener Mossad-Agenten, die auf feindlichem Gebiet operieren, wo sie sich niemandem anvertrauen können, wo es niemanden gibt, der sie im Notfall rettet. Er gestand auch ganz offen eigene Fehler ein, von denen die erfolglose Suche nach dem Ort, an dem die Hamas den israelischen Soldaten Gilad Schalit gefangen hielt, den sie fünf Jahre zuvor verschleppt hatte, am schwersten wog. Doch ungeachtet solcher Rückschläge ist Dagan aufgrund seiner Erfolge bis heute der beste ramsad aller Zeiten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dankte ihm »im Namen des gesamten jüdischen Volkes« und umarmte ihn herzlich. Das gesamte Kabinett erhob sich spontan und applaudierte dem 65-Jährigen – ein nie dagewesener Vorgang. George W.Bush übermittelte seine Wertschätzung in einem persönlichen Brief.
Doch den wichtigsten Tribut zollte Dagan eine ausländische Quelle. Die ägyptische Tageszeitung al-Ahram, bekannt für ihre bösartigen und feindseligen Kommentare gegen Israel, veröffentlichte bereits ein Jahr zuvor, am 16.Januar 2010, einen Artikel des bekannten Autors Aschraf Abu al-Houl. »Ohne Dagan«, hieß es darin, »wäre das iranische Nuklearprogramm bereits seit Jahren fertiggestellt … Die Iraner wissen, wer hinter dem Tod des Atomwissenschaftlers Massud Ali





























