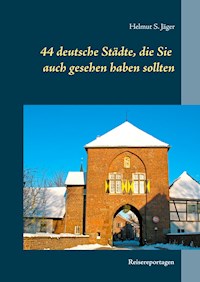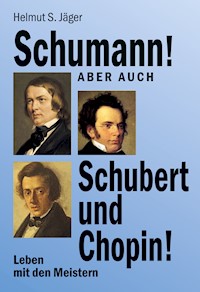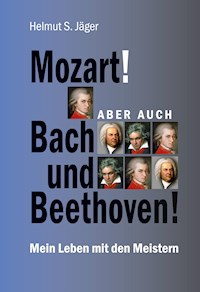
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Mein Lieblingskomponist? Den kenne ich nicht. Es gibt Schönes bei jedem Komponisten! Der Musikhörer, der Sänger, der Instrumentalist beschäftigt sich mit Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin usw. - und lernt sie dann lieben. Mit Friedrich Gulda bin ich einig: "Bach, Mozart, Beethoven sind einfach die Größten", sagte er in einer TV-Dokumentation. Daher schreibe ich ein Buch über die Großen der Musik, die mich schon als Kind und als junger Mensch berührten, begeisterten und die bis heute ohne merkliches Nachlassen in meinem Denken und Fühlen, vor allem aber im eigenen Musizieren bei mir sind. Weil sie einen wichtigen Teil meines Lebens bestimmten und beeinflussten. Musik hat mich nie losgelassen - und ich will sie nicht los lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Schreibe, was du siehst und hörst!
(Scivias, Hildegard von Bingen)
Berichterstatter will ich sein. Von einer
Reise, die mich fasziniert. Von Welten, die
mich bereichert haben.
(Ingo Metzmacher, Dirigent)
In dankbarer Erinnerung an meine Eltern und an
meine wichtigsten Lehrer:
Bernd Allenstein, Olpe, Klavier und Orgel
Karl Kretschmer, Olpe (Chor- und Orchesterdirigent)
Eckart Sellheim, Köln, Klavier
Inhalt
Inhalt
Einleitung
Mozart
Klavierwerke
Werke für Klavier zu 4 Händen
Klavier-Kammermusik
Klavierkonzerte
Kammermusik – „Man hört vier vernünftige Leute sich untereinander unterhalten“
Die ganz große Kunst – Sinfonien
Weitere Orchesterwerke
Kirchenmusik
Opern
Chorwerke, Konzertarien, Lieder und Kanons
Sonstige Werke
Bach
Klavier- und Cembalowerke
Das „Alte Testament“ der Klaviermusik
Unsterbliche Orgelmusik
Solowerke für Violine und Violoncello
Kammermusik
Konzerte
Ouvertüren (Orchester-Suiten
)
Magnificat, Passionen, Oratorien
Messen
Motetten
Kantaten
Lieder und Arien
Beethoven
Einzelne Klavierstücke und Variationen
Das „Neue Testament“ der Klaviermusik
Werke für Klavier zu 4 Händen
Klavierkonzerte
Klavier-Kammermusik
Kammermusik ohne Klavier
Die Meisterwerke – Neun Sinfonien
Weitere Orchesterwerke
Kirchenmusik
Opern und Bühnenmusiken
Weltliche Chorwerke, Lieder und Kanos
Epilog, Dank und Literatur
Einleitung
Als ich noch Lehrer war, fragten meine Schüler mich hin und wieder nach meiner Lieblingsgruppe, nach meinem Lieblings-Sänger oder meinem Lieblings-Komponist. Dann gab ich oft eine Verlegenheits-Antwort. Heute sage ich: Lieblingskomponist? – nein: Es gibt Schönes bei jedem Komponisten! Der Musikhörer, der Sänger, der Instrumentalist beschäftigt sich mit Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin usw. – und lernt sie dann lieben.
Mit Friedrich Gulda bin ich einig: „Bach, Mozart, Beethoven sind einfach die Größten“, sagte er in einer TV-Dokumentation. Daher schreibe ich ein Buch über die Großen der Musik, die mich schon als Kind und als junger Mensch berührten, begeisterten und bis heute ohne merkliches Nachlassen in meinem Denken und Fühlen, vor allem aber im eigenen Musizieren bei mir sind. Weil sie einen wichtigen Teil meines Lebens bestimmten und beeinflussten. Musik hat mich nie losgelassen – und ich will sie nicht los lassen.
Meine Eltern haben mir den Weg zum Klavier- und zum Orgelspielen ermöglicht. Sie haben mir auch das Musikstudium vorfinanziert. Sie waren zudem Vorbilder: Vater und Mutter sangen gerne, tanzten gerne spontan zusammen. Mein Vater spielte ganz gut Mandoline, weniger gut Geige und Mundharmonika, aber mit viel Leidenschaft. Bernd Allenstein, der umtriebige Kirchenmusiker in der Kreisstadt Olpe, war mein erster Klavier- und Orgellehrer. Bei ihm lernte ich auch die Grundlagen der Musiktheorie. Bis ins hohe Alter lud er mich ein, am Klavier mit ihm vierhändig zu spielen. Und er war auch mit 90 noch recht kritisch mit mir!
Karl Kretschmer war lange Jahre der einzige Musiklehrer am Städtischen Gymnasium in Olpe; sein besonderer Einfluss auf mich zeigte sich aber noch mehr in unzähligen Chorproben im Kirchenchor und im städtischen Oratorienchor. Er legte den Grundstein dafür, dass ich als Erwachsener fast 40 Jahre gerne Chorleiter in Kirche und Schule war. Seine Aufführungen bestimmter Werke (Johannespassion, Schöpfung, Deutsches Requiem) waren für mich die erste, unvergessene Begegnung mit der großen Chorliteratur. Eckart Sellheim, später Professor in Tempe (USA), war ein junger Klavierdozent an der Musikhochschule Köln, als ich ihm als Student zugeteilt wurde. Etwa zwei Jahre trainierte er mich, zeigte mir die Lücken in meiner Klaviertechnik; vor allem aber brachte er mich zum effektiven Üben und das so nachhaltig, dass ich noch heute an ihn denke, wenn ich etwas Neues am Klavier einstudieren will.
Mozart – Klavierwerke
Im Leben muss Harmonie sein.
Ihr Wohlklang soll alles Tun und
Verhalten durchdringen.
(Mahatma Gandhi)
„Mozart ist der perfekte Komponist, es ist alles auf den Punkt geschrieben und man hört alles bei Mozart!“ So sagte es sinngemäß der Dirigent Philippe Jordan in einem Dokumentarfilm. Ich stimme ihm zu. Es gab eine Zeit, da ging ich unvoreingenommen, ja unbekümmert an das Spiel von Mozarts Sonaten und Variationen. Eines meiner ersten Mozart-Erlebnisse dieser Art waren die Variationen über „Ah, vous dirai-je, Maman“, KV 265. Ich war vielleicht 15 oder 16 Jahre alt. Da wurde ich gefragt, ob ich zur Weihnachtsfeier eines Blindenvereins passende Klaviermusik spielen könne. Ich sagte zu; es war eine der ersten in einer langen Reihe von privaten oder offiziellen Anfragen, für Geburtstage, Feiern und Vernissagen zu spielen.
Bei der Vorbereitung überlegte ich, welche Musik geeignet wäre. Ich kannte Händels Wassermusik ganz gut, weil ich die Langspielplatte mit Lorin Maazel als eine meiner ersten für 5 DM erworben hatte – und oft gehört hatte. Aus dem Gedächtnis notierte ich mir einige Melodiefetzen, die mir gefielen und von denen ich annahm, dass sie im Vortrag ankommen würden. Aus ihnen entwickelte ich eine Folge von Abschnitten aus der Händel-Suite. Dafür bekam ich freundlichen Beifall.
Und zu Händel nahm ich Mozart hinzu. Schon vor vielen Monaten hatte ich einige seiner Variationen gespielt, und das ganz für mich allein, ohne meinen Klavierlehrer zu informieren. Nun studierte ich den kompletten Zyklus „Ah, vous dirai-je, Maman“ und musste mich sehr auf die virtuosen Takte konzentrieren. In dieser Zeit, vor dem Auftritt, vernachlässigte ich meine sonstigen Aufgaben und übte sehr viel. Beim Vortrag gelang es mir wohl, alle 12 Variationen fast fehlerfrei zu spielen. Unvergesslich bleiben mir die Reaktionen der blinden Zuhörer. Sie kamen zu mir und lobten Details meiner Ausführung. Einige erwiesen sich als Kenner der Materie. Seitdem weiß ich um das feine Gehör blinder Menschen. Ich konnte noch einige Jahre diese Weihnachtsfeiern gestalten, und das mit viel Freude.
Schon das Thema, eine einfache, dreiteilige Melodie aus Frankreich, hat Mozart meisterhaft mit einem natürlich klingenden, einstimmigen Bass versehen. Wenn die Basstöne der Melodie im Terzabstand folgen, wirkt die Harmonie, die entsteht, „wie auf den Punkt gebracht“. Und sein System ist so einfach, gleichsam ein Musterbeispiel für die Erfindung eines „richtigen“ Basses. Das ist so genial, dass Mozart das Gerüst der Basstöne in fast allen Variationen durchhalten kann. So kann der Hörer neben dem Neuen, den Überraschungen, immer wieder auf etwas Bekanntes zurückgreifen.
In der 1. Variation habe ich mich immer auf das Laufen, das Perlen der rechten Hand gefreut. Diese Freude wiederholte sich später bei den Sonaten und den Klavierkonzerten Mozarts. Ich stelle mir vor, dass Mozart selbst als Interpret dieser Werke durch Geläufigkeit sowie durch Erfindungsgabe glänzte. Die 2. Variation verlagert die Sechzehntel in die linke Hand. So bildet Mozart hier ein Paar, das durch die rhythmische Gestaltung der beiden Hände zusammen gehört; dies wiederholt er in den Variationen 3 und 4 sinngemäß, aber mit Triolen. Zu den schnellen Noten der linken Hand erklingen erstmals zwei- und dreistimmige Akkorde. Hier, in der rechten Hand, erfindet Mozart eine Nebenmelodie, die sich erst nach einer Viertelnote auflöst. Dadurch ergeben sich die ersten deutlich wahrnehmbaren Dissonanzen in der sonst sehr harmonischen Akkordkette. Für den Spieler stellt sich die Aufgabe, die Dissonanz entweder zu betonen oder leichthin zu „überspielen“. Bei jeder Ausführung könnte es etwas anders klingen. Das ist ein schöner Gedanke.
Die letzten fünf Takte der 2. Variation zeigen Mozarts Talent, eine Wiederholung ganz dezent, quasi improvisatorisch abzuwandeln. Mit der Oberstimme g-fis-f-e kommt die erste Chromatik in dieses Werk. Sie wird durch verminderte Akkorde noch verstärkt. Ist hier ein Anklang an barocke Rhetorik zu hören? Für gerade einmal zwei Sekunden hat eine „schmerzliche“ Figur Oberhand, und schon geht es – wie gehabt – in die Kadenz.
Ich habe dieses Werk einmal auf einem Cembalo gespielt. Dabei merkte ich, wie die schnellen Umspielungen der Haupttöne (in Variation 2, linke Hand) ganz anders als auf dem modernen Flügel klingen. Es tut gut, für diese Variationen probeweise das Instrument zu wechseln, sei es zum Cembalo, Klavichord oder Hammerflügel.
Variation 3 bringt in der rechten Hand erstmals Triolen (die danach in Variation 4 links auftauchen). Elegant wechselt Mozart zwischen gebrochenen Akkorden, Tonleitern und Umspielungen. So durchmisst er in der rechten Hand einen großen Tonraum: Vom c1 bis zum e3. Auch leicht hingetupfte Chromatik taucht auf. In Variation 4 kehren die zweibis dreistimmigen Akkorde wieder, auch diesmal von Dissonanzen durchsetzt. Die Triolen der linken Hand reichen bis zum Kontra-F hinunter; das ist exakt der tiefste Ton seines letzten Hammerflügels (gebaut von Anton Walter, Wien, erworben um 1782, Tonumfang fünf Oktaven vom F1 bis zum f3; 61 Tasten; heute im Besitz der Stiftung Mozarteum Salzburg).
Die nächste Variation zeigt eine völlig neue Idee. Rechte und linke Hand wechseln sich regelmäßig ab. Erstaunlich, wie Mozart dieses Prinzip bis zum Schlusston durchführt. Leichte Tupfer in einem punktierten Rhythmus, zunehmende Bewegung und zarte Chromatik kennzeichnen diesen leisen und flüchtigen Abschnitt.
Variation 6 stellt für mich stets eine Herausforderung dar. Im ersten Teil darf die linke Hand Triller und Läufe in Sechzehntel produzieren; sie sollten geläufig, aber eben auch leise sein. Denn sind die Staccato-Akkorde der rechten Hand nicht wichtiger? Nach 8 Takten kehrt Mozart den Rhythmus um: Rechte Hand Läufe, linke Hand dreistimmige Akkorde. Danach folgt eine exakte Wiederholung des ersten Abschnitts.
Nun kommen noch vier schnelle Variationen, bevor das obligatorische Adagio erklingt. Eine davon ist eine köstliche Moll-Variation, die erstmals Polyphonie einbringt. In den sukzessiven Einsätzen von Oberstimme, Mittelstimme, Unterstimme glaube ich zu hören, wie Mozart an barocken Vorbildern geschult war. Das Stück beginnt mit den fünf Tönen der C-moll-Tonleiter. Ich glaube, Mozarts Orchester-Thema aus der Zauberflöte zu hören, bevor die zwei „Geharnischten“ singen, eine „schreitende“ Melodie. Hier, im Klavierstück, eher ein Laufen! Nach 8 Takten wird die Musik in jeder Stimme chromatischer. Bis zu vier Stimmen führt Mozart jetzt meisterhaft, fast dramatisch, zu einer Reprise, die die ersten 8 Takte leicht verziert wiederholt. Die darauf folgende Variation ist für mich eines der schönsten Mozart-Klavierstücke überhaupt. Ein leiser, einstimmiger Einsatz ist der Beginn eines konsequent vierstimmigen Satzes. Köstlich, wie Mozart hier mit den verschiedenen Lagen spielt: Sopran, Alt, Tenor, Bass. Und all das mit minimalem Tongebrauch. Das ist typisch – und meisterhaft!
Nach einer Bravour-Variation mit übergreifender linker Hand startet Variation 11 im Adagio als Kanon, ähnlich kontrapunktisch wie Nr. 8 und Nr. 9. Ab Takt 5 wird die Oberstimme sehr verziert. Der zweite Abschnitt hingegen ist ganz homophon und führt zu zwei kurzen Fermaten, bevor die Reprise beginnt. Überraschend wechselt Mozart in der schnellen Schlussvariation (Nr. 12) in den 3/4-Takt. Pianistisch sehr fordernd sind die Trillerketten: Am Anfang in der linken Hand allein, ab Takt 9 in beiden Händen parallel geführt. Eine Coda von 11 Takten schließt sich an und führt zu einem fulminanten vollgriffigen Schluss.
Wie in den meisten seiner 17 Variationswerke erfüllt Mozart auch hier die Norm; andererseits überrascht er mit schönen Details, mit Verzierungen, Kontrapunktik, mit Aufwertung der linken Hand. Für mich ist es nach wie vor ein Meisterwerk.
Nun erst einmal zurück in Mozarts Kindheit. Der Vater Leopold begann mit der Ausbildung des Vierjährigen am Klavier, und gleich im nächsten Jahr begann das Kind Wolfgang zu komponieren. Ein Heft aus dem Möseler-Verlag liegt mir vor: „Klaviermusik des jungen Mozart“. Auf 60 Seiten stehen alle frühen Klavierstücke und Skizzen, eine Auswahl aus KV 1 bis 25. Ich schaue nur einmal auf das Menuett in G-Dur, KV 1, komponiert im Dezember 1761, Mozart war also knapp 6 Jahre alt. Franzpeter Goebels nennt das Menuett „brav“; ja, soll es denn frech sein? Fröhlich kommt das Hauptmotiv daher, mit großen Sprüngen. Es ist eine wahre Freude, nur die ersten Takte zu hören oder zu spielen. Bis acht Takte vorbei sind, nutzt Mozart den Motivkopf fünfmal und landet schulgerecht auf der Dominante D. Noch viermal ist der Motivkopf zu hören, dann sind 16 Takte beendet. Das Trio steht in C-Dur und bringt neue Melodien, vor allem aber eine Überraschung in Sechzehnteln. Sechsmal müssen die Hände eine schnelle Tonleiter spielen, davon viermal in beiden Händen parallel. Wenn ich voraussetze, dass der junge Komponist sein Stück selbst vorgetragen hat, dann ist es schon erstaunlich, was er seinen kleinen Händen abverlangt hat. Ich selbst habe das Stück erst spät in einem Schulbuch entdeckt; danach habe ich es meinen Gymnasial-Schülern oft und mit Freude vorgespielt.
Mozart schrieb die meisten seiner über 100 Klavierwerke für sich selbst, für seine Konzertvorträge; einige schrieb er für seine Schülerinnen und Schüler. Seine persönliche musikalische Sprache fand er in den Klavierkonzerten und den Klaviersonaten. Bleiben wir erst einmal bei den Sonaten. Mit 16 Jahren kaufte ich mir einen schön eingebundenen Band von 322 Seiten, mein erstes dickes Klavierbuch: W.A. Mozart, Sonaten für Klavier zu zwei Händen (Peters-Verlag). Vorher hatte ich – bei meinem ersten Klavierlehrer, Bernd Allenstein (1916-2008), – schon einige Haydn-Sonaten gespielt, die mir viel Freude bereiteten.
Doch dieser Mozart-Band sollte mich länger beschäftigen. Aus den Eintragungen meines Lehrers sehe ich, dass ich als erstes die Sonate Nr. 5 in G-Dur, KV 283, spielte. Sie gehört zu einer Gruppe von sechs Sonaten, die Mozart als 18-Jähriger auf einer Reise nach München komponierte. Nach den üblichen Sonatinen (Clementi, Diabelli, Kuhlau) und einigen Haydn-Sonaten muss der erste Mozart-Sonatenklang unter meinen Händen wie ein Feuerwerk auf mich gewirkt haben. Der erste Satz (Allegro, 3/4-Takt) beginnt mit 6 Takten im piano. Aber schon in Takt 5 und Takt 6 werden die ersten Akzente vorgeschrieben. Zusätzliche Akzente hat mein Lehrer eingetragen. Die flotten Läufe der ersten Seite muss ich mit viel Vergnügen gespielt haben, sie liegen nämlich „gut in der Hand“. Erst spät muss die linke Hand zeigen, dass auch sie schnelle Sechzehntel beherrscht. Die insgesamt heitere, spielerische Stimmung wird ab Takt 32 verstärkt: Durch einen Wechsel von Staccato und Legato.
Das Thema des 2. Satzes (Andante) beginnt mit vier gleichen Tönen, es sind ruhige Achtelnoten c2. Dazu läuft eine einfache Sechzehntel-Begleitung in der linken Hand. Erst später zeigt sich, dass auch die rechte Hand flotte spielerische Zweiunddreißigstel-Figuren bewältigen muss. Harmonisch interessant wird es in der Durchführung, die Chromatik und auch einige Molltakte bringt. Auf keinen Fall ist dieser Satz einfach. Für mich ist schon an dieser Stelle klar: Mozart hat hier mit 18 Jahren eine Reife erlangt, die bemerkenswert ist. Und doch gibt es im Andante auch lockere, spielerische Elemente.
Der 3. Satz war mein erstes Mozart-Presto. Nimmt man diese Vorschrift ernst, muss der 3/8-Takt so schnell gespielt werden, dass nicht 1-2-3 gezählt wird, sondern nur die 1 gezählt (und dirigiert) wird. Aber das habe ich als Schüler bestimmt nicht geschafft! Gerne habe ich jedoch die aufsteigenden Dreiklangs-Melodien gespielt, die leise anfangen und mit einem Forte-Akkord enden, eine schöne Idee. Kurz danach übernimmt die linke Hand die Führung, und zusammen mit den schnellen Figuren der rechten Hand ergibt sich eine Schlussphrase, die so virtuos wie in einem Klavierkonzert ist. Ähnlich wiederholt Mozart das am Ende des Satzes.
Die folgende Sonate in D-Dur, KV 284, ist in Umfang und im Schwierigkeitsgrad deutlich gesteigert. Und doch oder vielleicht deswegen habe ich sie immer wieder – wie verrückt – gespielt! Ich stimme dem Autor der Wikipedia zu: „Zum ersten Mal wagt sich Mozart in diesem Klavierwerk ins Orchestrale und die Sonate lebt in ihrem Verlauf vom Wechsel zwischen Tutti und Solo“.1
Richtig, in den Takten 3-6 vermeint man Hörner oder Fagotte zu hören. Und wie brillant die Sonate ist: Die Unisono-Läufe in Takt 8; die kadenzierenden Figuren ab Takt 13; am Ende des Teils ausgesprochen virtuose Ideen, wie in seinen Konzerten. Im zweiten Teil muss die rechte über die linke Hand übergreifen. Mit einem langen Triller kommt der Satz zum Ende. Was für ein Werk!
Den 2. Satz (Rondeau en Polonaise, Andante) habe ich nicht so wie den 1. Satz geliebt. Der Tanz-Charakter kommt, anders als später bei Chopin, nicht gut heraus. Auch die typische Polonaisen-Figur ist nirgends zu finden. Allerdings bewundere ich heute die vielen Verzierungen, die Synkopen und andere Finessen, die Mozart so nebenbei einarbeitet. Einmal lässt er auf ein zartes Piano eine Pause folgen; die Fortsetzung erschrickt mit einem Forte im vollgriffigen Satz. In der Reprise zeigt Mozart meisterlich, wie er „ein zweites Mal“ nicht exakt wiederholt, sondern mit Verzierungen abwandelt.
Den Schlusssatz bilden 12 Variationen über ein eigenes Thema (Andante, 2/2-Takt). Hier bringt Mozart alle Techniken seiner großen Variationswerke unter, für die er bekannt ist. In den ersten Variationen spielt er mit mal fließenden, mal unterbrochenen Triolen. Variation 3 besteht aus vielen Sechzehnteln der rechten Hand; die Linke dagegen muss in Oktaven eine gute Legato-Technik beweisen. In den nächsten Variationen entfernt sich Mozart weit vom Thema; in Variation 6 greift die linke Hand über die rechte. Nr. 7 ist die erwartete Moll-Variante. Nr. 9 zeigt die kontrapunktischen Techniken, die Mozart an Bach und Händel studiert hat. Die vorletzte Variation schraubt das Tempo weit zurück: Adagio cantabile. Und sie ist sehr lang. In meiner Ausgabe steht eine wenig verzierten Fassung und darüber eine ausgeschmückte, so wie Mozart sie möglicherweise beim eigenen Vortrag spielte. Die letzte Variation kehrt zum Allegro zurück, wechselt aber in den 3/4-Takt. Sie spielt mit einigen virtuosen Elementen; besonders die letzten neun Takte fordern beide Hände des Pianisten stark heraus. Nie aber vergisst Mozart die Spielfreude und die Heiterkeit in dieser Variation.
Die Sonate KV 310 steht in a-moll und ist die erste von nur zwei Klaviersonaten, die Mozart in Moll schrieb. Sie wurde 1778 in Paris beendet, nachdem Mozart Mutter Anna Maria Mozart, die ihn auf der Reise begleitet hatte, dort verstorben war. Ganz anders alle viele Werke der Wiener Klassik hat der 1. Satz (Andante maestoso) nur ein Thema: Ein düsteres, fast dämonisches Thema. Auffällig sind die vielen Punktierungen, die – auch schon im ersten Takt – einen markanten Rhythmus vorgeben. Im weiteren Verlauf lockert sich die Stimmung etwas auf, virtuose Abschnitte folgen. Melodien der rechten Hand werden etwas später von der linken Hand übernommen. Die Durchführung wird nicht weniger virtuos gestaltet. Mozart arbeitet auch mit der barocken Technik der Imitation. Eine längere Partie führt zur Reprise. Auch hier übernimmt die linke Hand ab und zu die Führung. Mit groß angelegten Kadenzierungen geht der Satz zu Ende. Die düstere Stimmung bleibt bis zum letzten Akkord erhalten.
Der zweite Satz ist ein „Andante cantabile con espressione“, fast als Adagio zu spielen. Denn bald erscheinen die ersten Vierundsechzigstelnoten, die ich bei Mozart gesehen habe. Der Satz ist so groß angelegt, so ausführlich wie die langsamen Sätze in Beethovens Sonaten 20 Jahre später, vielleicht nicht ganz so konzentriert wie dort. Mir scheint, dass Mozart hier von Idee zu Idee springt. Durch die F-Dur-Tonart ist der Charakter nicht mehr so dunkel. Der Satz endet mit einer eindrucksvollen Schlusswendung. Schon 15 Takte vor dem Ende vermeidet Mozart, zur Tonika (F-Dur) zu kommen. Immer wieder spielt B-Dur eine vorübergehende Rolle. Dreimal wird F-Dur erreicht, aber das ist noch nicht das Ende. Erst nach zwei großartigen Läufen findet Mozart seinen Schluss mit einem Doppeltriller. Noch drei Takte Ausklang folgen. Ein großartiges – und schwieriges Klavierstück. Mitsuko Uchida spielt es in annähernd 11 Minuten; einer der längsten langsamen Sätze, den ich von Mozart kenne.
Das Presto im 2/4-Takt (in Rondoform) ist eine Ausnahme im ganzen Mozart-Sonatenwerk. Wie ein Perpetuum mobile läuft eine Begleitung von drei Achteln andauernd mit der gehetzten Melodie mit. Trotz dieses beständigen Elements wechseln sich piano und forte ab; einmal übernimmt die Bassstimme die Melodie. Ein kurzer Zwischenteil in Dur bringt eine freundliche Stimmung, danach geht die Jagd unerbittlich auf den Schluss zu. Es ist ein Ende in Moll, in hartem Forte.
Wieder folgt als KV 311 eine Sonate in D-Dur, einer Tonart, die auch in Mozarts Opern und Sinfonien oft hörbar ist. Wegen ihrer heiteren, eleganten Themen habe ich sie sehr gerne gespielt. Der 1. Satz, allegro con spirito, fordert vom Spieler eine lockere, sehr geschwinde Spielweise, und das in beiden Händen, außerdem schnelle Wechsel der Lagen. Einige Takte wirken fast orchestral. Mit einem Seufzermotiv beginnt die einfallsreiche Durchführung. Die Reprise beginnt diesmal nicht schulmäßig, mit der Wiederholung des Anfangs. Mozart wählt stattdessen neue Melodien, die nach vielen Takten zum 2. Thema führen. Mit zwei Piano-Takten klingt der Satz aus.
Der langsame Satz ist ein lyrisches Andante, das aber auch Überraschungsmomente bietet. Zum Beispiel, wenn schon im dritten Takt drei kräftige Akkorde das zarte Spiel unterbrechen. Immer wieder spielt Mozart im Laufe des Satzes mit diesem Wechsel. Der 3. Satz ist einer der längsten in Mozarts Sonatenwerk. Ausgelassen und fröhlich beginnt das Rondo. In den Takten 26/27 meint man Orchesterklänge zu hören, wenn sechsmal das einstimmige D erklingt (Fagotte oder Hörner). Überraschend kommt nach 6 Seiten Notentext eine Kadenz hinzu. Wie in einem Klavierkonzert wird sie mit einem großartigen Crescendo vorbereitet. Nach der Kadenz lässt sich Mozart noch viel Zeit, bis er zum brillanten Ende kommt. Ein virtuoser, anspruchsvoller Klaviersatz!
Zwei Sonaten haben mich in verschiedenen Lebenslagen begleitet: KV 331 in A-Dur und die noch nicht erwähnte KV 545 in C-Dur. Beide habe ich schon als Jugendlicher gerne gespielt. Die A-Dur-Sonate ist vielleicht Mozarts bekannteste Sonate. Zwei Gründe liegen auf der Hand: Die besondere Melodie des Themas im 1. Satz; sie wurde u.a. von Max Reger aufgegriffen, kommt in Filmen und Computerspielen vor! Und der 3. Satz „Alla turca“: Einzigartig und so nachgefragt, dass schon Jahrzehnte nach dem ersten Druck (1784) viele Nachdrucke und Bearbeitungen in ganz Europa bekannt waren.
Der 1. Satz beginnt mit einem zarten Thema im 6/8-Takt. Andante grazioso heißt für mich: Ein mittleres Tempo wählen und äußert leicht, elegant deklamieren. Das komplette Thema kommt im piano daher, nur die Schlussphrase steht im forte, vorher gibt es noch einige Akzente. Auf das Thema folgen sechs Variationen, die in aller Kürze nacheinander Mozarts wunderbare Variationstechnik zeigen: Verzierung der Melodie, Triolen-Begleitung, Wechsel nach Moll, Übergreifen der linken Hand, eine langsame Variation und zum Abschluss eine Allegro-Variation im 4/4-Takt. Diese packt noch einmal alle pianistischen Ideen Mozarts zusammen: Schneller Wechsel zischen legato und staccato; schnelle Sechzehntel in der rechten Hand, dann in beiden Händen gemeinsam; Synkopen; Gebrauch von Verzierungen. Der Schluss erfolgt schulmäßig mit zwei Forte-Akkorden, augenzwinkernd geht ihnen eine kurze, schnelle Piano-Melodie voraus.
Das Menuett erinnert noch von Ferne an die Tänze des Barock. Ein gemächlicher Beginn täuscht Behäbigkeit vor; wehe, wenn im 12. Takt die Sechzehntelketten der rechten Hand beginnen: Hier wird der Spieler richtig gefordert. Nach einem kurzen Ausflug nach a-moll kommt die Anfangsmelodie wieder. Ein ruhiges Trio bildet den Mittelteil, bevor das Menuett wiederholt wird. Für mich eines der schönsten Mozart-Menuette überhaupt!
„Alla turca“, oft auch „Türkischer Marsch“ genannt, steht mit „Kleiner Nachtmusik“ und dem Vogelfänger-Lied an der Spitze der meistgespielten Mozart-Werke. Wir haben eine schnelle, Perpetuummobile-artige Bewegung in der Melodie, dagegen eine sehr gleichbleibende, ja einfache Begleitung. Aber schon nach vier Notenzeilen wechselt Mozart ins sehr vollgriffige, kräftige A-Dur. Diese und weitere ähnliche Stellen haben die Analysten dazu veranlasst, hier Anklänge an die türkische Militärmusik, die „Janitscharenmusik“, zu finden. Nach Mozarts eigenen Aussagen in seinen Briefen war das Publikum damals verrückt nach solchen Effekten, die im Orchester vor allem durch Becken, Trommeln und Rasseln verwirklicht wurden.
Nun schiebt Mozart unerwartet einige Takte in fis-moll ein. In einer turbulenten Bewegung muss die Melodie fast ohne Unterbrechung durch viele Oktaven hindurch laufen. Alle Teile des Anfangs werden dann in anderer Reihenfolge wiederholt. Wenn alles vorbei zu sein scheint, fügt Mozart noch eine „Coda“ an. In diesem Nachspiel werden die Treffsicherheit und die Geläufigkeit des Pianisten noch einmal stark gefordert, bis in den letzten sechs Takten nur noch ein starkes A-Dur erklingt.
Den 3. Satz konnte ich 2014 bei einer Abiturfeier meiner Schule in Bergheim spielen. Jahre vorher hatte ich das Glück, die ganze Sonate im Klaviermuseum „Haus Eller“ in Bergheim-Ahe aufzuführen. Der Hausherr Christoph Dohr hatte mich eingeladen, das Werk an einem Hammerflügel von 1815 vorzutragen. Für mich ein Experiment, weil die Mechanik ganz anders reagiert. Mit guter Vorbereitung konnte ich es schaffen …
Eine der großartigsten Sonaten ist das Werk in B-Dur, KV 333. Weil ich mir diese schwere Sonate erst im Studium vorgenommen habe, kann ich mich noch an den Unterricht bei Eckart Sellheim an der Musikhochschule Köln erinnern. Er hat mich in vielen Einzelstunden „auf den Weg gebracht“. Er hat mir Details gezeigt und Genauigkeit von mir gefordert, die mir bis dahin nicht bewusst waren. Noch heute stehen seine Anmerkungen und Fingersätze auf den 20 Seiten der Sonate. Es war damals eine der Phasen meines Lebens mit den intensivsten Übezeiten am Klavier. Und es hat sich gelohnt: 1973 beendete ich mein Musikstudium mit Bach, Mozart, Schubert und Schönberg. Auch dank Eckart Sellheims pädagogischem Einsatz mit Erfolg.
Alle drei Sätze sind mit pianistischen Schwierigkeiten gespickt. In den Schlussphrasen des 1. Satzes wird der Abschluss zweimal mit einem langen Triller und anderen Effekten erreicht. Der langsame Satz beginnt mit einem gesanglichen Thema. Es muss in aller Ruhe vorgetragen werden, denn schon im vierten Takt läuft die Melodie in Zweiunddreißigsteln davon. Jede Idee wird erst einmal ruhig, dann in verzierter Weise gespielt. Nach ausgedehnten Passagen mit verschiedenartigen Ideen kommt der Satz zu einem ruhigen Abschluss. Ich kann mir den Satz gut als Bläser- oder Streichquartett vorstellen.
Lange war der 3. Satz (Allegretto grazioso) mein Lieblingsstück von allen Klavierwerken Mozarts. Er ist umfangreich, ideenreich und pianistisch sehr fordernd. In Form eines Rondos (A–B–A–C–A–D–E–A) bringt er so viel Freude, Ausgelassenheit und Überraschungen mit sich, dass es nur so eine Pracht ist. Die Takte 171 bis 198 gestaltete Mozart in Form einer ausgedehnten Kadenz. Hier musste ich beweisen, was ich schon Jahre vorher an den Klavierkonzerten bewundert und „geübt“ hatte. Ein grandioser Satz! Gleich muss ich vom Laptop aufstehen und ihn wieder durchspielen, und vor allem die Kadenz …
„Schreibe kurz – leicht – popular. Rede mit einem Graveur [Notenstecher], was er am liebsten möchte. Glaubst Du Dich vielleicht durch solche Sache herunter zu setzen? Keineswegs! hat dañ [Johann Christian] Bach in London iemals etwas anders, als derley Kleinigkeiten herausgegeben? Das Kleine ist Groß, weñ es natürlich – flüssend und leicht gesetzt ist. Es so zu machen ist schwerer als alle die den meisten unverständliche künstliche Harmonischen progressionen, und schwer auszuführenden Melodyen.
Dies sind Ratschläge des Vaters. Leopold Mozart schrieb diese Sätze im August 1778 seinem Sohn nach Paris. Die Begriffe passen meiner Meinung nach sehr gut auf die folgende Sonate. „Eine kleine klavier Sonate für anfänger“, so hieß die C-Sonate KV 545 zuerst; im Erstdruck steht als Überschrift Sonate facile. Und das stimmt auch. Das erste Thema, mit den Dreiklangstönen c-e-g beginnend, wirkt wie mit leichter Hand dahin geschrieben. Ab Takt 5 folgen lange Tonleiterketten, mit wenigen Akkorden begleitet. Auch das zweite Thema startet mit einer Dreiklangsmelodie: d-h-g; hier muss die linke Hand allerdings locker und schnell begleiten. Nach wenigen Takten beginnt eine der verblüffenden, typischen Mozart-Ideen: Ein Wechselspiel beider Hände. Die Unterstimme beginnt mit vier Tönen aufwärts, die Oberstimme antwortet mit vier gleich schnellen Tönen abwärts. Und das immer wieder, bis der vorläufige Schluss mit einem langen Triller erreicht wird.
Auch die Durchführung verwöhnt uns wieder mit dem eben geschilderten Wechselspiel. Mozart erweitert aber jetzt die Dauer der einzelnen Melodien auf ganze oder halbe Takte, geht dabei durch die verschiedensten Harmonien (g-moll, d-moll, F-Dur). In der Reprise kommen – in aller Kürze – viele diese Ideen wieder. Ein wunderbares Stück typisch klassischer Klaviermusik! Ich hatte die Gewohnheit, wenn ich als Lehrer in den Klassen 5 oder 6 das Tempo in der Musik besprach, ein Metronom aufzustellen. Einige Schüler durften die „Technik“ des Gerätes erkunden. Dann setzte ich mich ans Klavier und spielte die ersten zwölf Takte von KV 545, genau nach Metronom! Danach sollte ein Schüler das Metronom eine Stufe schneller einstellen. Wieder spielte ich, und wieder schneller. Ein Spaß für uns alle!
Der 2. Satz (Andante) ist ein ruhig gehaltenes, gesangliches Stück, in dem die linke Hand ganz untergeordnete Funktion hat. Sie spielt – bis auf wenige Ausnahmen – Alberti-Bässe als Begleitung. Alle Abschnitte sind klar abgegrenzt: Sie zerfallen in 2, in 4, in 8, in 16 Takte. Mozart verzichtet hier auf ungewöhnliche Tonarten oder dissonante Reibungen. So macht er es dem Hörer leicht, das Werk zu verfolgen. Der 3. Satz ist ein typisches Rondo. Staccato-Partien wechseln mit langen Legato-Melodien. Auch die linke Hand übernimmt hin und wieder die Führung. In äußerst knapper Form zeigt Mozart seine große Meisterschaft, diesmal nicht in virtuoser Klaviertechnik, sondern eher im Reichtum der Ideen. Als Überraschung empfinde ich den Schluss: 6 Takte erklingt im Forte strahlendes C-Dur, die Sonate endet mit einem fünffachen C-Dur-Auftrumpfen. Das hätte ich nach dem lockeren, leichtfüßigen Anfang nicht gedacht.
Von den wenigen erhaltenen Fantasien Mozarts für Klavier kenne ich nur eine gut: Die Fantasie in d-moll KV 397. Es ist ein nicht zu langes, sehr abwechslungsreiches Stück, das die verschiedensten Tempoangaben bietet. Ein Andante bildet eine Art präludierende Einleitung, ähnlich einer Cembalo-Fantasie der Barockzeit. Ein Adagio schließt sich an. Hier wird eine düstere, von Seufzern unterbrochene Moll-Melodie vorgestellt, während die linke Hand mit einfachen Akkorden begleitet. Drei Forte-Takte bilden einen dramatischen Einschub. Eine gehetzte Melodie folgt, wieder mit barocker Rhetorik durchsetzt (Seufzer-Motive, Unterbrechungen). All diese Abschnitte wiederholen sich, aber in anderen Tonarten. Zweimal läuft eine einstimmige, wilde Presto-Tonleiter über die gesamte Tastatur. Als letzten Teil hat Mozart einen Rondo-artigen Dur-Ausklang komponiert, dies ganz in klassischem Stil. Nach einigen Takten wird eine großartige Kadenz eingeschoben, bevor wieder das Dur-Thema erklingt. Leider bricht Mozarts Handschrift hier ab. Ein Zeitgenosse hat noch 10 Takte angefügt, damit ein logischer Schluss erklingen kann. So ist diese Fantasie zwar ein Dokument des empfindsamen Stils, vielleicht gelernt bei Johann Christian Bach in London. Gleichzeitig ist sie kurz und bleibt – zu unserem Leidwesen – eigentlich unvollendet.
Mozart hat – vermutlich für den eigenen Gebrauch, um in Konzerten damit zu glänzen – mehr als 15 Variationenwerke geschrieben. Eines habe ich schon genau beschrieben. Ein weiteres habe ich intensiv studiert. Meine erste Begegnung mit „Neun Variationen über ein Menuett von Duport“ KV 573 verdanke ich einem Zufall. Als Schüler hatte ich mir ein Spulen-Tonbandgerät gekauft, um Rundfunksendungen mit klassischer Musik mitzuschneiden. Diese Bänder besitze ich heute noch und weiß daher, dass ich das Werk mit 17 Jahren erstmals hörte. Diese Variationen begeisterten mich von Beginn an. Einige Jahre später studierte ich das Werk bei Eckart Sellheim in Köln, wieder eine sehr intensive Beschäftigung mit allen Details, legato, staccato, crescendo, diminuendo usw. Ich denke heute, dass ich mit diesem Stück an meine Grenzen kam. Aber die typische Mozart-Pianistik hat mir in diesem Stück unendlich viel Freude bereitet.
Der französische Cellist Jean-Pierre Duport war ab 1787 „Surintendant der königlichen Kammermusik“ am Hofe Friedrich Wilhelms II. von Preußen. Aus der Cellosonate Nr. 6 des Franzosen entnahm Mozart ein Menuett. Er schrieb diese Variationen, wie passend, bei einem Aufenthalt in Potsdam, im Frühjahr 1789. Eine Anstellung Mozarts am preußischen Hof kam nicht zustande; aber seine „Duport-Variationen“ sind himmlisch!
Das Thema ist einfach konzipiert, beinahe schlicht und dabei gut überschaubar in 3x8 Takte gegliedert (A-B-A). Der Themenkopf (die Dreiklangstöne a-d-a-fis) kommt gleich viermal daher, jedes Mal etwas anders verziert. Etwa ein Anklang an französische Verzierungs-Techniken? Mit Variation Nr. 1 beginnt ein feuriger Reigen. Klingt das Thema noch behäbig, sogar zierlich, so ist in den rasanten Figurationen der Nr. 1 bis 3 nichts beschaulich, nichts barock. Ein Feuerwerk von Läufen, Akkorden, gebrochenen Akkorden und Chromatik lässt Spieler und Hörer nicht zu Atem kommen. In den nächsten drei Variationen tritt eine allmähliche Beruhigung ein. Doch gerade Variation 4 verzaubert mit durchgehenden Triolen und Repetitionen; linke und rechte Hand sind beide thematisch beteiligt. Die sechste Variation kommt gedämpft und nachdenklich daher (in d-Moll). Die Melodie wird stark ausgeziert, einige Seufzermotive kommen vor. Einen dramatischen Höhepunkt erreicht Mozart vier Takte vor Schluss. Statt der erwarteten Tonika (hier d-moll) bringt er einen „neapolitanischen Sextakkord“ in der linken Hand (Es-Dur), ein Stilmittel, das schon in der Barockmusik etwas Besonderes, Außergewöhnliches darstellte.
Variation 7 ist (wie die Schlussvariation) mit pianistischen Schwierigkeiten gespickt. In beiden Händen müssen nacheinander schnelle Oktavsprünge bewältigt werden. Nach einer Adagio-Variation (Nr. 8), in der Mozart die ganze Kunst des Verzierens und die Kunst der rhythmischen Abwandlung demonstriert, kommt es in Variation 9 zu einem virtuosen Showdown. In einer neuen Taktart (2/4 anstatt von 3/4) wirkt der Themenkopf (es sind nur 4 Töne) kurzatmig und gehetzt (zuerst im piano). Die folgenden Takte 5 bis 8 bringen Synkopen und das Forte zurück. Später führt uns Mozart viele Takte hindurch zu einer schönen Kadenz, die auf einem tiefen Dominantton A beginnt. Danach erklingt als Reminiszenz zum letzten Mal das Anfangsthema – und endet in strahlendem D-Dur.
Hier könnte ich das Kapitel der wunderbaren Klavierwerke Mozarts abschließen, wenn es da nicht noch ein merkwürdiges Opus gäbe, sein musikalisches Würfelspiel KV 294d. Er selbst gab ihm den Titel: „Anleitung so viel Walzer oder Schleifer, mit zwei Würfeln, zu componiren, so viel man will, ohne musikalisch zu seyn, noch etwas von der Composition zu verstehen“. Gedruckt wurde es erst zwei Jahre nach seinem Tod. „Bei dieser Komposition Mozarts soll der Spieler zwei Würfel insgesamt 16 Mal würfeln. Dadurch werden 16 Takte nach bestimmten Regeln ausgewählt, die einen Walzer ergeben, den der Spieler mit Hilfe des Zufallsgenerators der beiden Würfel gerade komponiert hat.“2 So hat Mozart – wie andere Komponisten des 18. Jahrhunderts – die zufallsgenerierte Musik etwa eines Computers vorweggenommen. Ich habe vor vielen Jahren einige Versionen des Würfelwalzers durchgespielt. Sie klingen gar nicht so schlecht!
1https://de.wikipedia.org/wiki/Klaviersonate_Nr._6_(Mozart) (abgerufen am 20.1.2020)
2https://www.ensembleresonanz.com/task/mozarts-musikalisches-wuerfelspiel/ (abgerufen am 14.3.2020)
Werke für Klavier zu 4 Händen
Diese Stücke, die mir in einem Band der Universal-Edition vorliegen, sind mir ans Herz gewachsen. Einige habe ich mit verschiedenen Partnern und immer wieder gerne gespielt. In meinem Notenband stehen fünf Sonaten, zwei Fantasien und zwei weitere Stücke. Ich glaube, einige dieser Sonaten erstmals auf einer LP mit den jungen Pianisten Christoph Eschenbach und Justus Frantz gehört zu haben. Die Spielfreude der beiden Solisten und der typische und brillante Mozart-Klang der Sonaten haben mich immer wieder begeistert.