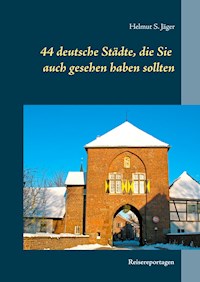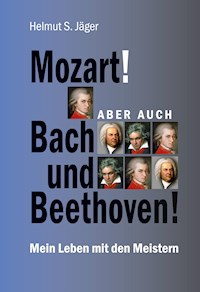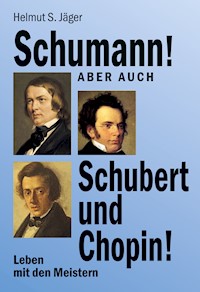
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Mein Lieblingskomponist? Den kenne ich nicht. Es gibt Schönes bei jedem Komponisten! Der Musikhörer, der Sänger, der Instrumentalist beschäftigt sich mit Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin usw. - und lernt sie dann lieben. Mit Friedrich Gulda bin ich einig: "Bach, Mozart, Beethoven sind einfach die Größten", sagte er in einer TV-Dokumentation. Sie waren das Thema meines letzten Buchs. Nun schreibe ich über drei Musiker der Romantik: Schumann, Schubert und Chopin, die mich schon als Kind und als junger Mensch berührten, begeisterten und die bis heute ohne merkliches Nachlassen in meinem Denken und Fühlen, vor allem aber im eigenen Musizieren bei mir sind. Weil sie einen wichtigen Teil meines Lebens bestimmten und beeinflussten. Musik hat mich nie losgelassen - und ich will sie nicht los lassen. Dieses Buch ist für die Kenner und die Liebhaber der klassischen Musik gedacht. Ob sie aktiv musizieren, ob sie mehr als Zuhörer oder Zuschauer unterwegs sind, uns alle verbindet Interesse und Neugier auf die drei großen Meister: Schumann, Schubert und Chopin. Sie werden dieses Buch mit Gewinn lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schreibe, was du siehst und hörst!
(Scivias, Hildegard von Bingen)
Berichterstatter will ich sein. Von einer Reise, die mich fasziniert. Von Welten, die mich bereichert haben.
(Ingo Metzmacher, Dirigent)
In dankbarer Erinnerung an meine Eltern und an meine wichtigsten Lehrer:
Bernd Allenstein, Olpe, Klavier und Orgel
Karl Kretschmer, Olpe
(Chor- und Orchesterdirigent)
Eckart Sellheim, Köln, Klavier
Für meine Familie und meine Freunde
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Schumann
Klavierwerke
Werke für Klavier zu 4 Händen
Sinfonien
Konzertante Werke
Chorwerke mit Orchester
Kammermusik
Lieder
Chormusik
Opern
Schubert
Klavierwerke
Werke für Klavier zu 4 Händen
Sinfonien
Sonstige Orchesterwerke
Kammermusik ohne Klavier
Kammermusik mit Klavier
Lieder
Chorwerke mit Orchester
Chormusik
Bühnenwerke
Chopin
Balladen
Barcarolle und Berceuse
Etüden
Impromptus
Mazurkas
Nocturnes
Polonaisen
Préludes
Rondos
Scherzi
Sonaten
Verschiedene Einzelstücke
Walzer
Konzerte und Konzertstücke
Lieder
Sonstige Werke
Epilog, Dank und Literatur
Einleitung
Als ich noch Lehrer war, fragten meine Schüler mich hin und wieder nach meiner Lieblingsgruppe, nach meinem Lieblings-Sänger oder meinem Lieblings-Komponist. Dann gab ich oft eine Verlegenheits-Antwort. Heute sage ich: Lieblingskomponist? – nein: Es gibt Schönes bei jedem Komponisten! Der Musikhörer, der Sänger, der Instrumentalist beschäftigt sich mit Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin usw. – und lernt sie dann lieben.
Vor zwei Jahren beendete ich mein Buch über Bach, Mozart und Beethoven. Anerkennung und Zuspruch seitens meiner Freunde machten mir Mut, nun über drei weitere Komponisten zu schreiben, die in allen Phasen meines Lebens Begleiter, Herausforderung bei meinem eigenen Klavierspiel und die manchmal auch ein Rätsel für mich waren. Robert Schumann (1810-1856), Franz Schubert (1797-1828) und Frédéric Chopin (1810-1849) sind Persönlichkeiten der Romantik. Und sie haben Hunderte von herrlichen Klavierwerken hinterlassen, einen Schatz, den ich erst allmählich als Erwachsener heben konnte. Das ist aber schon alles, was sie verbindet. Denn sie sind drei Individuen, die privat und beruflich sehr verschiedene Schicksale meistern mussten. Darüber später mehr.
Mit Schumanns „Album für die Jugend“ begannen die frühen Jahre meiner Klavierausbildung. Diese besonderen, teilweise ganz einfachen Werke habe ich immer gerne gespielt, habe sie auch oft meinen Klavierschülern nahe gebracht. Chopins Préludes und Walzer waren für mich eine ganz neue Welt. Verständlich, dass ich – als ich zum ersten Mal verliebt war – meiner Angebeteten ein Chopin-Werk vortrug. Und bis heute spiele ich fast jede Woche ein Stück des gebürtigen Polen. Erst mit 15 oder 16 Jahren näherte ich mich Schubert an. Es war damals nur ein einziger Band: „Impromptus und Moments musicaux“. Schon diese Titel sind faszinierend. Und wieso hat Schubert hier ausnahmsweise französische Begriffe verwendet, sonst fast nie?
Bewusst habe ich gerade diese Komponisten ausgewählt: Weil sie einen wichtigen Teil meines Lebens bestimmten und beeinflussten. Musik hat mich nie losgelassen – und ich will sie nicht los lassen.
Schumann – Klavierwerke
Sie ist die romantischste aller Künste... Die Musik schliesst dem Menschen ein unbekanntes Reich auf; eine Welt, die nichts gemein hat mit der äußeren Sinnenwelt, die ihn umgibt.
(E.T.A. Hoffmann)
In einer Übersicht des Peters-Verlags stehen 39 Opus-Nummern, die allein von Schumanns Klavierwerk zeugen. Eine unglaublich hohe Zahl! Wie auch Schubert und Chopin hat Schumann seinen Schwerpunkt im Klavierschaffen. Leider habe ich nur eine kleine Auswahl aus seinem Werk kennengelernt; manche Klavierstücke scheinen auch nicht mehr im Programm der Pianisten und Veranstalter vorzukommen.
Mein Klavierunterricht baute auf Klavierschulen, auf Bachs Inventionen, Czernys Schule der Geläufigkeit und eben Robert Schumann auf. Es waren die „Kinderszenen“ op. 15 und das „Album für die Jugend“ op. 68, die mich sehr berührten. Es fällt mir schwer, die Gefühle des damals 13jährigen nachzuvollziehen, der erstmals die „Träumerei“ oder den „Wilden Reiter“ spielte. Aber ich glaube, dass ich viele dieser ersten Stücke sehr geliebt habe. Meine Auswahl (aus meiner heutigen Sicht): Soldatenmarsch, Armes Waisenkind, Wilder Reiter, Fröhlicher Landmann, Knecht Ruprecht, Erster Verlust, Fremder Mann, Winterszeit I und II, Nordisches Lied. Als ich selbst Klavierlehrer wurde, war es mir eine Freude, einige dieser Charakterstücke den Kindern und Jugendlichen nahezubringen. Und auch für mich als Lehrer am Gymnasium waren der „Wilde Reiter“ und einige Stücke aus den „Kinderszenen“ wichtige Stationen im Musikunterricht.
„Kinderszenen“ ist ein Zyklus von 13 kurzen Miniaturen. Man hat viel über die Bedeutung dieses Titels gegrübelt. Sind es Stücke für Kinder? Sind es Erinnerungen an Schumanns eigene Kinderzeit? Der Komponist selbst gibt die Auskunft, es sei eine „Rückspiegelung eines Älteren für Ältere“. Ich finde, die Titel der einzelnen Stücke sind wichtig; andererseits schreibt Schumann an den Dichter Ludwig Rellstab: „Die Überschriften entstanden natürlich später und sind eigentlich nichts als feinere Fingerzeige für Vortrag und Auffassung.“ 1 Die erste Miniatur, überschrieben „Von fremden Ländern und Menschen“, ist wie alle folgenden kurz und überschaubar. Eine durchgehende Triolenbewegung begleitet eine einfache, einprägsame Melodie, die noch oft wiederholt wird. Technisch nicht anspruchsvoll, erzielt das Stück seine Wirkung aus dem Wechsel von Harmonie und klug disponierter Dissonanz, z.B. im 1. Takt der verminderte Akkord cis-b-e-g.
Heiter und draufgängerisch kommt die „Kuriose Geschichte" daher, sie ist von ähnlichem Charakter wie „Wichtige Begebenheit". Hier darf der Spieler erstmals ein Fortissimo mit dröhnenden Oktaven im Bass anstimmen. Zurückhaltender und sehr poetisch wirken „Bittendes Kind", „Fast zu ernst", „Kind im Einschlummern" und natürlich die berühmte „Träumerei". Die Neigung der Romantiker zum Unheimlichen, Gruseligen wird am ehesten in „Fürchtenmachen" verwirklicht. Dieses kleine, aber abwechslungsreiche Stück stellt zuerst einen ruhigen Teil vor, der die heile Welt darstellt. Dann folgen acht Takte mit einer gehetzten Melodie, die durch mehrere Oktaven jagt. Immer wieder spielt Schumann mit diesem Wechsel, bis er zu einem ruhigen Ende kommt. Gerade dieses Stück hat meine 10jährigen Schüler in der 5. Klasse zu vielen Kommentaren und zu ungewöhnlichen Bildern angeregt.
Im letzten Werk des Zyklus, „Der Dichter spricht“, wird Schumanns allgemeine Einstellung zu Musik offenbar. Er glaubte, Musik transportiere poetische Inhalte, die in Worten nicht ausgedrückt werden könnten. Das Stück beginnt und endet mit einem vierstimmigen Choral. In der Mitte steht eine leise kadenzartige Passage. Hier spricht der Dichter; seine Stimme schwingt sich vom a1 bis zum g3hoch, zum Teil von geheimnisvollen Klängen begleitet. Äußerst leise klingen die Kinderszenen aus.
Als ich schon berufstätig war, hatte ich einige Klavierschüler, die gerne Stücke aus den „Waldszenen" spielten. Dieser Zyklus von 8 Charakterstücken ist ein Spätwerk, in dem Schumann erstmals dieses bei vielen Romantikern beliebte Thema aufgriff. Es war knapp 30 Jahre her, dass Weber in einem zentralen Opernwerk der Frühromantik den Jäger, aber auch die Natur und besonders das Geisterhafte im Wald in Musik umgesetzt hatte. Schumann beweist hier – wie auch in vielen anderen Klavierwerken – ein großartiges poetisches Gespür, mit wenigen Tönen und Klängen die Atmosphäre des Geheimnisvollen im Wald zu beschwören. Dies gelingt ihm in „Jäger auf der Lauer", „Einsame Blumen", „Verrufene Stelle" und „Jagdlied". Das erste Stück hat mir immer besonders gefallen: „Eintritt". Mit einfachen B-Dur-Klängen ist der Zuhörer direkt im Wald „angekommen". Die Melodie liegt anfangs im Tenor, was den arabeskenhaften Klaviersatz noch interessanter macht. Ein insgesamt heiteres und leises Anfangsstück, wie die meisten in diesem Zyklus gut als Hausmusik der Biedermeierzeit denkbar. Völlig anders und ganz außergewöhnlich ist „Vogel als Prophet" komponiert. Obwohl in G-moll komponiert, beginnt das Stück und beginnen viele Phrasen mit einem Cis. Das ist ein Ton, der nicht zur G-moll-Tonleiter gehört. Er löst sich erst acht Töne später auf. Dazu erfindet Schumann einen Rhythmus, den er über 40 Mal allein im ersten Teil wiederholt. Durch drei schnelle Zweiunddreißigstel wird vielleicht eine blitzschnelle Bewegung des Vogels dargestellt. Ein ruhiger Mittelteil zeigt die Idylle im Wald. Dann wiederholt sich der erste Teil, und das ungewöhnliche Charakterstück geht im Pianissimo zu Ende. Welche eine Fantasie!
Nach diesen Jugenderinnerungen möchte ich einige Klavierwerke Schumanns, geordnet nach Opuszahlen vorstellen. Die meisten davon sind mir gut bekannt, einige habe ich sehr gerne und oft gespielt. Sein op. 1 sind die Abegg-Variationen aus dem Jahr 1830. Das Thema beginnt mit den Noten a-b-e-g-g; man vermutet, dass es eine Dame mit Familiennamen Abegg gegeben habe. Viel ist darüber nicht bekannt. Dieses hinreißende, schwungvolle Erstlingswerk habe ich zuerst im Radio gehört. Sein Thema wird sehr fantasieartig verändert. Einige Abschnitte sind hochvirtuos, so schon Variation 1 und Variation 3. Im „Cantabile" verlangt Schumann Triller, während andere Finger der gleichen Hand die Melodie spielen. Alles übertrifft aber das „Finale alla Fantasia". Hier sprengt Schumann die Form; das wird er noch in vielen späteren Werken erproben. Erstaunlich, wie nach den dramatischen Abschnitten das Stück ganz leise und zart verklingt. Da der Komponist seine Pianisten-Karriere 1831 aufgab, waren die Variationen möglicherweise das letzte eigene Klavierwerk, das er als Pianist vortragen konnte.
„Papillons" („Schmetterlinge") op. 2 ist ein Klavierzyklus, wie ihn Schumann noch sehr oft schreiben sollte. Die 12 Teile sollen nach der Lektüre des Dichters Jean Paul entstanden sein, denn Schumann schrieb passende Randnotizen in sein Exemplar des Romans „Flegeljahre". Einige Teile sind aufbrausend; andere zart und lyrisch. Ein wichtiges Werk sind die „Davidsbündlertänze", 18 Charakterstücke op. 6. Der Titel spielt auf den fiktiven „Davidsbund" an, einen Kreis aus lebenden und verstorbenen Künstlern unter Schumanns Vorsitz. Diese sollten auch in der neu gegründeten „Zeitschrift für Musik" (seit 1834) eine große Rolle spielen. Die für Schumann wichtigsten Personen im Bund waren Eusebius und Florestan. Sie gelten bis heute als seine Pseudonyme, die auch Teile seiner Persönlichkeit zeigen. „Die beiden Charaktere symbolisieren seine Doppelrolle in dem fiktiven Davidsbund ... Florestan ist darin der ‚brausende, übermüthige Sturmläufer'. Eusebius bildet dazu den Gegenpol als ‚der sanfte Jüngling, der sich stets bescheiden im Hintergrund hält'."2
Noch in der Erstausgabe hatte Schumann alle Teile jeweils mit Eusebius oder mit Florestan überschrieben, diese Namen aber in späteren Ausgaben löschen lassen.
Weitere ähnliche Zyklen sind „Carnaval" op. 9, „Kreisleriana" op. 16, „Novelletten" op. 21, „Nachtstücke" op. 23, „Faschingsschwank aus Wien" (Fantasiebilder op. 26), „Bunte Blätter" op. 99, „Ball-Szenen" op. 109, „Albumblätter" op. 124 und „Gesänge der Frühe" op. 133. Schon an den Titeln merkt man die enge Beziehung des Komponisten zu romantischen und poetischen Ideen. Von allen Klavierzyklen Schumanns gefallen mir die Fantasiestücke op. 12 am besten. Ich wurde erst durch einen Konzertbeitrag im Jugendhof Finkenberg (Blankenheim/Eifel) aufmerksam, als eine begabte junge Pianistin „Aufschwung" spielte (op. 12 Nr. 2). Die Leidenschaft, aber auch die Virtuosität, die dieses kurze Stück zeigt, fesselt mich bis heute. Der Zyklus beginnt mit „Des Abends", einer zarten, langsamen Idylle in Des-Dur. Vordergründig hört man eine einfache Melodie, von dunklen Klängen begleitet. Schaut man aber auf die Noten, wird die komplizierte Grifftechnik klar, die der Spieler beherrschen muss, um das Stück bestens vorzutragen.
Hier einige grundsätzliche Bemerkungen zum Klaviersatz bei Schumann. Ich habe sie dem sehr lesenswerten Fachbuch von Klaus Wolters entnommen. „… sein Satz ist in den seltensten Fällen offen und einfach, vielmehr in der Regel merkwürdig und verschlungen und dicht verwoben, ein Knäuel schwer zu entwirrender Fäden, ineinander verflochtener Harmonien, polyphoner Bildungen, synkopischer Füllnoten, durchgebundener Mittelstimmen etc. Auch liebt er das Ineinanderschieben und Überlagern der Hände … Er gewinnt … eine Farbigkeit, einen Reichtum an kleinen Nuancen, wie es ihm zu seiner Zeit nur Chopin gleichtut."3
Auch das langsame, verträumte „Warum?" fordert den Spieler, weil die Melodie in allen denkbaren Lagen erscheint. Pianistisch sehr anspruchsvoll sind die Stücke „Grillen", „In der Nacht", „Fabel", „Traumes Wirren" und das herrliche Finale. Schumann nennt es „Ende vom Lied" und schreibt dazu: „... am Ende löst sich doch Alles in eine lustige Hochzeit auf – aber am Schluß kam wieder der Schmerz um Dich dazu und da klingt es wie Hochzeit- und Sterbegeläute untereinander.“ 4 Auf der letzten Seite meiner Henle-Ausgabe stehen durchgehend Forte- und Fortissimo-Anweisungen. Schumann wusste gut um die Wirkungen dramatischer Effekte und Steigerungen. Er lässt das Finalstück aber in einer äußerst langsamen, sehr nachdenklich wirkenden Passage ausklingen. Hier überwiegt die ganz tiefe Lage des Klaviers, und hier geht Schumann vom piano zum pianissimo und gar zum ppp über.
Zwei Dinge sind noch bemerkenswert. Erstmals verwendet der Komponist hier Überschriften, die wie ein Programm verstanden werden könnten. Dagegen hat er sich aber verwahrt; er schreibt, dass er die Titel erst nachträglich dazu erfinde. Die Fantasiestücke entstanden in einer Zeit, als Schumann sich Claras Liebe noch nicht ganz sicher war. Er lernte in Leipzig die hübsche schottische Pianistin Robena Anne Laidlaw kennen. Es war wohl nur eine kurze Freundschaft; immerhin widmete er das Werk der hochgerühmten Pianistin.
Von seinen drei Klaviersonaten kenne ich nur die erste (op. 11) ganz gut. Sie entstand für seine spätere Ehefrau Clara mit der Widmung: „Clara zugeeignet von Florestan und Eusebius". Damit haben wir schon eine Vorschau auf das Wesentliche dieses Frühwerks: Den biografischen Hintergrund und die zwei unterschiedlichen Charakterzüge, die Schumann sich selbst zuschrieb, das Stürmische und das in sich Gekehrte. Ganz stürmisch beginnt der erste der vier Sätze. Eine kraftvolle Fis-moll-Melodie wird von aufbrausenden Triolen der linken Hand begleitet. Wahrlich ein Sturm der jungen Liebe. Im zweiten Satz (Aria in A-Dur) erscheint der andere Charakter. Langsam erklingt eine sehnsuchtsvolle Melodie über den vollgriffigen Klängen. Schon der dritte Melodieton ist nicht das erwartete e, sondern der Vorhalt dis. Mit weiteren Seufzermotiven und kühnen harmonischen Wendungen bringt Schumann diese Aria zu einem sanften Ende. Doch noch im vorletzten Takt wird deutlich das bekannte dis angeschlagen, eine Dissonanz zum klingenden A-Dur-Akkord.
Mit einem flinken Scherzo setzt Schumann seine ungewöhnliche Sonate fort. Äußerlich in A-B-A-Form, überrascht der Komponist im Mittelteil (Intermezzo in D-Dur) mit einer völlig anderen Welt. „Alla burla, ma pomposo" ist vorgeschrieben. Es erklingt eine Art Polonaise, aber fast ins Groteske überzeichnet. Diese Teil ist mit Sprüngen und punktierten Rhythmen überladen. Aber das ist noch nicht alles: Das Intermezzo endet mit einem Rezitativ. Das mag wohl an eine Oper erinnern. Allerdings mit Augenzwinkern, denn die Pianisten sollen diese Stelle „scherzando" (also lustig) vortragen. Der sehr lange vierte Satz bringt das Stürmische wie auch das Lyrische zur Geltung. Seit ich die Sonate erstmals im Radio gehört habe, fiebere ich den Fis-Dur-Akkorden auf der Schlussseite entgegen. Ich habe wohl eine Vorliebe für diese dramatischen Ausklänge, wie ich sie auch von Beethoven, Mendelssohn, Weber, Chopin und Liszt kenne. Aber auch Schumann kann es. Hier schreibt er zweimal accelerando vor, das ist nach 30 Minuten Spielzeit ganz heikel. Dann aber noch stringendo molto (im 11. Takt vor dem Ende). Ich bewundere Emil Gilels (1959) und Evgeny Kissin (2002), wie furios sie den Schluss der Sonate gestalten. Beide sind auf YouTube zu sehen.
Ein Jahr vor dem Ende meiner Schulzeit spielte ein junger, sehr begabter Pianist anlässlich seiner Abiturfeier in der Aula meiner Schule ein schwieriges Werk. Es war das Finale aus Schumanns „Symphonischen Etüden in Form von Variationen" (op. 13). Nur aus den kolportierten Bemerkungen meines Musiklehrers weiß ich, dass der junge Mann auswendig spielte – und dabei einmal den Faden verlor. Ohne eine Sekunde zu zögern, ergänzte er irgendetwas aus dem Stegreif und kam dann wider Erwarten zum glücklichen Ende. Im Saal soll es keiner bemerkt haben (wirklich nicht?)! Seitdem habe ich die Noten zu diesem herrlichen Werk in Besitz. Immer wieder habe ich die einzelnen Variationen geübt, allerdings in langsamem Tempo. Nur das Finale könnte ich – nahezu – fehlerlos vortragen. Für mich hat Schumann mit seinem op. 13 einen Gipfel seiner Klavierkunst errungen.
Warum der Titel „Symphonisch"? Nicht das Orchester wollte er nachahmen. Aber Schumann schöpft in allen 12 (und in noch weiteren, zuerst nicht gedruckten) Variationen aus einer weiten Ausdrucksskala, die nur das Orchester bietet. In Cis-moll und äußerst langsam kommt das Thema daher, es wirkt wie ein Trauermarsch. Es ist ganz klassisch und regelmäßig gegliedert und besteht aus vier viertaktigen Phrasen: A A’ B A’'. Schumann wählt eine vollgriffige Akkord-Begleitung. Die vier- bis siebenstimmigen Akkorde sind oft so weit gefasst, dass der Spieler nur mit Hilfe von Arpeggio (nacheinander Anschlagen) und mit dem Pedal zurechtkommt. Als ich einmal einen Klavier-Workshop in Düsseldorf besuchte, konnte ich erstaunt feststellen, wie viele Nuancen professionelle Pianisten aus den überwiegend leise gehaltenen Klangflächen gestalten können.
Hier, in op. 13, sind alle Variationen Charaktervariationen, also nicht etwa nur mit Dekorativen, mit Zierwerk ausgestaltete Wiederholungen des Themas. Sondern jede Variation ist ein Unikat und folgt nur lose der Melodie des Themas. Schumann selbst sagte dazu, er wolle „das Pathetische, wenn etwas davon [im Thema] drinnen ist, in verschiedene Farben … bringen“. Und weiter: „Ich möchte gern den Trauermarsch nach und nach zu einem recht stolzen Siegeszug steigern und überdies einiges dramatisches Interesse hineinbringen, komme aber nicht aus dem Moll, und mit der ‚Absicht' beim Schaffen trifft man oft fehl und wird zu materiell.“ 5 Es ehrt den Meister, dass er seinen eigenen Arbeitsfortschritt kritisch beleuchtet; ich finde hingegen, die mir vorliegenden (gedruckten) Variationen sind meisterhaft – und der Siegeszug ist mit dem herrlichen Finale überdeutlich hörbar.
Von den vielen interessanten Eigenschaften will ich nur einige erwähnen. Schumann hat Kanon und Kontrapunkt gut gelernt! Das hören wir in den Variationen 1, 3 und 4. Auch Nr. 7 beginnt mit einem fantasievollen Kanon. Die Geläufigkeit der linken Hand wird in Variation 9 gefordert, sehr schnelle Akkordbrechungen sollen im Pianissimo erklingen. Und dann erst das Finale! Es ist eine Welt für sich. Schumann hat endlich den Dur-Klang erreicht. Vollgriffig beginnt er mit einem emphatischen Aufschwung in Des-Dur, der bis zum f3reicht. Es ist ein ganz neuer Einfall, der nichts mit dem Anfang der Variationen zu tun hat. Bei allem Ideenreichtum ist das Hauptthema klar in zweitaktige Abschnitte gegliedert. Ein 2. Teil kommt in verschiedenen Tonarten wieder. Mit gewaltigen und gekonnt auskomponierten Crescendo-Übergängen erreicht Schumann nach über 170 Takten wieder das Hauptthema. Der Anfang scheint Ton für Ton wiederzukehren, da klingt im 10. Ton der Melodie statt B-moll ein strahlendes B-Dur. Ähnliche Effekte können wir auch bei Schubert, Chopin, Liszt, Brahms und bei Tschaikowsky hören. Ich glaube, Schumann wendet diesen Effekt sehr selten an. Nach zwei Takten in B-Dur kehrt Schumann zur Originaltonart Des-Dur zurück und beendet das Variationenwerk mit einer rauschhaften Stretta, die dem Spieler noch einmal viel Treffsicherheit abverlangt. Nun ist es erreicht: Das Werk ist dramatisch, symphonisch und ein wahrer „Siegeszug"!
In einer schwierigen Zeit, was seine Liebe zu seiner späteren Frau Clara Wieck angeht, schrieb Schumann sein op. 17, die Fantasie in C-Dur. Sie entstand 1836, ein Jahr vor ihrer heimlichen Verlobung. In diesem Jahr hatte Claras Vater sämtliche Kontakte der Liebenden unterbunden. Schumanns Klavierfantasie ist eines der bedeutendsten Werke der Romantik; sie wird oft mit Schuberts „Wanderer-Fantasie" in einem Atem genannt.
Der Komponist hat sein Werk klar in drei Sätze eingeteilt (das widerspricht eigentlich dem Fantasie-Gedanken). Aus dem 1. Satz spricht der wilde, ungestüme Eusebius-Charakter (siehe die Vorschrift „Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen"). Schumann schrieb dazu an Clara: „Der erste Satz davon ist wohl mein Passionirtestes, was ich je gemacht – und eine tiefe Klage um Dich – die anderen sind schwächer, brauchen sich aber nicht gerade zu schämen." (Brief vom 18. März 1838). Schauen wir nur auf die erste Notenseite. Sie zeigt die Turbulenz der rasend schnellen Achtelnoten in der linken Hand, die 48 Takte lang die Melodie begleitet. Diese und viele der noch kommenden Melodien im ersten Satz suchen die Auflösung; sie wird uns allerdings oft vorenthalten. Mir scheint, ich höre einen Aufschrei, ein Vorwärtsdrängen heraus, aber ohne Erlösung, ohne Erfüllung.
Einen völlig anderen Charakter hat der 2. Satz „Mäßig. Durchaus energisch". Hier hat Schumann einen festlichen Marsch in Es-Dur komponiert, der wegen der Vollgriffigkeit, der großen Sprünge und der vielen Punktierungen eine weitere Herausforderung für Pianisten darstellt. Es kommt noch ärger: Auf den letzten zwei Seiten stehen so viele vertrackte Sprünge in beiden Händen, dass auch die professionellen Spieler an ihre Grenzen kommen. Erheblich ruhiger beginnt der 3. Satz. In reinen Dur-Klängen (Takt 1 C-Dur, Takt 2 A-Dur, Takt 3 F-Dur) beginnt Schumann eine langsame Idylle. Sie zeigt die in sich gekehrte Versponnenheit, die für einige langsame Schumann-Werke typisch ist. Doch schließlich geht der Satz mit kühnen Wendungen in seine Schlussphase (C-Dur, A-Dur, Des-Dur, G-Dur, C-Dur; in den Takten 130-134). Vier sehr leise C-Dur-Akkorde beenden die Fantasie.
Für mich steht Schumann mit diesem Werk zwischen Beethoven (den er sehr bewunderte) und Liszt, dem er seine Fantasie widmete. Als Studenten erhielten wir von Eckart Sellheim, unserem Klavierdozenten an der Musikhochschule in Köln, das Vergnügen eines Privatkonzerts mit eben dieser Fantasie. Das war meine erste Begegnung mit diesem Meisterwerk. Ich habe nie vergessen, wie Herr Sellheim sich scheinbar beklagte: „In dieser Fantasie gibt es für den Spieler keine Ruhepause; keine Stelle, an der man sich zurück lehnen könnte."
1 zitiert nach https://de.wikipedia.org/wiki/Kinderszenen, abgerufen am 2.9.2021
2https://de.wikipedia.org/wiki/Davidsbündlertänze, abgerufen am 20.10.2021
3 Klaus Wolters: Handbuch der Klavierliteratur zu zwei Händen, Atlantis-Verlag 19772
4https://www.schumann-portal.de/op-12.html, abgerufen am 21.10.2021
5https://www.schumann-portal.de/op-13.html, abgerufen am 27.12.2021
Werke für Klavier zu 4 Händen
Als bekennender Hausmusiker hat Schumann auch in diesem Genre komponiert. Es sind fünf Sammlungen geworden, u.a. die „Ball-Szenen" op. 109 und „Kinderball" op. 130. Mir liegen die „Bilder aus Osten" vor (op. 66), die Schumann 1848 vollendete. Diesen Zyklus habe ich in einer interessanten Aufnahme der Schwestern Anna und Ines Walachowski gehört. Es sind sechs Stücke ohne Titel; Schumann nennt sie „Impromptus", also Improvisationen. Sie wirken überwiegend introvertiert. Obwohl Schumann sich mit dem Orient, zum Beispiel mit dem Dichter Ibn Ali al-Hariri, befasste und auch schon einige Goethe-Gedichte zu diesem Thema vertont hatte, ist in diesen Klavierstücken gar nichts Orientalisches, nichts Exotisches zu finden. Es sind wundernbare Klanggemälde bzw. Stimmungsbilder. Fast alle stehen in b-moll oder in Des-Dur, nur Nr. 5 bevorzugt die f-moll-Tonart. Und dies ist auch mein Favorit! Ein lebhafter 6/8-Takt, so wie er auch von Schubert stammen könnte, ein peitschender, vorwärts drängender Rhythmus spricht aus diesen Noten. Im letzten Stück überwiegen ruhige Töne. Schumann wählt die eigenwillige Vorschrift „Reuig, andächtig". Mit Pianissimo-Akkorden in B-Dur klingt dieser typisch romantische Zyklus aus.