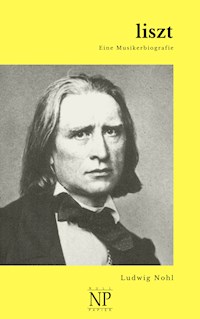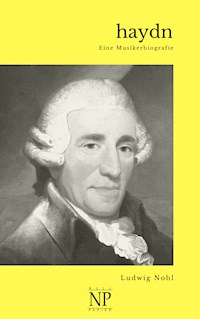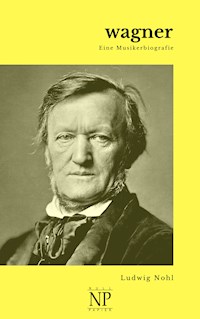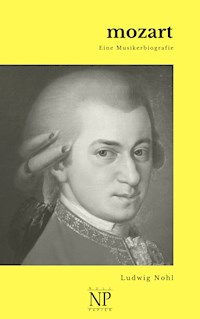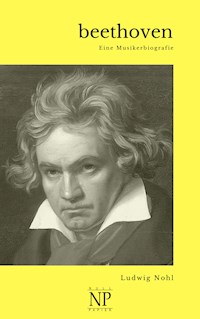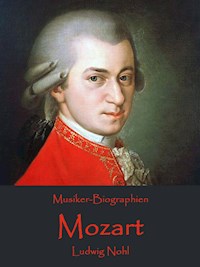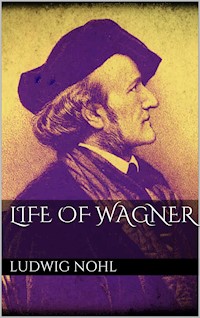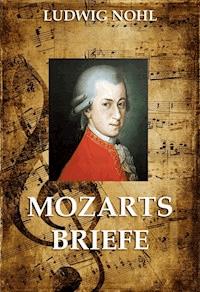Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nohl war einer der meistgelesenen Musikschriftsteller seiner Zeit. Seine zahlreichen Bücher erlebten oft mehrere Auflagen. Inhalt: Vorwort zur zweiten Auflage. Vorwort zur dritten Auflage. Erster Teil. Die Lehrzeit und die Wanderjahre. Die Kindheit. Die Knabenjahre. Der heranwachsende Jüngling. Der Jüngling. Die Prüfungszeit in Salzburg. München und Augsburg. Aloysia Weber. Ein erster Kampf mit dem Vater. Der Aufenthalt in Paris. Das Meisterstück. Zweiter Teil. Die Meisterjahre. Der Austritt aus Salzburger Diensten. Die Entführung aus dem Serail. Die Entführung aus dem "Auge Gottes". Künstlerwirtschaft. Wiener Kunsttreiben. "Figaros Hochzeit." "Don Juan." Die Reise nach Leipzig. "Così fan tutte." "Die Zauberflöte." Das "Requiem."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mozarts Leben
Ludwig Nohl
Inhalt:
Ludwig Nohl – Lexikalische Biografie
Mozarts Leben
Vorwort zur zweiten Auflage.
Vorwort zur dritten Auflage.
Erster Teil. Die Lehrzeit und die Wanderjahre. 1756–1781.
Die Kindheit.
Die Knabenjahre.
Der heranwachsende Jüngling.
Der Jüngling.
Die Prüfungszeit in Salzburg.
München und Augsburg.
Aloysia Weber.
Ein erster Kampf mit dem Vater.
Der Aufenthalt in Paris.
Das Meisterstück.
Zweiter Teil. Die Meisterjahre. 1781–1791.
Der Austritt aus Salzburger Diensten.
Die Entführung aus dem Serail.
Die Entführung aus dem »Auge Gottes«.
Künstlerwirtschaft.
Wiener Kunsttreiben.
»Figaros Hochzeit.«
»Don Juan.«
Die Reise nach Leipzig.
»Così fan tutte.«
»Die Zauberflöte.«
Das »Requiem.«
Mozarts Leben, Ludwig Nohl
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Freesurf - Fotolia.com
Ludwig Nohl – Lexikalische Biografie
Deutscher Musikschriftsteller, geb. 5. Dez. 1831 in Iserlohn, gest. 16. Dez. 1885 in Heidelberg, studierte in Bonn und Heidelberg Rechtswissenschaft und widmete sich nach mehreren Jahren juristischer Tätigkeit ausschließlich der Musik. Von 1861–71 lebte er in München; 1872 ließ er sich als Privatdozent an der Universität in Heidelberg nieder, wurde hier 1880 zum Professor ernannt und wirkte seit 1875 zugleich am Polytechnikum in Karlsruhe als Dozent für Geschichte und Ästhetik der Tonkunst. Nohls verdienstlichste Arbeiten sind Sammlungen von Briefen Mozarts (2. Aufl., Leipz. 1877) und Beethovens (das. 1865, neue Folge 1868) und eine Sammlung von Briefen Verschiedener (»Musikerbriefe«, das. 1867; 2. Ausg., das. 1873). Ferner schrieb er: »Mozarts Leben« ' Stuttg. 1863; 3. Aufl., Berl. 1906); »Beethovens. leben« (Bd. 1, Wien 1864; Bd. 2 u. 3, Leipz. 1867 u. 1877); »Gluck und Wagner« (Münch. 1870); »Beethoven, Liszt, Wagner« (Wien 1874); »Mosaik« (Leipz. 1882, 2. Aufl. 1887); »Das moderne Musikdrama« (Teschen 1884); »Die geschichtliche Entwickelung[729] der Kammermusik« (Braunschw. 1885); »Beethoven, nach den Schilderungen seiner Zeitgenossen« (Stuttg. 1877) und »Mozart, nach den Schilderungen seiner Zeitgenossen« (das. 1880) u.a.
Mozarts Leben
Vorwort zur zweiten Auflage.
Wenn beim Erscheinen dieses Buches im Jahre 1863 nicht in hergebrachter Weise Auskunft über Absicht und Charakter desselben gegeben ward, so geschah dies einzig in der Gewißheit, daß was bei mir selbst aus klarer Anschauung der Sache hervorgegangen war, auch von anderen so aufgenommen sein werde.
Ich hatte mir vorgesetzt ein künstlerisches Bild dieses Mozart aufzustellen, so wie es bisher nirgend versucht und noch weniger gegeben war, am wenigsten aber mit einer Arbeit hatte erreicht werden können, welche wie die bekannte Biographie von O. Jahn rein aus kunsthistorischen Beweggründen unternommen und in wissenschaftlicher Form ausgeführt ward. Hier erschien allerdings das Material reichlich zu Tage gefördert und fleißig durchgearbeitet. Allein die lebendige Persönlichkeit und eigene Erscheinung des Meisters konnte nur stückweise und mehr zufällig hervortreten. Denn die freie und lebensgleiche Gestaltung des Stoffes, so wie sie einzig die bestimmte künstlerische Absicht hervorzubringen vermag, ist hier, wenn sie überhaupt mit im Zweck der Sache lag, keinenfalls zur Verwirklichung gelangt. Durchweg herrscht vielmehr, wie dies eben in der Natur der wissenschaftlichen Arbeit begründet ist, das Material, d.h. die mit Fleiß erforschte und sicher begründete sachliche Richtigkeit vor, nirgend aber erscheint deutlich und unmittelbar vor unseren Sinnen jenes gestaltet lebendige und völlig frei Dahinwandelnde, das uns wie der vom Zwang der Materie zu Freiheit und Selbstsein erlöste Mensch anmutet und das eben einzig die Kunst herzustellen vermag. Wer irgend noch Zweifel über diesen rein stofflich mitteilenden Wert und Charakter des Jahnschen Buches haben konnte, dem mußten sie durch die gekürzte neue Ausgabe völlig getilgt werden, da dieselbe eben bei solcher Zusammendrängung des Stoffes selbst nur noch deutlicher den Grundmangel an freier Gestaltung, ja den Abgang einer jeden Absicht und Befähigung erkennen ließ, hier aus eigener Seele neu zu gebären und zu gestalten.
Das lebhafte Gefühl dieses Mangels an einem sonst so wertvollen und mit Recht freudig begrüßten Werke war es denn auch, was mich, als ich nach einer italienischen Reise und der jahrelangen fast ausschließlichen Beschäftigung mit der bildenden Kunst aufs neue zur Musik zurückkehrte, um mich fortan ihrer Geschichte und Wissenschaft völlig zu widmen, sogleich bei der ersten Bekanntschaft mit dem Werke ergriff und je länger je mehr antrieb, einmal selbst zu versuchen: ob denn nicht aus diesem überreichen und wohlzubereiteten Material mit freischaffender Hand auch das volle Bild des Menschen und Künstlers, von dem hier die charakteristischen Züge oft so überraschend kenntlich hervorschauten, sicher und wahr sich hervorarbeiten lasse. Gerade die Erregung des ganzen Menschen, die ich wie gewiß mancher vor mir durch diese erstmalige zuverlässige und ausgiebige Kunde von Mozarts Leben und Schaffen erfuhr, war es, was mir durch Jahre nicht Ruhe ließ und mich unausgesetzt in der inneren Beschäftigung mit dem Gegenstande erhielt, bis endlich wie von selbst der Entschluß hervorsprang, den versuch einer solchen frei künstlerischen und sozusagen rein menschlichen Gestaltung desselben zu wagen.
Und es gehörte ein gewisser Mut dazu und sogar eine Selbstüberwindung. Denn für einen angehenden Jünger dieser Wissenschaft selbst, der seine Existenz auf ein solches neues Fach gestellt, war es nicht unbedenklich von vornherein so den ganzen wissenschaftlichen Ruf aufs Spiel zu setzen und scheinbar zu debutieren – denn die kleineren Werke »Der Geist der Tonkunst« und »Die Zauberflöte« konnten doch nur als Studien und Vorarbeiten zu solch einem größeren Wurfe gelten, – zu debutieren mit dem Auszug von Forschungen eines anderen, also einem völligen Plagiat. Allein eben die stets bestimmter hervortretende Erkenntnis, daß hier ein künstlerisches Bild, sozusagen eine Statue Mozarts, gar nicht beabsichtigt oder doch gewiß nicht geschaffen worden, und das ebenso stets deutlicher aufsteigende Bewußtsein, daß wie mir persönlich die Natur den verstehenden Sinn für die Kunst nicht versagt habe, so auch eine zureichende Gestaltungsfähigkeit in mir leben müsse, nun solch ein Bild aus dem bloßen dunklen Stoff ans Licht hervorzurufen, ließen mich schließlich jede Scheu vor irriger Auslegung und absichtlichem Mißurteil überwinden und frischgemut den Gegenstand anpacken, der dann teils durch eigene glückliche Neufunde, teils aber durch unmittelbare Anschauung namentlich in der Heimat und Wirkensstätte des Künstlers selbst, in Salzburg und Wien, während der Arbeit mehr und mehr eigenes Leben entwickelte und persönliches Gesicht gewann.
So trat ich, meiner berechtigten Absicht mir bewußt und darum auch einen Titel des Werkes zulassend, wie ihn sonst nur Denkmäler zu tragen pflegen, ohne viel verständigende oder gar rechtfertigende Worte vor die Öffentlichkeit d.h. vor denjenigen Teil derselben hin, den ich mir aus meiner eigenen Anschauung heraus als den Betrachter eines solchen nicht wissenschaftlichen Bildes gedacht hatte, – vor diejenigen, die mit natürlich frischen Sinnen in der Kunst die unmittelbare Aeußerung und schönste Blüte unseres Daseins erfassen und daher auch, zumal wenn von einem Künstler die Rede ist, vor allem die lebendig warme Empfindung seiner selbst, sozusagen seine unmittelbare Gegenwart genießen und ihn nach seiner ganzen Art und Erscheinung persönlich vor den Augen dahinwandeln sehen wollen. Und wer wohl drängte zu einer solchen künstlerischen Darstellung und lebensartigen Gestaltung seines Wesens in höherem Maße als eben Mozart, der so sehr selbst der Typus eines wahren Künstlers ist, weil er eben so recht und ganz das Bild eines wahren und ganzen Menschen war!
Diese Aufgabe, deren Bedeutung und Berechtigung wohl niemand weiter zu bestreiten geneigt ist, ich hatte sie mir gestellt und habe sie ausgeführt. Wie weit sie gelungen, darüber habe nicht ich die Entscheidung. Nur versteht sich von selbst, daß sie eine völlig neue und eigene Anordnung des Stoffes erforderte. Es wirkt in jedem menschlichen Lebenslauf ein bestimmtes Gesetz, das wie seinen Anfang und sein Ende, so auch seine wechselnden Hebungen und Senkungen regelt und das Ganze, scheinbar so willkürlich und schwankend, als ein sicher Notwendiges und Gesetzmäßiges darstellt, das jede Willkür ausschließt. Diesen natürlichen Rhythmus eines Lebensganges muß auch die Darstellung desselben haben, wenn sie irgend einen lebensartigen Eindruck machen und die Vorstellung einer natürlichen und menschengestaltigen Art und Bewegung hervorrufen will. Die organischen Knoten- und Wendepunkte eines Menschenlebens müssen auch Norm und Vorbild der Gliederung des Stoffes für den Biographen sein, und hierin glaube ich bei der Ausführung meiner Arbeit, deren Anlage mir übrigens sogleich mein natürliches Gefühl eingab, durch das Bewußtsein meines eigentlichen Ziels wesentlich unterstützt worden zu sein. Wohl mag das eine oder andere im Stoffe selbst stecken geblieben sein, das der völlig unbeschränkten wirklichen Dichterhand hervorzuarbeiten vergönnt gewesen sein dürfte, und Mozarts eigene Art, sein hohes Künstlertum drängt uns ja einen erhöhten Maßstab der Beurteilung in die Hand. Doch hatte ich die Genugtuung, daß das Buch, das darauf berechnet war, so recht ein allverständliches Lebensbild des geliebten Meisters zu werden, sich auch bald im Inland wie im Ausland gute Freunde erwarb und namentlich eben unter denen, die mit unbefangenem Sinn die Kunst als einen edelsten Preis unseres Mühens, als eine schöne Feier des Lebens selbst betrachten und daher auch bei einem solchen wirklich großen Künstler, dessen Schaffen wie alles wahrhafte Werden dem äußeren Verstande ja stets ein Wunder und Rätsel bleiben muß, wenigstens den Menschen recht erkennen und so dem Geheimnis seines überragenden Geistes und beseligenden Könnens doch einigermaßen nahetreten wollen. Zumal die Künstler selbst, Maler wie Dichter und Musiker, haben mir die unzweideutigsten Beweise davon gegeben, daß ich das Rechte gewollt. Und das Gleiche tat, freilich halb unbewußt, aber in um so erfreuenderen Zügen, hin und wieder unsere literarische Kritik.
Umsomehr unbefangen darf das kleine Buch jetzt, wo es seit längerer Zeit vergriffen ist, in einer im einzelnen mannigfach veränderten neuen Auflage vor diejenigen treten, denen es gewidmet ist. Und daß dabei der ursprünglich beabsichtigte Titel »Mozarts Leben« eintritt, versteht sich von selbst, da der unbestimmtere Titel »Mozart« damals vor allem deshalb gewählt ward, weil es das erste Stück einer Unternehmung bilden sollte, die der Lebensbeschreibung unserer großen Meister überhaupt galt. Wobei denn zugleich bemerkt sei, daß das zweite Stück »Beethovens Leben« sein sollte, das jedoch bei der Vornahme selbst zu einer ganz anderen und streng wissenschaftlichen Aufgabe sich gestaltete, mit der durch mehr als dreizehnjährige ernste eigene Forschung zugleich auch gesühnt erscheinen mag, was nach Anschauung der Fachleute mit diesem Mozarts Leben denn doch am Ende am Fach gesündigt worden war. Der dritte Band dieses Werkes aber, »Beethovens letzte zwölf Jahre« liegt ebenfalls im Druck vollendet vor, und es ist also jetzt zugleich der Zeitpunkt gekommen, neben dieses Standbild des großen Mozart auch das des großen Beethoven zu setzen. –
Noch ist hier wohl auch darüber ein Wort erforderlich, wie sich dem Verfasser selbst, dem seit jener Zeit eine erwünschte Fülle von neuen Anschauungen das Bereich des Lebens wie der Kunst um ein gutes Stück weiter gesteckt haben und der längst deutlich erkannt, daß wir in einer größeren Erfüllung jener großen Verheißungen stehen, das Bild unseres Meisters heute darstellt. Und wie könnte es da anders sein, als daß die tiefwarme Empfindung, die uns das herrliche Menschenwesen dieses einzigen Mannes einflößt, und die hohe Wonne, die uns sein unvergleichliches Künstlertum gewährt, stets mehr wachsen, je mehr sich die innere Entwickelung unserer Kunst und unseres Lebens dem Blick erschließt?
Damals freilich, nach dem anhaltenden Verkehr mit dem keuschen und kräftigen Schaffen der Antike und der Renaissance wollte mir das sentimental verweichlichte und süßlich gezierte Treiben, das seit des großen Beethoven Tode in Konzertsaal, Haus und Kirche hereingebrochen, in einem geradezu unleidlichen Achte erscheinen. Ja das noch weit undeutschere und jeder wahren Empfindung hohnsprechende Wesen, das seit C.M. von Webers Tode von unserer Opernbühne Besitz genommen und dieselbe zu einem frivolen Durcheinander von fremder und heimischer Nachbildung des hundertfach Dagewesenen gemacht, mußte mir einen förmlichen Schrecken erzeugen, so daß es nur ein ganz unmittelbar inneres Bedürfen war, was mich zum genaueren Anschauen eines solchen echten Menschen- und Künstlerbildes wie Mozart trieb, an dem wir in jeder Weise neue Nahrung und Stärkung gewinnen können. Allein auch heute, wo wir mit Recht uns sagen dürfen, daß von den Idealen, die diese schöne erste Zeit unserer klassischen Produktion aufgestellt, in der Tat das Höchste und Herrlichste wirklich zu werden begonnen hat und ein Kunstschaffen vor uns steht, das in wahrhaft erhabener Weise die Gesamtheit unserer Anschauungen umfaßt, – gerade heute ist erst recht darauf hinzuweisen, welche hohe Bedeutung für dieses Schaffen eine Erscheinung wie Mozart und zwar nach ihrer menschlichen wie nach ihrer künstlerischen Seite hat. Ja, es liegt in diesem inneren Zusammenhang und dem stets ruhigen Fortbauen auf einem solchen sicheren Boden der einfach ewigen Natur und Art unserer individuellsten Existenz vielleicht die Gewähr für die Lösung der letzten und höchsten Aufgaben unserer Nation in der menschlichen Gesamtentwicklung.
Freilich wie anmutend die Gestalten sind, die echt menschlicher Regung voll uns gleich den klassischen Dichtern auch Mozarts liebliche Tonlinien fest in die Seele prägen, – es sind doch erst die allgemeinsten Grundlagen unserer inneren Existenz, die hier gelegt wurden, es sind nur die zart umrissenen Schatten von den Geistesgewalten, die unser modernes Dasein und vor allem unsere nationale Existenz durchwogen. Noch fehlt die volle Ausprägung und scharfe Individualisierung jener tiefsten und eigensten Grundgewalten, die unsere Gegenwart neu gestalten wollen, und erst heute stehen wir vor den Bildern der Kunst, die wie einst in der schönen Griechenzeit mit energischem Griffel und in sicherer Kenntlichkeit die besondere Physiognomie unseres Daseins zeichnen und als neue Ideale, als Vorbilder jeglichen höheren Bestrebens den kommenden Geschlechtern überliefern.
Allein wie auch unser Dasein gestützt auf frühere oder spätere Jahrhunderte an Gehalt und Kraft, an Würde und jedem Hochbesitz gewonnen haben mag und wie sehr unsere Kunst stets reiner die Quellen des Reinmenschlichen aufgedeckt und von daher den Impuls eines edelsten Schaffens genommen hat, – stets wird uns dieser Mozart ein kräftig belebendes Beispiel davon sein, daß eben alle Kunst einzig dem wahren Menschentum entspringt und der Mensch zu seinem Wesen, zu der Fülle seiner Existenz nur dadurch gelangt, daß er rückhaltlos dem lebendigen Leben sich erschließt, sowie es in seinem unwillkürlichen Bewegen ihm sprudelnd entgegenquillt und ihm die herrlichsten Gestaltungen und wohl gar Ideale der Menschheit in keimvollen Bildungen darreicht. Denn wie wir erst am lebendig warmen Menschenherzen den eigenen Puls lebendig schlagen fühlen, so bieten jede Epoche und jedes Volk ihren Künstlern einzig wahr und rein jene allverständliche und wahren Gehaltes volle Vorstellung des ewig Ewigen, aus der dann sie selbst jene Idealgebilde herzustellen haben, die den Stempel dieses Höheren an sich tragen und einen Teil seiner Wirkung und Unvergänglichkeit davon für sich hinwegnehmen.
In diesem Sinn vor allem ist uns auch heute die Künstlererscheinung Mozarts von lebenzeugender Bedeutung. Er traf den allgemeinsamen Gehalt des Daseins eben dadurch, daß er unbefangen offen sich dem Sein und Empfinden seiner Tage hingab. Er vernahm den leisen Wandel des Weltgeistes durch die wechselnden Erscheinungen des Lebens, weil er dem Gang der ihn umspielenden Wirklichkeit und dem Pulse seiner Zeit mit der Seele lauschte. Ja, in einer von fremder Art und Bildung völlig überwucherten Epoche, die kaum noch die Physiognomie des eigenen nationalen Daseins erkennen ließ, wußte er, wie der Dramatiker unserer Tage, Richard Wagner, sagt, »jenen vaterländischen Geist mit seiner Reinheit des Gefühls und seiner Keuschheit der Eingebung als das heilige Erbteil zu betrachten, mit dem der Deutsche, wo er auch sei und in welcher Sprache er sich ausdrücken möge, gewiß ist, die angestammte Größe und Hoheit zu bewahren.« Trotz des welschen Idioms und Formenzwanges, an die er gebunden war, deutete er sich doch auch schon in seinem Figaro und Don Juan als jenen deutschen Meister vor, der in der Zauberflöte seinem Schaffen die herrlichste Krone aufsetzte und der Nation zuerst den Preis aufwies, der ihr auch auf diesem idealsten und umfassendsten Gebiete der Kunst winke, wenn sie bei dem Weg zum Eigenen und Rechten getreu beharre.
Und wir haben ihn gewonnen, diesen Preis einer nationalen Kunst! – Und heute, wo uns dieses »Bayreuth« nah vor der Türe steht, dürfen wir erst recht mit Freude zu den Meistern aufblicken, die die ersten Steine zu diesem monumentalen Geistesbau bewegt haben. Mozart gehört zu ihnen: er redete zuerst in der Musik die Sprache des Herzens und weil dieses Herz selbst rein und edel und schön war, die Sprache der Schönheit. Ihm bleibe unsere Verehrung, unsere Liebe geweiht. Er führt uns zu den Stufen des Tempels, in dem wir unser besseres Teil, unser Unvergängliches wiedergewinnen. Er ist der Genien einer, denen wir uns mit unserem Herzen anvertrauen dürfen. Mit diesem Herzen war es auch, daß ihm dieses Denkmal seines Lebens und Schaffens gesetzt ward. Möge dasselbe denn ebenso aufgenommen werden.
Heidelberg, den 6. Juli 1876.
Der Verfasser.
Vorwort zur dritten Auflage.
An Stelle des inzwischen verstorbenen Verfassers sieht sich bei Herausgabe der dritten Auflage dieser bekannten und beliebten Biographie diesmal der unterzeichnete Verlag veranlaßt dem von Dr. Paul Sakolowski durchgesehenen und bearbeiteten Neudrucke dieses standard-Werkes der musikalischen Literatur einige Worte mit auf den Weg zu geben.
Obwohl seit dem Erscheinen der vorigen Auflage 30 Jahre verflossen sind und das vor mehr als 40 Jahren erstmals erschienene Werk lange Zeit hindurch vergriffen war, so hat sich doch bisher niemand berufen gefühlt, einen Ersatz dafür zu bieten, wahrscheinlich, und zwar nicht in letzter Linie deshalb, weil besseres zu bieten nicht so leicht möglich ist. Die große vierbändige Arbeit O. Jahns kommt fast ausschließlich für den kleinen Kreis wissenschaftlicher Forscher in Betracht. Eine andere größere, aus den Quellen schöpfende, die umfangreiche Korrespondenz Mozarts eingehend berücksichtigende, für jedermann verständlich geschriebene und von liebevoller Verehrung zu dem großen Meister durchwehte Lebensbeschreibung existiert nicht. Aus diesem Umstand erklärt sich wohl die andauernde rege Nachfrage, die das Erscheinen einer Neu-Auflage dieser klassischen Biographie notwendig machte. Diese füllt tatsächlich in der Musik-Literatur eine entstandene Lücke aus, die von der inzwischen heranwachsenden musikliebenden Generation unangenehm empfunden wurde. Wir hielten es für eine Ehrenpflicht, zum 150. Geburtstage des ewig jungen Genius allen Freunden seiner Muse dieses Werk in völlig neuer Bearbeitung und zeitgemäßer Ausstattung als Jubiläumsgabe darzureichen.
Berlin, im Januar 1906.
Die Verlagsgesellschaft.
Erster Teil. Die Lehrzeit und die Wanderjahre. 1756–1781.
Erster Abschnitt.
Die Kindheit.
1756–1766.
»Wie sich Verdienst und Glück verketten.«
Wolfgang Amadeus Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren.
Salzburg, dieses Stück Paradies in Deutschland, dieses Juwel unter den Städten unseres nordischen Vaterlandes, das mit seinem Ueberreichtum von Türmen und Kuppeln voll blitzender Kreuze und Kugeln wie ein Kunstwerk daliegt, auf dem kleinsten Raume auferbaut, eingeklemmt zwischen einen raschen Strom und den schroffen Hügel, von dessen warten der froh erstaunte Blick sich von all der Herrlichkeit der Gegenwart, die ihn umgibt, bald träumend in die vergangenen Tage, ja in die Ewigkeit richtet und bedenkt, was war und was sein wird! Diese Stätte von Kirchen und Palästen, ein Bild des ungemessenen Reichtums der Bürger und üppiger Prunksucht kunstsinniger Fürsten, ein Spiegel all der Hoffart früherer Tage und wiederum der Verehrung eines Höheren, dem sie ein Abbild setzen wollten! Eine Stadt, in deren Physiognomie sich sinnliche Ueppigkeit mit einem feinen Gefühl für das Schöne oder doch für das Heiter-Gefällige und Prächtige mischt, – die, unter dem ernsten nordischen Himmel gelegen, mit der Aussicht auf jene schneeigen Berge, durch die wir so ewig unerreichbar von dem milderen Süden, von dem Lande der Schönheit geschieden sind, in ihrem Baue die freie Art Italiens wiederspiegelt, eine seltene Vereinigung deutschen Ernstes und hesperischer Heiterkeit, – die durch ihre reizende Schönheit die Sinne berauscht und jeden, der sie einmal in ihrer ganzen Pracht sah, wie bezaubert festhält, daß er im Scheine der allbelebenden Sonne sich niederlegt auf der Bastei des Mönchsberges oder unter der kleinen Buche hoch auf dem Felsen des Kapuzinerberges, von wo der Fuß sich weigert zurückzugehen, weil im Gemüte ein Verlangen entsteht, immer an der Stelle zu weilen und nahe vor Augen die herrliche Architektur des Domplatzes mit dem großartigsten der deutschen Brunnen und weiterhin die ewigen Berge zu schauen, auf denen die leuchtende Abendsonne den letzten Schnee des Winters rosig färbt, um ihn bald ganz wegzuküssen! In der Nähe die ganze Fähigkeit des menschlichen Geistes, der über das Schaffen der Natur hinaus in wohlgefügten Bauten, in schönster Kunst, sowie sie nur ihm eigen, sein göttliches Vermögen betätigt, und weiterhin wieder die sichere Grundlage all dieses kleinen Könnens der Menschen, die Natur in Weite und Breite, in glänzender Fläche der Wiesen und Felder, durch die sich silbernen Glanzes das lebendige Wasser schlängelt! Dann plötzlich hoch sich auftürmend das starre Gebirge, die Felsen des Untersberges, dessen gewaltige Massen die Phantasie des Volkes von je beschäftigten, der bald ein versteinerter Riese, bald der Sitz kunstverständiger schätzebewachender Zwerge war und noch heute den würdigsten der deutschen Kaiser bewahrt, Friedrich Barbarossa.
Welche Fülle der Poesie birgt alles dieses! Wie wird fast jede Seite unseres Geistes zur lebendigen Tätigkeit erregt! Wie erfüllt die Herrlichkeit der Sagen unser Herz mit dem Gefühl für Größe und Zukunft jeder Art! Wie stimmt die Architektur den empfänglichen Sinn zur Harmonie, wie ahnt er, daß hier nach Maß und Form geordnet erscheint, was in der großartigen Natur umher nur mit gewaltigen Massen in die Breite und Höhe geht! Und wie erweckt wieder diese gewaltige Natur das Bewußtsein von der Erhabenheit des Geistes, der die Welt umspannt! Wie erregt die Ferne der Ebene, die besäet ist mit Häusern und Dörfern, eine lachende Flur der Fruchtbarkeit, in unseren Herzen die Freude am irdischen Dasein und doch wieder die Sehnsucht ins Weite, Weite! Wie erhält sie im Gemüt den Sinn wach für das Große, dem die Enge des alltäglichen Lebens so stets den Odem abzuschneiden droht!
Nun aber bargen diese schönen Bauten, an denen sich der Kunstsinn des Beschauers erfreut, diese herrlichen Gewölbe der Kirchen, in denen die Seele bald an schlanken Pfeilern jählings mit in heiterste Höhen fliegt, bald beruhigt von der sanften Rundung der Decke zu sich selbst zurückkehrt, in ihrem malerischen Innern obendrein für den Knaben, dessen Leben wir hier betrachten wollen, die schönen Vorgänge eines Gottesdienstes, der mit seinen würdig abgemessenen, sinnvollen Bewegungen der goldgewandeten Priester und vor allem durch die begleitende Musik seine Einbildungskraft in eine anmutig fruchtbare Tätigkeit versetzte, und ihn in diesem Akte das Göttliche als lebendig nahe ahnen ließ. Auch dies ist bedeutsam für die jugendliche Phantasie, zumal wenn sie durch die angeborne Neigung auf eine Kunst gerichtet ist, die so durchaus Abbild des Ganzen der Welt und des Lebens ist, wie die Musik. Zudem waren all diese Vorgänge, welche schon die Vorstellung in so anziehender Weise beschäftigen, für Mozart in einem höheren Sinne bedeutsam: sie waren auch seinem Herzen wahr, ein wirkliches Bild des Göttlichen, sie stellten ihm das Ewige in faßlicher Erscheinung dar, und um so tiefer war ihr Eindruck auf seine innere Anschauung, die denn auch hier wie durch die landschaftliche Umgebung frühzeitig zur überschauenden Klarheit und zur Erfassung des Ganzen herangebildet wurde. Die frühe Uebung des Sehens wirkt klärend auf unser inneres Gestalten, zumal wenn dieses Sehen auf ideale und schöne Dinge gerichtet ist.
Allein auch abgesehen von einem Kultus, der durch die Schönheit seiner Formen für die Erweckung der künstlerischen Empfindung so überaus wirksam ist, war es von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung Mozarts, daß er in einem südlichen, in einem rein katholischen lande geboren wurde. Die größere Einheit der menschlichen Natur, die innerhalb dieser Anschauung besteht, vor allem das Ungetrennte von Geist und Sinnen, das sich ja auch in dem Kultus dieser Kirche ausspricht, ist von der größten Bedeutung für eine Tätigkeit des menschlichen Geistes, deren Ziel ist, das Geistige in der schönen Form zur Erscheinung zu bringen. Dem Künstler vor allen anderen gebührt das sinnenhaft Wirkliche als das Element, in dem er sein Inneres ausprägt, und so ist es wohl als ein Glück zu preisen, daß jenes unbefangene, frohe Leben des Südens, das von keiner Reflexion zerstückt ist, unsern Meister schon an der Wiege empfing, und ihm so die angeborene Art des Menschen, Geistiges und Sinnliches ungeschieden zu nehmen, durch keine Ungunst der Umgebung verkümmert wurde, während ein anderer, sein großer Nachfolger Beethoven, von Jugend auf von dem ewigen Widerstreite dieser beiden Dinge, die nur der Verstand scheidet, rastlos umhergetrieben ward und erst spät in seinem Schaffen zu der Vollendung gelangte, die unseres Meisters Schöpfungen schon in früher Jugendzeit schmückt. Es bildete eben ein günstiges Geschick schon früh den Sinn des Knaben, der so herrlich beschenkt war, nun auch für die klare reine Form, die das Wesen des Schönen ist; er lernte rechtzeitig schauen und die deutliche Erscheinung der Dinge für das erste Erfordernis aller Kunst halten.
So in einer herrlichen Natur, in einem frischen und heiteren Dasein, das sich trotz jahrhundertealter Bildung nicht gar zu sehr von der Natur entfernte, ward dieser Mozart geboren. Sein Vater, Leopold Mozart, geboren am 14. November 1719, stammte aus Augsburg, als Sohn eines Buchbinders. Auch in ihm regte sich bereits jener Zug nach einer bedeutenderen Existenz, der in dem Sohne alle gewöhnlichen Schranken des Lebens durchbrechend dem Höchsten zustreben sollte. Neigung und Begabung hatten ihn schon früh über die handwerkerliche Art hinaus zum Lernen getrieben. Er wollte studieren und wählte sich, seiner angeborenen Richtung auf das Verstandesmäßige und nächste Praktische folgend, die Rechtswissenschaft. Zugleich aber hatte er die entschiedenste Neigung zur Musik und vermochte nun, wie das so mancher seiner Zeit tat, mit Lektionen in dieser Kunst sich den Lebensunterhalt zu verschaffen. So war er nach Salzburg gekommen, wo damals eine nicht unberühmte Universität bestand. Doch es währte nicht lange mit dem Studieren. Um seines Unterhaltes willen trat er bald als Kammerdiener in den Dienst des Domherrn Grafen Thurn, ward auch im Jahre 1743 in der Kapelle des regierenden Erzbischofs Sigismund als Hofmusikus angestellt, da er als Jurist keine Anstellung fand. Denn am Ende hatte er sich ganz und gar dieser Kunst gewidmet. Er komponierte mancherlei Kirchenmusik. Auch spielte das Hornwerk, das von der Veste Hohensalzburg herab den Einwohnern der Stadt einst Morgen und Abend verkündete, einige Stücke von ihm. Sodann war sein »Versuch einer gründlichen Violinschule«, den er 1756, im Geburtsjahre seines großen Sohnes geschrieben, und der als der beste seiner Zeit galt, in ganz Deutschland und weiter verbreitet, – Beweise genug, daß er seine Kunst praktisch und theoretisch auch wirklich verstand.
Bereits im Jahre 1747 hatte er eine Pflegetochter des Stiftes St. Gilgen bei Salzburg geheiratet. Sie hieß Anna Maria Pertlin und war sehr schön. Beide galten ihrer Zeit für das schönste Ehepaar in Salzburg. Sie war eine Frau von wahrer Herzensgüte, doch, wie aus ihren Briefen hervorgeht, ohne hervorragende geistige Begabung und auch nicht von jener eigentümlichen sinnlichen Lebendigkeit, die so manche Mutter bedeutender Künstler ihren Söhnen als köstlichstes Gut mit ins Leben gegeben. Vielmehr war sie etwas bequemer Natur, aber nach allem, was von ihr überliefert ist, die treueste Gattin und liebevollste Mutter. Auch hatte sie Verstand genug, um die Pflichten der Frau und Mutter in vollem Umfange erfüllen zu können. Allein ihr schönstes Gut war jene Harmonie des Innern, die so wohltuend auf das Gemüt des Mannes wirkt und für ihre gesamte Umgebung wie für das ganze Leben des Sohnes von großer Bedeutung ward. Ihre echt weibliche Art flößte in seine zarte Seele von Jugend auf das Gefühl für milde Ausgleichung. Ihre Bescheidenheit, die bei ihr eine Tugend des Herzens war, erhielt in ihm, dem von Natur lebhaft zugreifenden Knaben den Sinn, nicht mehr zu wollen, als ihm zukam, und die Reinheit ihres Herzens übertrug die vortreffliche Frau als den schönsten Besitz auf ihren so wunderbar begabten Sohn. Uebrigens hatte sie einen offenen Sinn für des Lebens Freuden, war von einer heitern Laune und teilte auch mit ihren Landsleuten die Neigung für das Derbkomische. Alle diese Eigentümlichkeiten werden wir in ihres Sohnes Charakter zu größerer Selbständigkeit und Bedeutung ausgeprägt wiederfinden.
Von härterem Tone war der Vater. Von Natur scheint er vorzugsweise eine praktisch-sittliche Begabung empfangen zu haben; wenigstens ist ein fester Wille die hervorragendste Eigenschaft seines Charakters. Es ist dies ja überhaupt der alten Reichsstädter Art, und bei ihm war sie obendrein durch ein mühsames Ringen mit dem Leben stärker als bei andern hervorgebildet. Soliden Bürgersinn und etwas Demokratisches, soweit dies im vorigen Jahrhundert möglich war, brachte er mit an den geistlichen Fürstenhof und bewahrte sich damit vor der schmeichelnden Kriecherei, die sich so oft aus der Laune der Herrscher erzeugt. Doch verkennt man andererseits in all seinem Handeln auch den klugen Lebenssinn nicht, mit dem der Mann, der gewohnt war, sich nur auf sich selbst zu verlassen, alle Verhältnisse erfaßt und geschickt zu benutzen weiß. Nur seiner Energie und Klugheit konnte es gelingen, unter so schwierigen Umständen, wie die seinigen waren, in einer von allen Unarten eines kleinen Hofes angefressenen Stadt sich eine gesicherte und geachtete Lebensstellung zu begründen.
Er war von scharfem, ja durchdringendem Verstand. Wir sehen ihn überall in den Fragen des praktischen Lebens der Sache auf den Grund gehen. Durch den Gang seines Lebens hatte er die Unentbehrlichkeit geordneter äußerer Verhältnisse einsehen gelernt und betrachtete von diesem Gesichtspunkte aus das ganze Dasein. Doch schätzte er bei alledem den materiellen Besitz, nach dem er zeitlebens strebte, nicht höher, denn als Mittel zur freien Bewegung. Die letztere freilich erlangte er niemals in einem besonders hohen Grade. Allein zeitlebens wußte er sich unabhängig zu erhalten und ließ nicht nach, seinen Kindern den Wert einer gesicherten Lebensstellung und äußeren Unabhängigkeit einzuprägen. Bei der Tochter gelang es ihm, wie wir sehen werden, vortrefflich, bei dem Sohne nur wenig.
Die idealen Dinge hatten ihm nur so weit Wert, als durch sie der sichere Bestand des Lebens erreicht oder auch verschönt wird. Seine Kunst, so sehr sie ihm angeborene Neigung war, blieb ihm vor allem das Berufsgeschäft, das ihn ernährte. Die Kirche war ihm eine Institution, an die der Mensch sich anlehnt, um desto sicherer sein Leben zu führen. Er war ein guter Katholik, er hielt auch streng an den Vorschriften und Gebräuchen seiner Kirche. Allein er wäre sicherlich ein ebenso guter Protestant gewesen, wenn ihn der Zufall in dieser Konfession hätte geboren werden lassen. Denn ihm galt bei diesen Dingen zunächst die sichere Norm, nach der das Leben sich ordnen läßt. So spekulierte er nicht viel darüber, was besser sei, Katholik oder Protestant. Es stand ihm einfach fest, daß die Lehre seiner Kirche die rechte sei, und wenn er auch auf der Reise nach Paris nicht ganz ohne Verwunderung bei einem protestantischen Adeligen, mit dem er längere Zeit zusammen war, Sittlichkeit und Tugend anerkennt, so hatte er doch wieder offenen Sinn für die moralischen Bestrebungen des nördlichen Deutschland. Er schätzte Gellerts geistliche Lieder so sehr, daß er ihm einmal eigens einen Brief schrieb, den dieser denn auch auf das höflichste beantwortete.
Hier wollen wir nun sogleich einen Brief einschalten, aus dem die achtungswerte Anschauungsweise von Mozarts Vater in ihrem Ernste so recht hervorgeht. »Ich soll Dir zu Deinem Namenstage Glück wünschen«, schreibt er dem Sohne am 31. Oktober 1777, »aber was kann ich Dir itzt wünschen, was ich Dir nicht immer wünsche? – – Ich wünsche Dir die Gnade Gottes, die Dich aller Orten begleite, die Dich niemals verlassen wolle und niemals verlassen wird, wenn Du die Schuldigkeit eines wahren katholischen Christen auszuüben beflissen bist. Du kennst mich. – Ich bin kein Pedant, kein Betbruder, noch weniger ein Scheinheiliger; allein Deinem Vater wirst Du wohl eine Bitte nicht abschlagen. Diese ist, daß Du für Deine Seele so besorgt seyn wollest, daß Du Deinem Vater keine Beängstigung in seiner Todesstunde verursachst, damit er in jenem schweren Augenblicke sich keinen Vorwurf machen darf, als hätte er an der Sorge für Dein Seelenheil etwas vernachlässigt. Lebe wohl! Lebe glücklich! Lebe vernünftig! Ehre und schätze Deine Mutter, die in ihrem Alter nun viele Mühe hat. Liebe mich, wie ich Dich liebe als Dein wahrhaft sorgfältiger Vater.«
Freilich war derselbe Mann, der sogar einmal mit Freuden von Italien aus berichtet, daß er eine Reliquie gekauft, durchaus nicht blind für die Mißstände seiner Kirche. Dergleichen konnte seinem klaren Verstande, der noch durch den strengen Protestantismus seiner Vaterstadt geschärft worden war, durchaus nicht verborgen bleiben; ja er schimpft zuweilen nicht schlecht über Pfaffen und Pfaffenwirtschaft. Allein darum hält er nicht weniger fest an den Regeln der Tugend und Frömmigkeit, die ihm seine Kirche gab, ja er nimmt sie, ohne viel darüber zu grübeln, als bestimmte Gesetze, denen wir nachzukommen haben, wenn es uns im Leben gut gehen soll; er geht regelmäßig zur Beichte wie zur Messe und hält seine Kinder auch so. Auf diese Weise gewöhnt er sich wie sie an eine geordnete Führung des Lebens. Einfaches Rechttun, sowie es das angeborene Gefühl uns angibt, natürliche Sittlichkeit und aufrichtige Frömmigkeit waren die Grundlage all seines Handelns. Mag er nun Moral wie Religion oftmals gar zu sehr als äußeren Dienst gefaßt haben, bestimmend für sein Handeln wie besonders für die Erziehung seiner Kinder waren nur jene Eigenschaften, die aus seinem Herzen wie aus seiner Erfahrung flossen, und so gelang es ihm, der väterlichen Aufgabe schwerste zu lösen: einen Genius zu erziehen. Gerade die beschränktere, die nicht geniale Art, die ihm eigentümlich war, befähigte ihn zu dieser Aufgabe, die er als die seines Lebens betrachtete. Eine strenge und engere Auffassung des nächsten Begriffes der Pflicht, die, durch den Königsberger Philosophen wachgerufen, damals in ganz Deutschland aufkam, machte es möglich, daß der Sohn, dessen Begabung eine so vorwiegend ästhetische war, die Ziele der Kunst auch wirklich erreichte. Zu dem Streben der Freiheit, dem die künstlerische Natur des Sohnes folgte, gab der Vater das Gesetz, das erst die Kenntnis des Lebens gewähren kann und das den Einzelnen in die Zwecke des Ganzen einfügt.
Johannes Chrysostomus Sigismundus Wolfgang Amadeus war von den sieben Kindern L. Mozarts das letzte. Außer ihm war nur eine Schwester, die vier Jahre älter war, am Leben geblieben. Sie hieß wie die Mutter Maria Anna, geboren 30. Juli 1751, und wurde in der Familie schlechtweg Nannerl genannt. An sie, die später einen Herrn von Sonnenberg heiratete, ist der Brief gerichtet, der kurz nach Mozarts Tode von dem Hoftrompeter Schachtner geschrieben wurde und die besten Nachrichten enthält, die wir über Mozarts Kinderjahre besitzen. Er deutet uns zudem den ganzen seelenvollen Genius dieses Oesterreichs an, dem Mozart einst den ebenso unvergänglichen wie reinen ersten Ausdruck verleihen sollte. Er lautet:
»Hochwohledelgeborene gnädige Frau.
Deroselben sehr angenehmes Schreiben, traff mich nicht in Salzburg, sondern in der Hammerau an, wo ich eben bei meinem Sohne, dortigen Mitbeamten beim Obverwesamt auf einen Besuch war; aus meiner sonstigen Willfährigkeit gegen Jedermann, und besonders gegen das Mozart'sche Haus, können Sie schließen, wie sehr leid mir war, daß ich nicht auf der Stelle ihren Auftrag befriedigen konnte. Zur Sache also! auf Ihre erste Frage, was Ihr seel. Hr. Bruder in seiner Kindheit NB. außer seiner Beschäftigung in der Musik für Lieblingsspiele hatte: auf diese Frage ist nichts zu beantworten: denn sobald er mit Musik sich abzugeben anfing, waren alle seine Sinne für alle übrigen Geschäfte soviel als todt, und selbst die Kindereyen und Tändelspiele mußten, wenn sie für ihn interessant seyn sollten, von der Musik begleitet werden: wenn wir, Er und Ich, Spielzeuge zum Tändeln von einem Zimmer ins andere trugen, mußte allemal derjenige von uns, so leer ging, einen Marsch dazu singen oder geigen. Vor dieser Zeit aber, ehe er die Musik anfing, war er für jede Kinderey, die mit ein bischen Witz gewürzt war, so empfänglich, daß er darüber Essen und Trinken und alles andere vergessen konnte. Ich ward daher ihm, weil ich, wie Sie wissen, mich mit ihm abgab, so äußerst lieb, daß er mich oft zehnmal an einem Tage fragte, ob ich ihn lieb hätte, und wenn ich es zuweilen, auch nur zum Spaß verneinte, stunden ihm gleich die hellichten Zähren im Auge, so zärtlich und so wohlwollend war sein gutes Herzchen.
Zweite Frage, wie er sich als Kind gegen die Großen benahm, wenn sie sein Talent und Kunst in der Musik bewunderten?
Wahrhaftig, da verriet er nichts weniger als Stolz oder Ehrsucht: denn diese hätte er nie besser befriedigen können, als wenn er Leuten, die die Musik wenig oder gar nicht verstanden, vorgespielt hätte, aber er wollte nie spielen, außer seine Zuhörer waren große Musikkenner, oder man mußte ihn wenigstens betrügen und sie dafür ausgeben.
Dritte Frage, welche wissenschaftliche Beschäftigung liebte er am meisten?
Antw. Hierinfalls ließ er sich leiten, es war ihm fast einerley, was man ihm zu lernen gab, er wollte nur lernen und ließ die Wahl seinem innigst geliebten Papa, welches Feld er ihm zu bearbeiten auftrug, es schien, als hätte er es verstanden, daß er in der Welt keinen Lehrmeister noch minder Erzieher wie seinen unvergeßlichen Herrn Vater hätte finden können. Was man ihm immer zu lernen gab, dem hing er so ganz an, daß er alles Uebrige, auch sogar die Musik auf die Seite setzte, z.B. als er Rechnen lernte, war Tisch, Sessel, Wände, ja sogar der Fußboden voll Ziffern mit der Kreide überschrieben.
Vierte Frage was er für Eigenschaften, Maximen, Tagesordnung, Eigenheiten, Neigung zum Guten und Bösen hatte?
Antw. Er war voll Feuer, seine Neigung hing jedem Gegenstand sehr leicht an; ich denke, daß er im Ermangelungsfalle einer so vorteilhaft guten Erziehung, wie er hatte, der ruchloseste Bösewicht hätte werden können, so empfänglich war er für jeden Reitz, dessen Güte oder Schädlichkeit er zu prüfen noch nicht im Stande war.
Einige sonderbare Wunderwürdigkeiten von seinem vier- bis fünfjährigen Alter, auf deren Wahrhaftigkeit ich schwören könnte.
Einsmal ging ich mit Herrn Papa nach dem Donnerstagsamte zu Ihnen nach Hause, wir trafen den vierjährigen Wolfgangerl in der Beschäftigung mit der Feder an.
Papa: was machst du?
Wolfg.: ein Concert für's Clavier, der erste Theil ist bald fertig.
Papa: laß sehen.
Wolfg.: ist noch nicht fertig.
Papa: laß sehen, das muß was sauberes seyn.
Der Papa nahm ihm weg und zeigte mir ein Geschmiere von Noten, die meistenteils über ausgewischte Dintendolken geschrieben waren (NB. der kleine Wolfgangerl tauchte die Feder aus Unverstand allemal bis auf den Grund des Dintenfasses ein, daher mußte ihm, sobald er damit aufs Papier kam, ein Dintendolken entfallen, aber er war gleich entschlossen, fuhr mit der flachen Hand darüber hin und wischte es auseinander, und schrieb wieder darauf fort), wir lachten anfänglich über dieses scheinbare galimathias, aber der Papa fing hernach seine Betrachtungen über die Hauptsache, über die Noten, über die Composition an, er hing lange Zeit steif mit seiner Betrachtung an dem Blatte, endlich fielen zwei Thränen, Thränen der Bewunderung und Freude aus seinen Augen. ›Sehen Sie, Hr. Schachtner‹, sagte er. ›wie alles richtig und regelmäßig gesetzt ist, nur ist's nicht zu brauchen, weil es so außerordentlich schwer ist, daß es kein Mensch zu spielen im Stande wäre.‹ Der Wolfgangerl fiel ein: ›Drum ist's ein Concert, man muß so lange exerciren, bis man es treffen kann; sehen Sie, so muß es gehen.‹ Er spielte, konnte aber auch just soviel herausbringen, daß man erkennen konnte, wo er aus wollte. Er hatte damals den Begriff, daß Concert spielen und Mirakel wirken einerley seyn müsse.
Noch Eins.
Gnädige Frau! Sie wissen sich zu erinnern, daß ich eine sehr gute Geige habe, die weiland Wolfgangerl wegen seinem sanften und vollen Ton immer Buttergeige nannte. Einmal bald nachdem sie von Wien zurückkamen, geigte er darauf und konnte meine Geige nicht genug loben, nach ein oder zween Tagen kam ich wieder ihn zu besuchen und traf ihn, als er sich eben mit seiner eignen Geige unterhielt, an, sogleich sprach er: ›Was macht Ihre Buttergeige?‹ geigte dann wieder in seiner Phantasie fort, endlich dacht er ein bischen nach und sagte zu mir: ›Hr. Schachtner, Ihre Geige ist um einen halben Viertelton tiefer gestimmt als meine da, wenn Sie sie doch so gestimmt ließen, wie sie war, als ich das letztemal darauf spielte.‹ Ich lachte darüber, aber Papa, der das außerordentliche Tönegefühl und Gedächtniß seines Kinds kannte, bat mich meine Geige zu hohlen und zu sehen, ob er Recht hätte. Ich that's, und richtig war's.
Einige Zeit vor diesem, die nächsten Tage, als Sie von Wien zurückkamen, und Wolfgang eine kleine Geige, die er als Geschenk zu Wien kriegte, mitbrachte, kam unser ehemalig sehr gute Geiger Herr Wentzl sel., der ein Anfänger in der Komposition war, er brachte 6 Trio mit, die er in Abwesenheit des Herrn Papa verfertigt hatte, und bat Herrn Papa um seine Erinnerung hierüber. Wir spielten diese Trio, und Papa spielte mit der Viola den Baß, der Wentzl das erste Violin, und ich sollte das zweite spielen. Wolfgangerl bat, daß er das zweite Violin spielen dürfte, der Papa aber verwies ihm seine närrische Bitte, weil er noch nicht die geringste Anweisung in der Violin hatte, und Papa glaubte, daß er nicht im mindesten zu leisten im Stande wäre. Wolfgang sagte: ›Um ein zweites Violin zu spielen, braucht es wohl nicht erst gelernt zu haben‹; und als Papa darauf bestand, daß er gleich fortgehen und uns nicht weiter beunruhigen sollte, fing Wolfgang an bitterlich zu weinen und trollte sich mit seinem Geigerl weg.1 Ich bat, daß man ihn mit mir möchte spielen lassen; endlich sagte Papa: ›Geig mit Herrn Schachtner, aber so stille, daß man dich nicht hört, sonst mußt du fort.‹ Das geschah, Wolfgang geigte mit mir. Bald bemerkte ich mit Erstaunen, daß ich da ganz überflüssig sei; ich legte still meine Geige weg und sah Ihren Herrn Papa an, dem bei dieser Scene die Thränen der Bewunderung und des Trostes über die Wangen rollten; und so spielte er alle 6 Trio. Als wir fertig waren, wurde Wolfgang durch unsern Beifall so kühn, daß er behauptete, auch das erste Violin spielen zu können. Wir machten zum Spaß einen Versuch, und wir mußten uns fast zu Tode lachen, als er auch dieß, wiewohl mit lauter unrechten und unregelmäßigen Applicaturen doch so spielte, daß er doch nie ganz stecken blieb.
Zum Beschluß. Von Zärtlichkeit und Feinheit seines Gehörs.
Fast bis in sein zehntes Jahr hatte er eine unbezwingliche Furcht vor der Trompete, wenn sie allein, ohne andere Musik geblasen wurde; wenn man ihm eine Trompete nur vorhielt, war es ebensoviel, als wenn man ihm eine geladenen Pistole aufs Herz setzte. Papa wollte ihm diese kindische Furcht benehmen und befahl mir einmal, trotz seines Weigerns, ihm entgegen zu blasen; aber mein Gott! hätte ich mich nicht dazu verleiten lassen. Wolfgangerl hörte kaum den schmetternden Ton, ward er bleich und begann zur Erde zu sinken, und hätte ich länger angehalten, er hätte sicher das Fraise (Krämpfe) bekommen.
Dieses ist beiläufig, womit ich auf die gestellten Fragen dienen kann, verzeihen Sie mir mein schlechtes Geschmier, ich bin geschlagen genug, daß ich's nicht besser kann. Ich bin mit geziemend schuldigster Hochschätzung und Ehrfurcht
Euer Gnaden
ergebenster Diener
Andreas Schachtner,
Hochfürstl. Hoftrompeter.«
Salzburg, den 24. April 1792.
Dieser einfach treuherzige Bericht gibt genügende Auskunft sowohl über des Wunderkindes Begabung wie über seine liebenswürdige, folgsame, sinnige und doch so kindlich freie Art. Im Alter von 51/2 Jahren (1761) sehen wir den Knaben bereits als kleinen Choristen bei der Aufführung eines Liederspieles »Sigismundus, Hungariae rex« von Johann Ernst Eberlin (1702–1762) in der Aula der Salzburger Universität mitwirken.
Als nun der Bube sechs und das Mädel zehn Jahre alt war, beschloß der Vater, ihr so ganz außerordentliches Können der Welt zu zeigen. Er begann mit ihnen zu reisen.
Zuerst gingen sie (1762) nach München und auf der Reise dahin schon erregte Wolfgang im Kloster Ips bei Amstetten in Niederösterreich bei den Ordensbrüdern durch sein Orgelspiel, namentlich durch seine Pedaltechnik, gerechtes Staunen. Als in München sowohl an Ehre wie an Geldgewinn die Erwartungen eingetroffen waren, die der Vater gehegt hatte, reisten sie nach Wien, um sich an dem so sehr musikalischen Kaiserhofe zu produzieren. Maria Theresia sowie ihr hoher Gemahl empfingen die Kleinen mit der größten Gnade und ließen sie vor sich im Privatkreise in Schönbrunn spielen. Wolfgangerl, wie immer unbefangen und natürlich, sprang der Kaiserin, da sie gar so freundlich gegen ihn war, ohne weiteres auf den Schoß und küßte sie nach Herzenslust. Nicht viel anders machte er es mit der reizenden Marie Antoinette, die mit ihm gleichalterig war. Er war auf der ihm ungewohnten Politur des Hofbodens ausgeglitten und hingefallen, die Kleine sprang zu ihm und half ihm auf, worauf er zu ihr sagte: »Sie sind brav, ich will Sie heiraten«. Und als die Kaiserin ihn fragte, warum er das tun wolle, antwortete er: »Aus Dankbarkeit; sie war gut gegen mich, während ihre Schwester sich um nichts bekümmerte.« Diese hatte ihn nämlich am Boden liegen lassen. Besondere Bewunderung erregte Wolfgang auch noch dadurch, daß er sogar auf der mit einem Handtuch verdeckten Klaviatur sofort völlig sicher improvisierte. Die Kaiserin schenkte den beiden kleinen Virtuosen neue Gewänder ihrer eigenen Kinder, und in diesem Kostüm wurden sie lebensgroß gemalt. Das Bild hängt im Mozartmuseum in Salzburg und zeigt von Wolfgang nur das komisch Freundliche des Kindergesichtes, während die Nannerl überaus große Schönheit der Züge und Lieblichkeit des Ausdrucks verrät.
Nachdem der Hof in solcher Weise die Kinder ausgezeichnet hatte, und in allen Blättern enthusiastische Gedichte in allerlei Sprachen auf sie erschienen waren, riß sich auch der hohe Adel, dessen Gesellschaften zu der Zeit niemals ohne musikalische Produktionen waren, um die jungen Künstler, und die Familie kehrte nach einem mehrmonatlichen Aufenthalte mit Ruhm bedeckt und nicht ohne einen bedeutenden äußeren Gewinn nach Salzburg zurück. Hier nun ward der Unterricht der Kinder, der auch auf der Reise niemals ausgesetzt worden war, damit sie sich an regelmäßige Beschäftigung gewöhnten, mit der allergrößten Sorgfalt fortgeführt. Wolfgang begann außer dem Klavier, wie wir oben sahen, auch »das Violin« zu erlernen und wurde zudem in den Anfangsgründen der Komposition auf die stetige Weise angewiesen, die der verständige Vater in all seinen Dingen hatte.
Allein diesem Manne ließ es nicht gar lange Ruhe in dem engen Salzburg. Schon im Frühjahr 1763 ging es wieder mit den Kindern auf die Reise, deren Hauptziel Paris war. Zunächst wurden Nymphenburg bei München und Augsburg berührt, dann die mancherlei kleinen Höfe und Lustschlösser bis an den Rhein: das des Herzogs von Württemberg in Ludwigsburg, die des Kurfürsten von der Pfalz in Schwetzingen und Heidelberg. Wolfgang hatte unterdes auch die Orgel spielen gelernt und erregte durch sein Spiel auf diesem Rieseninstrumente mehr Erstaunen als mit Violine und Klavier. Die kleinen Füße fuhren mit einer Hurtigkeit auf dem Pedale umher, daß sich die Zuschauer fast zu Tode erstaunten und der Pfarrer an der Heiligengeistkirche in Heidelberg nicht umhin konnte, dieses »Wunder Gottes« mit Namen und Datum zum ewigen Angedenken an die Orgel anzuschreiben. Es folgten Konzerte in Mainz, Frankfurt, Koblenz (vor dem Kurfürsten von Trier), Bonn, Aachen (vor der Prinzessin Amalie von Preußen, der Schwester Friedrichs des Großen), Brüssel (vor dem Gouverneur der Niederlande, dem Prinzen Karl von Lothringen), und überall gab's den gleichen Beifall, überall auch eine mehr oder weniger gute Einnahme. Der Vater aber unterließ nicht, in jeder Stadt, die er berührte, das Sehenswerte anzuschauen, und sein »Mädl« mußte ein Tagebuch führen über diese Merkwürdigkeiten. Sie hat denn auch mit großen Kinderbuchstaben aus Leibeskräften und oft in seltsamster Orthographie aufgezeichnet, was ihr besonders merkwürdig erschien: »in Wisbad den ursprung von den warmen und kald Bad, in Bibrich den garten das schloß worin ein runder fall ist, in Coblentz die festung das zeighaus, in bonn daß schloß und garden, popeldorf, und den heiligen creutzberg und die menascherie, auf dem weg nach Cölln falkenlust worin ein Zimmer von lauter spiegeln ist, das indianische Haus, kinesische häusser, das schneckenhaus und die capel von muschel, in versailles wie die latona die Bauern in frösch verwandelt, wie der neptunus die Perdt anhält, die diana im Bad, der Raub der broserpina« usw.
In Paris, wo sie beim bayerischen Gesandten Grafen Eyck wohnten, war es vor allen der einflußreiche Schriftsteller Baron Melchior Grimm, der sich der Künstlerfamilie auf das nachdrücklichste annahm und besonders in seinen öffentlichen Berichten das Lob des jungen Genius laut und geistreich verkündete. Aber auch der Hof in Versailles und nach ihm der hohe Adel interessierten sich überaus für das Wunderkind, das jeden Ton nach dem bloßen Gehöre zu benennen wußte, das ohne Klavier komponierte, alles vom Blatte spielte, ja sogar nach dem bloßen Gehör zum Gesänge begleitete. Freilich war die Marquise von Pompadour, die derzeit am Hofe alles galt, gegen den Knaben nicht so mütterlich wie Maria Theresia. Denn als er sie, die ihn vor sich hin auf den Tisch hatte stellen lassen, ebenso ohne weiteres umhalsen und küssen wollte, wehrte sie seiner kindlichen Zutunlichkeit, worauf der Kleine in stolzer Entrüstung meinte: »Wer ist denn die da, daß sie mich nicht küssen will? hat mich doch die Kaiserin geküßt!« – wie er denn überhaupt auf die Kaiserin große Stücke hielt und gern in Kinderart mit ihr renommierte. Desto freundlicher waren die Töchter des Königs, die sich ohne alle Rücksicht auf die Etikette mit den Kindern abgaben, sie küßten und sich von ihnen die Hände küssen ließen.
Von Paris ging es über Calais nach London. Dort war die Aufnahme bei Hofe und der Erfolg beim Publikum noch günstiger als in Paris. Denn das Königspaar Georg III. und Sophie Charlotte, beides Deutsche, waren außerordentliche Freunde der Musik. Aber auch das Publikum war hier ungleich mehr für die künstlerischen Leistungen der Kinder interessiert, als für das Wunderbare derselben bei solcher Jugendlichkeit. Von der französischen Musik wie von dem Pariser Leben fand der Vater nicht viel Rühmliches zu sagen. Jene war ihm leer, frostig, ein langweiliges Geplärre, dieses durch sein luxuriöses Großtun ohne wirklichen Reichtum ein Pendant zum weiland persischen Reiche, dem Gott besonders gnädig sein müsse, wenn es nicht bald untergehn solle. In London aber hatte unser Händel den Sinn für ernstere Musik erweckt, und ein Johann Christian Bach (1735 bis 1782) wußte den besseren Geschmack zu erhalten. So kam es, daß der Vater lange dort verweilte und zugleich seinen Knaben von der Kunst des ausgezeichneten Sängers Manzuoli, geboren 1725, Nutzen ziehen und gar schon Symphonien für das Orchester schreiben ließ, die sie dann in ihren Konzerten aufführten. Mit Ruhm und Geld überschüttet traten sie die Rückreise an. Im Haag wurden beide Kinder nacheinander lebensgefährlich krank, und so der Mut und die Klugheit des Vaters monatelang auf harte Probe gestellt. Aber getreulich hielten die Eltern diese Not aus, und nachdem der Vater noch in Amsterdam »zu Gottes Preis« die Wundergaben seines Knaben selbst in den Fasten hatte produzieren dürfen, kehrte die Familie über Paris, wo sie diesmal nicht die gleiche Aufnahme wie vorher fanden, Dijon, wo die Stände Frankreichs versammelt waren, Lyon, Genf, Lausanne durch Württemberg und Bayern nach Salzburg zurück.
Man sieht, es war ein schönes Stück Erde, das die Kleinen zu sehen bekamen, und frühzeitig ward Mozart gewöhnt, die Welt als einen freien Tummelplatz zu betrachten, auf dem man sich mit frischer Freude und offenen Sinnen nach den Zielen des Lebens hin vorwärts treiben könne. Frühzeitig verlernte er die Blödigkeit, mit der so mancher Sohn der Einsamkeit trotz aller geistigen Ueberlegenheit sein Leben lang zu kämpfen hat und die ihn um so manchen Erfolg des Lebens verkürzt. Frühzeitig lernte Mozart den Menschen sich nahen als Freunden, sie waren ihm keine Fremden, er fand durch eigene Zutunlichkeit den Weg zu ihren Herzen. Frühzeitig sah er die verschiedene Art der Menschen, gewann ein Auge für ihre mannigfachen Besonderheiten oder übte vielmehr den ihm angeborenen Blick für die Charaktereigenschaften des Einzelnen. Frühzeitig klang ihm auch in das empfängliche Ohr die besondere Weise der Musik bei den verschiedenen Nationen. Denn obgleich die Kunst Italiens damals noch alle Länder beherrschte, so hatte doch wieder jedes Volk für sich seine besondere Weise. Frühzeitig aber lernte Mozart auch die ganze anmutig seine Art der Bewegung kennen, die den Gesellschaftston des vorigen Jahrhunderts auszeichnet, die graziös-zierliche Weise des Verkehrs, den Menuettschritt in komischer Würde, den Puder, diese Ironie der Natur, und vor allem das Distinkte der Formen. Denn es war durchaus die allerfeinste Gesellschaft, ja die Hofluft, in der die reisende Familie lebte. Und wenn man nun die reizend galante Tracht mit ihrer koketten Unnatur, die das obenerwähnte Bild Mozarts zeigt, zusammenhält mit der gesunden, rechtschaffenen, geraden bürgerlichen Art und unbeirrt natürlichen Empfindungsweise, die das Kind von Haus aus besaß und die ihm von seinen Eltern treu behütet wurde, so kann man wohl begreifen, daß die Jugendkompositionen in ihrer äußeren Erscheinung durchaus die feinste Form bewahren, in ihrem Gehalte aber von einer einfachen Natürlichkeit sind, die uns wie das Leben des Volkes anmutet, daß also die beiden Bedingungen, unter denen die eigentliche Kunst entsteht, Vollendung der äußeren Erscheinung und unbefangenste Natürlichkeit des Empfindens, bei Mozart durch den glücklichen Zufall der Geburt wie des Lebensganges sich schon frühzeitig von selbst erfüllten.
Fußnoten
1
Die Knabenjahre.
1767–1770.
»Liebe, Liebe, die Amme der Schönheit!«
»Nach dem lieben Gott kommt gleich der Papa«, das war der Wahlspruch des Knaben Wolfgang. Wenn er abends zu Bett ging, mußte ihn der Vater erst auf einen Stuhl stellen und mit ihm zweistimmig eine Melodie singen, die von ihm selbst auf einen sinnlosen Text, der wie italienisch klang, Oragnia fiaga ta fa ersonnen worden war, worauf er dem Vater »das Nasenspitzel küßte und ihm versprach, wenn er alt wäre, ihn in einer Kapsel, wo ein Glas vor, vor aller Luft bewahren zu wollen und ihn immer bei sich und in Ehren zu halten«. Dann legte er sich zufrieden ins Bett.
Wie so ganz anders erging es dem edlen Ritter Gluck, dem Sohne des Volkes, dem rauhen Försterkinde, der dem strengen Vater bei harter Kälte barfuß in den Wald folgte, ihm das Jagdgerät zu tragen. Wie hat seine Musik sich mit der Kräftigkeit der Natur auch das Rauhe und Ungefüge bewahrt, von dem eine mildere Gesittung den jungen Mozart schon in der Kinderzeit befreite. Wie wenig erfuhr der heitere Haydn, das Kind des Handwerkers, der bei seinem Lehrer mehr Prügel als zu essen bekam und noch als Jüngling sein täglich Brot mit Singen mühsam erwerben mußte, von diesem Sonnenschein der zärtlichen Liebe, die in das Gemüt die Harmonie bringt und den Geist schon früh zum Frieden des Schönen verklärt! Wie noch weniger der große Beethoven, dessen Vater, ein kleiner Musikus, jener im vorigen Jahrhundert häufigen unordentlichen Lebensweise seines Standes gänzlich verfallen war und so seiner Familie mit den Nahrungsquellen den Frieden raubte, in dem allein der Kinder Wesen zum rechten gedeiht! Störrig von Natur, ward Beethoven durch den Mangel an Liebe, den er in der Kinderzeit zu tragen gehabt, nur noch abweisender gegen die Menschen, und erst spät erfuhr er in herbsten beiden, welche Quelle des Lebens und des Glücks gerade der Liebe entströmt.
Gluck und Beethoven wurden vom Geschick zur mühevollen und kampfreichen Umgestaltung der Kunst ihrer Zeit erzogen, indes Mozart, der Genius der Schönheit, in stiller Harmonie und Liebenswürdigkeit den ewigen Sternen gleich eine ruhige Bahn wandelte. Von ihm, der in der Jugend die Fülle der Liebe in sich aufgesogen hatte, entflossen auch Ströme der Liebenswürdigkeit, der Harmonie und der Schönheit. Wie ein jugendlicher Held siegte er über seine Zeit, nicht heftig anstreitend, sondern durch den Zauber seiner Erscheinung, die mit leichtgeflügeltem Götterschritt auf den Höhen der Menschheit wandelte und strahlenaugig, mit herzgewinnendem Lächeln, in unsagbarer Anmut Hoch und Niedrig, Groß und Gering, Gut und Böse mit den duftenden Blüten seines Schaffens beglückte. –
Wolfgang war jetzt, zehn Jahr alt, ein ausgewachsener Knabe. Aber er war auch bereits ein vollkommener Kompositeur: schon jener »Londoner« Bach hatte gesagt, es sterbe mancher Kapellmeister, ohne das zu wissen, was der Knabe wisse. Als sie nun aufs neue nach Wien kamen, – den Vater hielt es wiederum nicht lange in Salzburg, zumal im Herbst 1767 in Wien die Vermählung der Erzherzogin Maria Josepha mit dem Könige von Neapel stattfinden sollte – da waren bereits der Neid und die Eifersucht der Zunftgenossen rege, und man bereitete von allen Seiten Hindernisse, damit Wolfgang sich nicht öffentlich produzieren könne. In der Tat, er leistete bereits damals schon mehr, als weitaus die meisten der lebenden Komponisten vermochten, und fand auch bald Gelegenheit, dies öffentlich zu zeigen. Kaiser Joseph II., der leider bald zu einem Sparsystem übergegangen war, das besonders die Künstler drückte, weil sie darauf angewiesen waren, von der Gunst der Großen zu leben, gewährte zwar dem jungen Künstler, dessen Fortschritte er abermals höchlich bewunderte, und seiner Schwester Nannerl, die unterdes zur lieblichsten Jungfrau herangeblüht war und der die kaiserlichen Leutseligkeiten »gar oft die Röte ins Gesicht trieben«, nicht die früheren reichlichen Geschenke, wohl aber gab er Wolfgang den erfreulichen Auftrag, eine Oper zu schreiben. Es war »La finta semplice« (»Die verstellte Einfalt«), eine komische Oper in drei Akten.
Wolfgang machte sich sofort an die Arbeit. Da aber der Theaterdirektor Affligio mit Hergabe des Textbuches bis in das Frühjahr hinein zögerte, so wurde die Oper erst nach Ostern fertig. Man dachte nun an das Einstudieren. Allein jetzt zeigte sich der Brotneid der übrigen Musiker, die auf alle mögliche Weise versuchten die Aufführung zu verhindern. Bald hieß es, es sei eine Schmach, einen zehnjährigen Knaben an derselben Stelle zu sehen, wo bewährte Meister wie Hasse und Gluck zu stehen gewohnt seien, – denn der Kaiser hatte ausdrücklich gewünscht, daß Wolfgang die Direktion der Oper selbst übernehme, – dann wieder, die Musik sei nicht von ihm, sondern vom Vater, welcher Verleumdung dieser die Spitze dadurch abbrach, daß er seinen Sohn in Gegenwart von Künstlern sofort eine Arie oder eine Sonate aus dem Stegreif komponieren ließ, – und zuletzt steckte man sich hinter die Sänger, sie würden mit solcher Knabenarbeit keine Ehre einlegen, und diese ließen sich denn auch zum Widerstande verführen, obgleich Wolfgang ihnen allen die Musik so recht »auf den Leib zugeschnitten« hatte. Ob nun gleich der mildgesinnte Komponist Hasse, der jedes aufstrebende Talent willig anerkannte und jedes redliche Bemühen gern unterstützte, geradezu erklärte, Wolfgangs Oper sei besser als die von zwanzig lebenden Komponisten, so kam es doch durch das Widerstreben des Theaterdirektors, der auf den wiederholten Befehl des Kaisers und das stete Drängen des Vaters endlich erklärte, er werde die Oper zwar geben, aber auch dafür sorgen, daß sie gehörig ausgepfiffen werde, am Ende dahin, daß der Vater dieselbe ganz zurückzog, und es mit einer Beschwerdeschrift beim Kaiser versuchte, die aber keinen Erfolg hatte. Denn das Theater war damals nicht kaiserlich, sondern gehörte dem Direktor Affligio, und dieser war ein Abenteurer und schlechter Mensch, der später wegen Fälschung ins Zuchthaus kam.
So war der ganze Sommer ohne irgend welchen Erfolg geblieben, und Wolfgang lernte damals zuerst die widrigen Mächte kennen, mit denen er fortan oft genug zu ringen haben sollte. Jetzt freilich empfand er noch das Widrige der Intrigen und des Neides weniger als der Vater, und dieser, von Natur und durch den Gang seines Lebens darauf eingerichtet, mit solchen Dingen umzugehen, ließ sich nicht irre machen, sondern verfolgte trotz Aerger und Unmut, die ihn allerdings zuweilen befielen, mit männlicher Konsequenz die Bahnen, auf denen er seines Sohnes Glück zu finden gewiß war. »So muß man sich in der Welt durchraufen«, schreibt er; »hat der Mensch kein Talent, so ist er unglücklich genug; hat er Talent, so verfolgt ihn der Neid nach dem Maße seiner Geschicklichkeit. Allein mit Geduld und Standhaftigkeit muß man die Leute überzeugen, daß die Widersacher boshafte Lügner, Verläumder und neidische Creaturen sind, die über ihren Sieg in die Faust lachen würden, wenn man sich erschrecken oder ermüden ließe.«
Sein nächstes Ziel war Italien, denn dieses Land war damals das Eldorado der Musiker. Wer dort an einer größeren Bühne einmal mit einer Oper einen durchschlagenden Erfolg errungen hatte, dem standen die sämtlichen Theater Europas offen, und Ruhm wie glänzender Erwerb waren ihm gewiß. Damals kannte man kaum andere Opern und wenig andere Sänger als italienische, und virtuosen wie Komponisten aus allen Ländern mußten nach Italien gehen und womöglich bis auf ihren Namen hinab italianisiert werden, ehe ein Opernpublikum sie günstig aufnahm. So hatte es schon Händel gemacht, so machten es jetzt Hasse, Naumann und andere. Und wer sich der welschen Weise bequemte und den eigenen Sinn nur innerhalb dieser bestimmten Manier walten ließ, dem stand selbst das hesperische Publikum gern zur Anerkennung bereit. Ja, es pries Händel in seinem Rinaldo, vergötterte den caro Sassone Hasse mit seinen hundert Opern nach italienischem Zuschnitt und hatte Gefallen an Glucks früheren Werken, die ihm in Rom sogar den Orden vom goldenen Sporn eintrugen. Und keiner der Maestri, die in Neapel, Rom oder Mailand Lorbeeren geerntet hatten, blieb ohne eine erfolgreiche Laufbahn. Glucks Reform der Oper hatte damals erst leise begonnen.
So war auch »La finta semplice« eine opera buffa