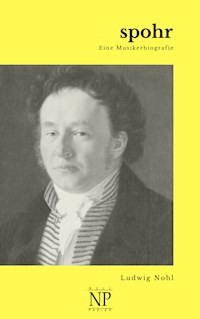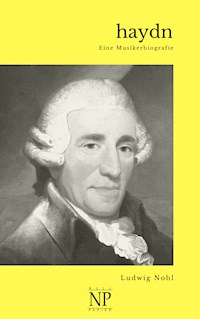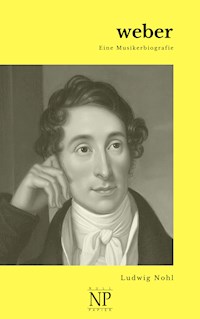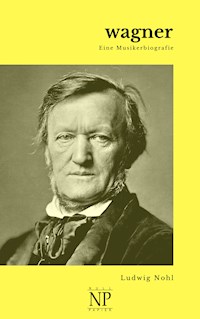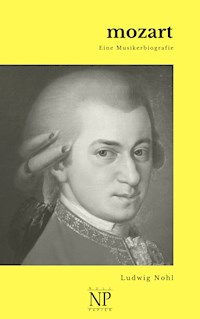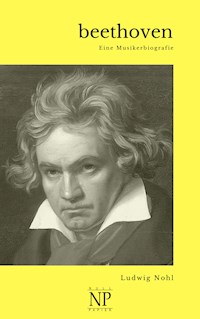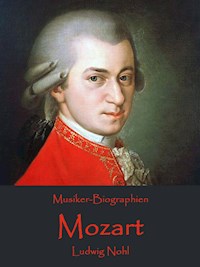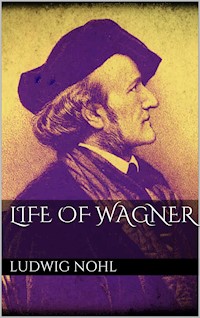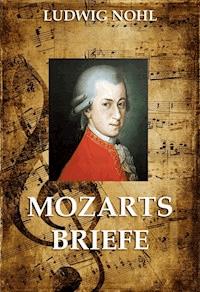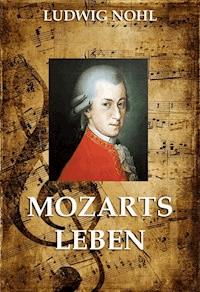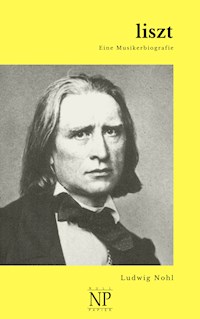
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Musikerbiografien
- Sprache: Deutsch
Nohl zeichnet in seiner Biographie das facettenreiche Bild eines musikalischen Superstars des 19. Jahrhunderts: Franz Liszt. Von seinen atemberaubenden Klaviervirtuosen-Auftritten bis zu seiner visionären Kraft als Komponist und Musikpädagoge – Nohl verknüpft Anekdoten aus Liszts rastlosem Leben mit einer tiefgehenden Analyse seiner Werke. So entsteht das Porträt eines charismatischen Künstlers, der zu den einflussreichsten Köpfen der Romantik zählt. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Nohl
Liszt
Eine Musikerbiografie
Ludwig Nohl
Liszt
Eine Musikerbiografie
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2025Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: , 3. Auflage, ISBN 978-3-962817-30-5
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Spruch
Einleitung
1. »Les préludes.«
2. Divertissements hongrois.
3. Capriccioso.
4. Impromptu.
5. Réflexions.
I.
II.
6. Harmonies poétiques.
7. Consolation.
8. Harmonies réligieuses.
9. Prometheus.
Die Hauptschüler Liszts.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Musikerbiografien
Beethoven - Eine Musikerbiografie
Weber - Eine Musikerbiografie
Haydn - Eine Musikerbiografie
Liszt - Eine Musikerbiografie
Mozart - Eine Musikerbiografie
Spohr - Eine Musikerbiografie
Wagner - Eine Musikerbiografie
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Spruch
»Traurig und groß ist die Bestimmung des Künstlers!«
Einleitung
Im Gegensatze zu dem Verfahren bei den ersten Biografien lassen wir diesmal, sowie es auch der Meister in seinem gewaltigsten Oratorium getan, das Leben des Helden durch seine Taten sich selbst erzählen, die sich denn ebenfalls in steter Steigerung vor uns aufrollen.
Da ist zunächst seine erste Jugendzeit mit ihrer unbegreifbaren Virtuosenschaft. Es ist ein wahres Erdrücken der Schlangen in der Wiege, so spottet diese Kraft jeder Hemmung und Schwierigkeit in der Darstellung ihrer Kunst. Da ist die Aufnahme neuer Keime aus dem ewig fruchtbaren Naturleben, vor allem aus der dämonischen Welt der Zigeuner. Da ist jenes Aufleuchten des großen Menschen in dem großen Künstler: es ersteht an der Reibung mit einem verwandten Genie, dem aber anders als bei Liszt selbst, das Letzte, was auch dem künstlerischen Schaffen zu Grunde liegt, der Genius der Menschheit nicht aufgegangen war, – wir meinen den großen Geiger Paganini, – und es betätigt sich dann sofort mächtig in der Berührung mit dem einzig ebenbürtigen Künstler, der ihm im Leben begegnete, dem er selbst aber auch durchs ganze Dasein treu die große Tat verwirklichen half, die wir heute in unserem »Bayreuth« besitzen.
Da ist ferner in bewundernswerter Vielseitigkeit die tätige Anteilnahme an sämtlichen entscheidenden geistigen Fragen der Zeit und der Menschheit: wir erfahren es staunend aus der stattlichen Reihe der »Gesammelten Schriften«, die soeben vor uns sich auftürmen. Da ist seine epochemachende neue Kunsttat, die Erschaffung der »Symphonischen Dichtung«: sie ergab sich ihm aus solcher Beteiligung an allem, was Poesie und Leben heißt, wie von selbst. Da ist, alles krönend, das letzte und höchste Werk, das er selbst sich gesetzt, die Erneuung der Kirchenmusik. Wir versuchten auch dem Laien wenigstens das Entscheidende dieser Hochtat annähernd zu verdeutlichen.
Und damit auch nichts Wesentliches in der Skizzierung eines solchen fast überreichen Lebens fehle, begegnen wir dem Genius zuletzt noch persönlich in seiner Schöpfung, als »Meister«! Aber so viel liebende Güte auch hierbei walten möge, es ist nicht wie Ludwig Richters gemütlich-gemächlicher Bienenvater, es ist wie Michelangelos gewaltiger »Herr«, dem die soeben geschaffene Eva sich demutvoll beugt, es ist wie Prometheus unter den geliebten Geschöpfen, die sein Hauch erst zum Leben beseelen will. Und in welchem Maße dies gelungen, weiß die Welt aus der großen Zahl seiner Meisterschüler, deren stolze Namen uns das ganze Bild umrahmen.
So wandeln wir selbst hier wie in einer neuen Schöpfung und erkennen, dass unsere Tage auch in der reinen Kunst der Töne keinem anderen Zeitalter etwas nachzugeben haben, dass sie vielmehr dem großen Besitz der Vergangenheit manch herrlichst dauerndes Edelstück hinzugefügt haben.
1. »Les préludes.«
»Wieder ein junger Virtuose, gleichsam aus den Wolken heruntergefallen, der zur höchsten Bewunderung hinreißt. Es grenzt ans Unglaubliche, was dieser Knabe leistet, und man wird in Versuchung geführt, die physische Möglichkeit zu bezweifeln, wenn man den jungen Riesen Hummels schwere Komposition herabdonnern hört«, so lautet ein Wiener Bericht über den kaum elfjährigen Knaben, und nur ein Jahr später hören wir Paris förmlich Wunder schreien über diese nie gesehene Erscheinung: wie einst bei dem Knaben Mozart in Neapel muss auch hier das Klavier herumgedreht werden, damit man sehen könne, was man bloß zu glauben nicht vermöge. Dabei werden die liebenswürdigen menschlichen Eigentümlichkeiten des jungen Künstlers angedeutet, die später ebenso das Entzücken aller Welt wurden wie sein Spiel. »Seine Augen glänzen von Leben, Mutwillen und Freude, er wird nicht zum Klavier geführt, er fliegt darauf zu, man klatscht, und er scheint überrascht, man klatscht von Neuem, und er reibt sich die Hände«, heißt es hier, und dann wird das nationale Element, der begeisterte Ungestüm und die sichere Originalität, wie andererseits bezeichnenderweise der »männlich stolze Ausdruck« hervorgehoben, der ihn eben als »hungarisches Wunderkind« zeichne. Wir wollen diesen Spuren seiner Eigentümlichkeit nachgehen, und zwar vor allem nach einem längeren biografischen Berichte, der offenbar in den Hauptzügen seiner eigenen Mitteilung entsprossen, am Anfange der dreißiger Jahre in der ersten Pariser Musikzeitung, in der vor wenig Jahren eingegangenen »Revue et gazette musicale« stand.
Franz Liszt ist am 22. Oktober 1811 zu Raiding bei Ödenburg geboren. Das Kometenjahr erschien seinen Eltern als eine gute Vorbedeutung seiner Zukunft. Der Vater, einer unbegüterten altadligen Familie angehörig, ward früh in Eisenstadt Rechnungsführer bei jenem Fürsten Nicolaus Esterhazy, der noch Joseph Haydn zu seinem Kapellmeister hatte, und wenn er dem verehrten Meister des Quartetts persönlich auch meist nur im Kartenspiel nahe trat, das derselbe als einzige Erholung von seiner stets angestrengten Arbeit übte, so weilte er hier doch immer in einer Sphäre, die von nichts Geistigem so sehr wie von der Musik erfüllt war und daher seinem eigenen Innern die reichste Nahrung bot. Denn auch jener beste Schüler Mozarts, der ausgezeichnete Klavierspieler Hummel, geb. 1778 zu Pressburg, wirkte jahrelang als fürstlicher Kapellmeister in Eisenstadt und Esterhaz, und der Vater Liszt ward ihm persönlich näher befreundet. Niemand hielt ihn als Klavierspieler so hoch wie er, sein Spiel hatte ihm einen unvergesslichen Eindruck gemacht. Aber er war auch selbst von Natur in hohem Grade musikalisch, spielte sogar fast jedes Instrument, besonders Klavier und Cello, und war nur durch die Ungunst der Familienverhältnisse abgehalten worden, sich zum völligen Musiker auszubilden. Umso mehr übertrug er jetzt alle Träume und Hoffnungen des Künstlertums auf den ältesten Sohn, dessen seltene Anlagen sich schon früh zeigten. »Du bist vom Schicksal bestimmt, du wirst jenes Künstlerideal verwirklichen, das meine Jugend vergeblich bezaubert hielt, in dir will ich mich verjüngen und fortpflanzen«, sagte er oft zu ihm. Und so sehr erschien ihm schon jetzt alles in des Knaben Dasein von Bedeutung, dass er ein Tagebuch über ihn führte und darin »mit der kleinlichsten und ängstlichsten Pünktlichkeit eines zärtlichen Vaters« seine Aufzeichnungen machte. Da heißt es denn zunächst aus der Erinnerung jener Kindeszeiten:
»Nach der Impfung begann eine Periode, worin der Knabe abwechselnd mit Nervenleiden und Fieber zu kämpfen hatte, die ihn mehrmals in Lebensgefahr brachten. Einmal, in seinem zweiten oder dritten Jahre, hielten wir ihn für tot und ließen seinen Sarg machen. Dieser beunruhigende Zustand dauerte bis in sein sechstes Jahr fort. In seinem sechsten Jahre hörte er mich ein Konzert von Ries in Cismoll spielen. Er lehnte sich ans Klavier, war ganz Ohr. Am Abend kam er aus dem Garten zurück und sang das Thema. Wir ließen’s ihn wiederholen, er wusste nicht, was er sang: das war das erste Anzeichen seines Genies. Er bat unaufhörlich, mit ihm das Klavierspiel zu beginnen. Nach drei Monaten Unterricht kehrte das Fieber zurück und nötigte uns zur Unterbrechung. Die Freude am Unterricht raubte ihm nicht die Lust, mit Kindern seines Alters zu spielen, obwohl er von nun an mehr für sich allein zu leben suchte. Er blieb sich in seinen Übungen nicht gleich, doch immer folgsam bis in sein neuntes Jahr. Dies war der Zeitpunkt, wo er zum ersten Male öffentlich spielte und zwar zu Ödenburg. Er spielte ein Konzert von Ries in Esdur und fantasierte. Das Fieber hatte ihn ergriffen, schon ehe er sich ans Klavier setzte, und ward durch das Spielen noch verstärkt. Schon lange zeigte er großes Verlangen, öffentlich zu erscheinen, er bewies dabei viel Unbefangenheit und Mut.«
Was aber war, unterbrechen wir hier zunächst den Bericht, die lebendige Quelle dieser inneren Hingebung an die Kunst so wie der heiße Trieb, sie öffentlich zu zeigen? Weder Ferdinand Ries, der bloß die Allüren seines großen Lehrers Beethoven nachahmte, oder auch Mozarts Schüler Hummel, der Haydn bei Esterhazy nachgefolgt war, noch dieser große Vater der modernen Instrumentalmusik selbst, sie konnten nicht entfernt jenes »Genie des Vortrags« erzeugen, von dem man schon damals die ersten Wunderdinge sah und das eben selbst wie ein schöpferischer Drang diese jugendliche Seele erfüllte und mit heißer Sehnsucht zum Ausdruck seiner selbst, zum öffentlichen Vortrag trieb. Denn da heißt es in einem Pariser Bericht der Schumannschen Musikzeitung von 1834, er spiele oft »zart und sanft elegisch«, dann wieder »mit einer sich selbst zerknirschenden Leidenschaft«, feurig, ja wütend, sodass man meine, das Klavier müsse unter seinen Fingern zerbrechen, man höre ihn während des Spiels oft stöhnen, röcheln, man sehe ihn Kopf, Augen, Hände, den ganzen Oberleib nach allen Seiten hin heftig bewegen. Ja einmal war er dort ohnmächtig vom Klavier herabgesunken. Woher diese unerhörte Hingabe an die Musik, woher dieses, man möchte sagen Sichausleben der Seele in seinem Spiel?
Es gibt ein seltsames Volk, das vom Himalaya verbreitet bis zum Ebro und dem schottischen Hochlande, nichts auf dieser weiten Gotteswelt besitzt als – sich selbst und die Natur. Nicht Haus noch Herd, nicht Staat noch gesellschaftliche Ordnung binden es, es hat keine ständige Tätigkeit, keinen Beruf, der aus Pflicht und Neigung ein festgekittetes Dasein ausmachte, es hat keine Sitte, keine Kirche, keinen Gott! Und dennoch lebt dieses Volk seit den Jahrhunderten, die wir es kennen, unverändert in Art und Zahl, doch nirgends fixiert. Es sind die Zigeuner, die so scheinbar nichts besitzen, was die Erde dem Menschen bietet und das Leben lebenswert macht. Zudem noch, wo sie sich zeigen, auf das Innerlichste sind sie verachtet oder doch gering geschätzt. Jawohl haben sie nichts und sind wie ein von Gott ewig verlassenes, ewig elendes Stück Menschengeschlecht. Aber eins haben sie, und trotz unserer Kultur und Kunst, ihre Musik! Und wie sie nun in der Natur die vollen Wonnen eines Daseins empfinden, das ganz frei ist, frei von allem, was die nächste Regung und Neigung hemmt, so lassen sie in ihren Weisen, vor allem aber in dem improvisierten Vortrag derselben, die ganze gottgegebene Freiheit der inneren Empfindung in all ihren Wallungen vom stolzesten menschlichen Bewusstsein bis zur allerinnigsten Sehnsucht der Seele nach Mitteiluug an gleichfühlende Wesen ertönen: es ist, als wäre ihnen diese Musik Welt und Gott, Leben und Glück, Sonne und alles Gedeihen der Welt, das wir in unserem eigenen Innern anteilvoll widerhallen fühlen. So hat Liszt selbst uns in einer eigenen bemerkenswertsten Schrift die Unbegreiflichkeit der Fortdauer dieses in Atome aufgelösten altindischen Menschenstammes zu lösen gesucht, so erklärt sich die größere Unbegreiflichkeit, dass ein solches, aller sittlichen und geistigen Lebensbasis entbehrendes Volk eine Kunst, und zwar eine von solcher Originalität, Tiefe und Kraft besitzt. Hören wir ihn selbst aber weiter, um die Wunderwirkung seines eigenen Vortrags zu erfassen.
»Das Andenken der Zigeuner verknüpft sich mit meinen Kindheitserinnerungen und einigen ihrer lebhaftesten Eindrücke«, schreibt in den fünfziger Jahren der weltberühmte »Zauberer aus Ungarland«. »Später wurde ich wandernder Virtuose, wie sie es in unserem Vaterlande sind. Sie haben die Pfähle ihrer Zelte in allen Landen Europas aufgestellt und ich durchlief das wirre Netz von Wegen und Pfaden, auf dem sie im Laufe der Zeiten umherirrten, in einigen Jahren ihre geschichtlichen Geschicke gewissermaßen in gedrängtem Bilde wiederholend. Ich blieb dabei gleich ihnen der Bevölkerung jener Länder fremd, verfolgte gleich ihnen mein Ideal in einem unausgesetzten Aufgehen in der Kunst, wenn nicht in der Natur.« Und nun gesteht er sich im Aufwachen jener frühesten Erinnerungen, dass wenig Dinge in jenen ersten Lebenstagen ihn so lebhaft ergriffen haben, wie das von den Zigeunern an der Schwelle jedes Palastes, jeder Hütte aufgegebene Rätsel, wenn man ihnen das Almosen spendete, um ein paar leise ins Ohr geflüsterte Worte oder ein paar laut gespielte Tanzmelodien, um ein paar Lieder, wie sie kein Minstrel singt, bei welchen Liebende in Entzücken versinken und welche Liebende doch nicht selbst erfinden können! Wie oft habe er sich nicht um Lösung dieses Zaubers gefragt, der über allen walte und von keinem unter ihnen gebrochen werde. Als schmächtiger Lehrling eines strengen Meisters, eben seines Vaters, habe er noch keinen anderen Ausblick in die Welt der Fantasie gekannt, als das architektonische Gerüst künstlich aneinander gereihter Noten, und wenn wir dabei an altväterische Komponisten wie jene Hummel und Ries denken, so glauben wir ihm doppelt, dass es ihn reizen musste, den Zauber zu erfassen, den da sichtbarlich vor aller Angen diese schwielenbedeckten Hände ausübten, wenn sie mit den Pferdehaaren über die elenden Instrumente strichen oder so gewaltig herausfordernd das Metall erklingen ließen.
Und nun erfahren wir, wie diese Kinder der Natur mit ihrer, dem geheimsten und unwillkürlichsten Regen der Empfindung entsprossenen Kunst ihn beschäftigten und ihm förmlich einen inneren Neid um ihre unwiderstehliche Wirkung in die des Neides sonst völlig unfähige Seele warfen. Seine wachen Träume seien von diesen kupferfarbigen, durch den Wechsel der Jahreszeiten und ausschweifender Erregung jeder Art frühzeitig welken Gesichtern erfüllt gewesen, von diesem trotzigen Lächeln, den fahlroten Augen, wo neben Blitzen, welche glänzen ohne zu leuchten, eine sardonische Ungläubigkeit lacht. Immer schwebten ihm im Geist ihre Tänze vor, ihre weichen und elastischen, prallenden und herausfordernden Bewegungen dabei. Halb und halb tauchte vor seinem geistigen Blick die Einsicht auf, »dass statt der Reihenfolge neblig glanzloser Tage, wie sie den Hintergrund unserer zivilisierten Welt bilden, auf dem sich nur hie und da einige freudestrahlende oder schmerzflammende Momente hervorheben, diese Menschen sich ein tieferes Gewebe von Freude und Leid bilden, welches, wechselnd von Liebe, Gesang, Tanz und Wein, wie von vier Elementen der Wollust und des Taumels erweckt und beschwichtigt werden.«
Seine Seele hatte sich früh init dem Dämonischen berührt, das wie eine Sphinx im Innern der Natur thront, er hatte die geheimnisvolle Macht jenes Schaffens empfunden, das die Welt bildet und erhält, er fühlte sie als seine eigenste innere Natur und Kraft, und sein Herz musste im tiefen Bewusstsein dieses Zauberbesitzes umso höher aufjauchzen, als er sich zugleich nicht von jener anderen Seite menschlichen Hochbesitzes ausgeschlossen wusste, von der Kultur und höheren Kunstbildung, die auch diesem tiefsten Ausströmen natürlichen Lebens erst den Adel und die Hoheit des Gedankens leiht. Sein Genie leuchtete ihm hier vor. Aber, dass es ihm wirklich Genie, d. h. schöpferische Kraft blieb, verdankte er dieser steten innersten Berührung mit dem geheimnisvollen Walten der schaffenden Mächte der Natur. Daher auch schon ein Pariser Bericht vom Jahre 1834 über sein und das Spiel des ähnlich dämonischen Paganini sagt, die Musik sei ihnen die Kunst, die den Menschen sein höheres Dasein ahnen lasse und aus dem Treiben des gemeinen Lebens in den Isistempel führe, wo die Natur in heiligen, nie gehörten und doch verständlichen Lauten mit ihm spreche.
Verfolgen wir nun, wie die Wirkung dieses Spiels, die also offenbar schon der Knabe selbst durch solches lebendigstes Waltenlassen seines ureigenen Gefühls erzeugte, sein ferneres Schicksal bestimmte. Denn: »wie Tropfen einer geistfeurigen Essenz schlugen die Töne der bezaubernden Geige an mein Ohr«, sagt er von dem großen Zigeunervirtuosen Bihary, den er im Jahre 1822 in Wien hörte. »Wäre mein Gedächtnis aus weichem Ton und jede seiner Noten ein Diamantnagel gewesen, sie würden nicht fester darin haften. Wäre meine Seele eine von dem in sein Bett zurückgekehrten Flussgott erweichtes Erdreich gewesen und jeder Ton des Künstlers ein befruchtendes Samenkorn, er hätte nicht tiefer in mir wurzeln können.«
Der Vater führte ihn jetzt zum Fürsten Esterhazy, in dessen Familie ja das musikalische Mäcenatentum erblich war. Allein: »ich glaube, dass dergleichen nur durch Weiber bei ihm gelingen«, schrieb der große Beethoven ein paar Jahre später, als er ihm wie anderen Fürsten seine Missa solennis zur Subscription anbot, und wollte sich überhaupt »keiner guten Denkungsart von ihm gegen sich versehen«. Was sollte also hier gegenüber einem solchen bloßen jungen Anhänger in der Kunst Besonderes geschehen? Der Fürst machte ihm ein Geschenk von einigen hundert Francs. »Das war wenig für den Erben von Haydns Mäcen«, fügt unser Bericht hinzu. Dagegen in Pressburg, einer größeren und gebildeten Stadt, fand der Knabe eine entsprechende Aufnahme. Ja sechs Adlige, darunter die edlen Grafen Amadee und Szapary setzten ihm auf sechs Jahre ein Gehalt von sechshundert Gulden aus, das des Vaters Wunsch ermöglichte, dem Knaben eine würdige Ausbildung zu geben.
Bald darauf, im Jahre 1821, fasste derselbe denn auch den Entschluss, seine Stelle aufzugeben und sich mit Frau und Kind in Wien niederzulassen. Allein jetzt trat ängstliche Besorgnis seiner Frau, einer geborenen Oberösterreicherin, ein, die ihren Liebling nicht so der wechselvoll bewegten Woge einer Künstlerlaufbahn preisgegeben sehen wollte und zitternd fragte, was werden solle, wenn nach Ablauf jener Zeit ihre Hoffnung sich vereitelt zeige. »Was Gott will!« rief der neunjährige Knabe, der mit stillem Bangen solcher Unterredung gelauscht, ruhig aus und hatte so jeden Einwurf und jede Sorge der Mutter umso mehr besänftigt, als sie selbst ein innig gottergebenes und wahrhaft religiöses Gemüt besaß.
Sechshundert Francs war der ungefähre Verkaufspreis der Mobilien, es hieß also sich einrichten. Der liebenswürdige und bescheidene Karl Czerny war es, den, in Wien angekommen, der Vater zum Lehrer des Knaben erwählte, denn Czerny war eine kurze Weile Schüler Beethovens gewesen und spielte fast alle seine Kompositionen auswendig. Doch nur die wundergleiche Begabung des Knaben bestimmte den überbürdeten Lehrer zur Annahme desselben, und als er demselben gar Beethoven zu spielen gab, hatte er bald auch dessen ganze Liebe gewonnen. Denn wie mochte, was Czerny aus pädagogischen Gründen anfangs bestimmt, den trocken pedantischen Clementi ein Knabe spielen, der solchen Feuergeist der Musik in sich trug und solches frei quellende Leben dieser Kunst von Jugend auf mit Ohren genossen hatte? »Wenn er in die Musikläden kam, fand er die Stücke, die man ihm gab, nie schwer genug«, sagt unser Bericht. »Einst zeigte ihm ein Verleger das Hmoll-Konzert von Hummel, der Knabe blätterte das Heft durch und meinte, das sei eben nichts, das wolle er vom Blatte spielen. Und dies behauptete er auch vor den ersten Klavierspielern der Stadt. Die Herren, über das Selbstvertrauen des Knaben erstaunt, nahmen ihn beim Wort und führten ihn in den Saal, wo ein Klavier stand. Der Kleine führte das Konzert mit eben so viel Fertigkeit wie Sicherheit aus.« Es war dasselbe, mit dem er ein Jahr später vor Beethoven auftrat.