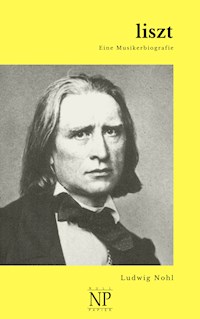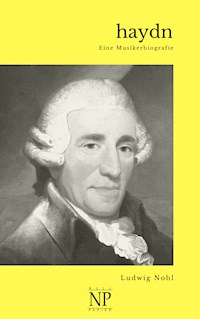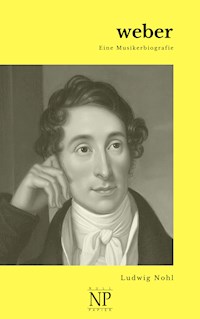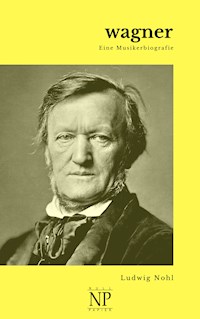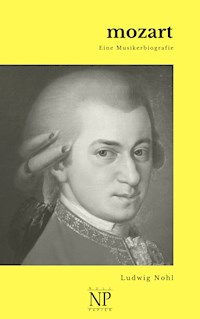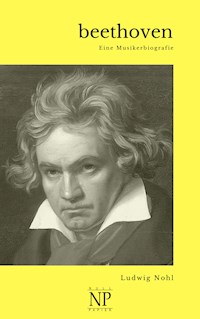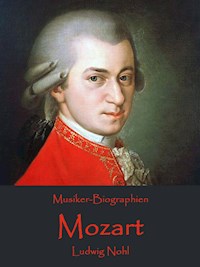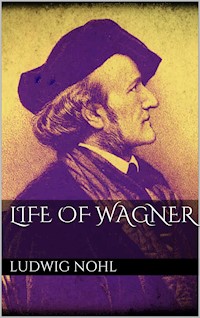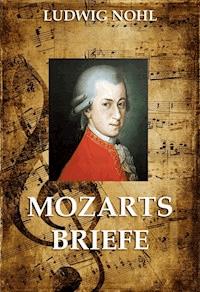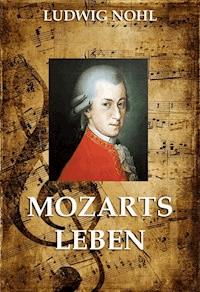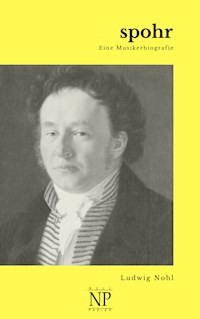
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Musikerbiografien
- Sprache: Deutsch
Mit großer Sachkenntnis und spürbarer Begeisterung nähert sich Ludwig Nohl in dieser Biographie Louis Spohr, einem Komponisten, der oftmals im Schatten seiner berühmten Zeitgenossen steht. Nohl führt uns durch Spohrs einfallsreiche Violinkonzerte und seine Pionierrolle als Dirigent. Dabei würdigt er zugleich Spohrs Beitrag zur musikalischen Romantik und das beständige Ringen um eine unverwechselbare künstlerische Handschrift. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Nohl
Spohr
Eine Musikerbiografie
Ludwig Nohl
Spohr
Eine Musikerbiografie
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2025Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: , 3. Auflage, ISBN 978-3-962817-36-7
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Spruch
Vorwort
1. Die Lehrzeit
2. Erste Erfolge
3. Allerlei Erlebungen
4. In Wien
5. In Italien
6. In London
7. In Paris
8. Jessonda
9. Wachsende Erfolge
10. Der fliegende Holländer
11. Das Ende des Gerechten
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Musikerbiografien
Beethoven - Eine Musikerbiografie
Weber - Eine Musikerbiografie
Haydn - Eine Musikerbiografie
Liszt - Eine Musikerbiografie
Mozart - Eine Musikerbiografie
Spohr - Eine Musikerbiografie
Wagner - Eine Musikerbiografie
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Spruch
Und wenn sie die Hände sich reichen Zum Freundschaftsbund, dann weinen sie, Sind sentimentale Eichen.
Heine (Wintermärchen).
Vorwort
Am 8. November 1859 schrieb von Paris aus Richard Wagner an die Konstitutionelle Zeitung in Dresden Folgendes:
»Fast gleichzeitig starben mir zwei würdige hochverehrte Greise. Der Verlust des einen traf die ganze musikalische Welt, die den Tod Ludwig Spohrs betrauert: ihr überlasse ich’s zu ermessen, welch’ reiche Kraft, welch’ edle Produktivität mit des Meisters Hingange aus dem Leben schied. Mich gemahnt es kummervoll, wie nun der letzte aus der Reihe jener echten, ernsten Musiker von uns ging, deren Jugend noch von der strahlenden Sonne Mozarts unmittelbar beleuchtet ward und die mit rührender Treue das empfangene Licht, wie Vestalinnen die ihnen anvertraute Flamme, pflegten und gegen alle Stürme und Winde des Lebens auf keuschem Herde bewahrten. Dieses schöne Amt erhielt den Menschen in Spohr rein und edel, und wenn es gilt, mit einem Zuge das zu bezeichnen, was aus Spohr so unauslöschlich eindrucksvoll zu mir sprach, so nenne ich es, wenn ich sage: er war ein ernster, redlicher Meister seiner Kunst und seine schönste Erquickung quoll aus der Kraft seines Glaubens. Und dieser ernste Glaube machte ihn frei von jeder persönlichen Kleinheit; was ihm durchaus unverständlich blieb, ließ er als ihm fremd abseits liegen, ohne es anzufeinden und zu verfolgen: dies war seine ihm oft nachgesagte Kälte und Schroffheit! Was ihm dagegen verständlich wurde, – und ein tiefes feines Gefühl war dem Schöpfer der Jessonda wohl zuzutrauen, – das liebte und schützte er unumwunden und eifrig, sobald er Eines in ihm erkannte: Ernst, Ernst mit der Kunst! Und hierin lag das Band, das ihn noch im hohen Alter an das neue Kunststreben knüpfte: er konnte ihm endlich fremd werden, nie aber feind. – Ehre unserm Spohr! Verehrung seinem Andenken! Treue Pflege seinem edlen Beispiele!«
So haben wir es diesmal nicht mit einem jener Heroen der Kunst zu tun, die deren Entwicklung mit einem mächtigen Ruck in wesentlicherweise erweiterten. Sondern in behaglicher und fast idyllischer Ruhe breitet sich in diesem langen Künstlerleben der bis dahin gewonnene Bestand der Musik als ein wonnig beglückender Besitz freundlich zum Mitgenusse einladend aus. Darum sind es nicht eigentlich entscheidend große Kunsttaten, was uns diesmal begegnen wird, wohl aber ein durch das Ideale der Kunst schön verklärtes menschliches Dasein, sodass wir hier mehr ein Intermezzo zwischen den vorwärts dringenden Akten einer großen Handlung als selbst ein Drama vor uns sehen. »Spohr zeigt sich überall mutvoll, entschlossen, tapfer, mit einem Wort echt männlich«, heißt es in dem Vorworte zu seiner Selbstbiografie von dem fast sieben Fuß hohen kräftigen Manne; »Spohr war wie alle edlen Naturen streng sittlich und von einer fast mädchenhaften Züchtigkeit; er kannte keinen Neid, sondern nur die aufrichtigste Freude über die Erfolge und Leistungen anderer, er hatte daher eigentlich keinen Feind; wir waren oft Zeuge, dass starke Ausdrücke des Beifalls über seine Leistungen ihn eher drückten und belästigten als erfreuten.« Als er bei seinem Jubiläum stürmisch hervorgerufen wurde, äußerte er, es sei ihm als ob er auf das Schaffot geführt werde, und als er einst zum Geburtstage seines Kurfürsten in Gala zu erscheinen hatte, hüllte er sich bei zwanzig Grad Wärme in einen großen Wintermantel und antwortete einem teilnehmend nach seiner Gesundheit fragenden Freunde, den Mantel zurückschlagend und die mit Orden bedeckte Brust zeigend: »Ich schäme mich nur, so über die Straße zu gehen.« Niemals auch widmete er ohne unabweisbare Aufforderung einem Fürsten oder Großen eines seiner Werke.
Es erklingen also hier so recht alle jene Saiten, die ganz eigens das Gemüt und den Charakter des deutschen, zumal des norddeutschen Künstlers ausmachen, und wir haben dieselben eben nur als solche erklingen zu lassen, um fühlbarst in der Nähe und sogar in dem eigensten Atemskreise dieses Altmeisters der ausgehenden klassischen Musikperiode zu weilen. Wozu uns denn zum Glück diesmal obendrein seine eigenen Lebensaufzeichnungen die leichteste Brücke schlagen, die zugleich gar manches anziehende Genre- und Sittenbild bringen und daher auch allgemeineren Anteil erwecken!
1. Die Lehrzeit
(1784-1803.)
»Da ging mir die Herrlichkeit der Mozartschen Musik auf.«
Spohr ward am 5. April 1784 zu Braunschweig als Sohn eines Arztes geboren; doch war väterlicher- wie mütterlicherseits die Familie dem Predigerstande zugehörig gewesen und schon früh wurde der Vater nach Seesen versetzt, das am Fuße des gespenstigen Brocken liegt. Die Eltern waren musikalisch, der Vater blies nach damaliger Neigung Flöte, welche Neigung manchmal so groß war, dass das Instrument im Spazierstocke verborgen war, damit an landschaftlich schönen Stellen auch die sentimentalen Empfindungen sich nicht gehemmt fanden. Die Mutter war Schülerin desselben Kapellmeisters Schwaneberger, der als Schüler Salieris bei der Nachricht, dass Mozart ein Opfer des Neides der Italiener geworden sei, den sonderbaren Ausruf tat: »Narrheit! Er hat nichts getan, um diese Ehre zu verdienen!« Sie sang demgemäß die italienischen Bravourarien jener Tage, die sie sich zum Klaviere sehr fertig begleitete. So war Musik ein Lebenselement des Hauses und der Knabe durfte schon im fünften Jahre in Duetten mit der Mutter an den Abendmusiken teilnehmen. Zugleich kaufte ihm der Vater nach seinem Wunsch auf dem Jahrmarkte eine Geige, auf der er nun die Melodien wiedersuchte, während die Mutter ihm begleitete.
Etwa um 1791 kam nach Seesen ein Emigrant Dufour, der ein fertiger Dilettant war. Der Knabe war bis zu Tränen gerührt, als er den fremden Mann so schön spielen hörte, und ließ den Eltern keine Ruhe, als bis er Unterricht bei ihm erhielt. Dieser entdeckte trotz seines bloßen Dilettantismus so sicher des Schülers Begabung, dass er darauf drang, denselben Musiker werden zu lassen. Bald wurden auch bereits Kompositionsversuche gemacht, Duetten für zwei Geigen, und ein schmucker neuer Anzug war der Lohn. Ja sogar an ein Singspiel wagte er sich, natürlich von Weiße, dem Begründer der Gattung in Deutschland, und in der Musik waren Hillers »Jagd« und »Lottchen am Hofe« Vorbild, jedoch nur nach dem oft durchgesungenen Klavierauszuge, denn das kleine Seesen hatte kein Theater. Die Formen und der Ton dieser deutschen Werke sind denn auch zeitlebens für Spohr maßgebend und bannend zugleich geblieben.
Bald kam der Knabe, der nun wirklich Musiker werden sollte, zur Confirmation zu seinem Großvater in das Hildesheimische und erhielt dort guten Unterricht. Doch die Musik musste in dem nahen Städtchen weiter betrieben werden. Auf dem beschwerlichen Wege dorthin war er einmal bei Regenguss in einer einsamen Mühle untergestanden und hatte dabei die Gunst der Müllerin so sehr gewonnen, dass er von da an stets vorsprechen musste und mit guten Sachen gelabt ward. Zum Dank fantasierte er ihr dann jedes Mal etwas vor und setzte sie einst durch Variierung des Liedes »Du bist liederlich« von Wranitzky, in der all die Kunststückchen vorkamen, durch die später Paganini die Welt entzückte, so außer sich, dass sie ihn an dem Tage gar nicht wieder von sich ließ. So ward die Sprache der Musik zumal auf seiner Geige schon früh seine Muttersprache und die Welt weiß, wie viele der edelsten Schüler er in dem langen Laufe seines Lebens gerade auf diesem Instrumente zu derselben herangebildet hat.
Jetzt kam er nach Braunschweig, wo der Erbprinz Karl Ferdinand ein bescheidenes französisches Theater nebst Kapelle hielt. Sein Lehrer ward ein Mitglied derselben, der Kammermusikus Kunisch, dem er viel verdankte, weil derselbe sehr gründlich war. Ebenso war es mit dem Harmonieunterrichte bei dem Organisten Hartung, der zwar wenig freundlich war, aber doch die beste Grundlage legte: denn er blieb der einzige Lehrer, den Spohr je in der Theorie seiner Kunst gehabt hat. Er half sich in der Folge mit gedruckten Werken und guten Partituren, die ihm Kunisch aus der Theaterbibliothek verschaffte. Bald bereiteten ihm seine kleinen Kompositionen denn auch Eintritt in die Konzerte der Stadt und er konnte seinen Eltern mit Stolz von eigenen Einnahmen melden. Dadurch kam er denn auch in das Theaterorchester und hörte viel gute Musik. Sein Lehrer ward dann der erste Geiger desselben, Konzertmeister Maucourt, und dieser bildete ihn bald zu einem so tüchtigen Solospieler heran, dass er ihm vorschlug, sein Glück als reisender Künstler zu suchen. Er schickte ihn nach Hamburg, den Vierzehnjährigen! Dass der Knabe darauf einging, beruhte auf den Überlieferungen des Vaters, der nach norddeutscher Wikingerart im höchsten Grade kühn und unternehmend gewesen war. Um einer Strafe zu entgehen, war derselbe von der Schule entflohen und hatte sich dann auf kümmerliche aber immer höchst selbstständige Weise zu seiner jetzigen ärztlichen Stellung emporgearbeitet. Dieser fand also in dem Unternehmen des Sohnes trotz der Mutter Kopfschütteln nichts Besonderes. Er empfahl ihn an einen alten Freund in Hamburg, allein derselbe empfing ihn mit den Worten: »Ihr Vater ist doch immer noch der Alte! Welche Tollheit, einen Knaben so auf gut Glück in die Welt zu senden!« Dann setzte er ihm die Schwierigkeit eines Konzertes in der großen von Künstlern überlaufenen Handelsstadt auseinander. Spohr wusste kaum die Tränen zurückzuhalten und rannte ohne nur die übrigen Empfehlungsbriefe abzugeben, voller Verzweiflung nach Hause. Ja bei seiner geringen Baarschaft sich, den großen schlanken Jungen, schon in den Händen jener Seelenverkäufer sehend, von denen ihm der Vater ein warnendes Bild entworfen hatte, wanderte er spornstreichs zu Fuße nach Braunschweig zurück.
In seiner Beschämung, namentlich dem energisch kühnen Vater gegenüber, sann und sann er auf Mittel, auf anderem Wege zu seinem Ziele der entsprechenden Ausbildung zu gelangen, und verfiel endlich zu seinem Glücke auf den Herzog Ferdinand, der selbst einst Violine gespielt hatte. »Er ist ein sehr angenehmer schöner freundlicher Herr«, schreibt Mozarts Vater nach einer Begegnung in Paris im Jahre 1766 über den damaligen Erbprinzen. Und der Encyklopädist Grimm sagt in einer Korrespondenz von dort über den zehnjährigen Knaben: »Das Unbegreiflichste ist jene tiefe Kenntnis der Harmonie und ihrer geheimsten Wege, die er im höchsten Grade besitzt und wovon der Erbprinz von Braunschweig, der gültigste Richter in dieser Sache sowie in vielen anderen, gesagt hat, dass viele in ihrer Kunst vollendete Kapellmeister stürben, ohne das gelernt zu haben, was dieser Knabe in einem Alter von neun Jahren leiste.« (Mozart. Nach den Schilderungen der Zeitgenossen. Leipzig, 1880). Zu den »anderen Sachen« gehörten des Prinzen glückliche Unternehmungen des Jahres 1760 gegen dieselben Franzosen, deren Verehrer und Nachahmer er sonst in fast allen Dingen war und deren Neigung zur Beschützung der Kunst er denn auch teilte. »Hat er dich nur erst eines deiner Konzerte spielen gehört, so ist dein Glück gemacht!« dachte sich also auch unser junger Künstler und beendete in heiterster Stimmung den öden Marsch durch die Lüneburger Haide.
Eine Bittschrift war bald entworfen. Der Herzog nahm sie auf seinem Spaziergange denn auch von dem treuherzigen schlanken jungen Menschen nach seiner gewohnten Leutseligkeit entgegen. Nach einigen furchtlos beantworteten Fragen über Eltern und Lehrer erkundigte sich der Fürst nach dem Verfasser der Bittschrift. »Nun wer anders als ich? Dazu brauche ich keinen anderen!« – »Nun, komm morgen aufs Schloss, dann wollen wir über dein Gesuch reden!« schloss mit Lächeln und Freude die Unterredung ab. Präcis elf Uhr stand er vor dem Kammerdiener. »Wer ist Er?« fuhr dieser ihn ziemlich unfreundlich an. »Ich bin kein Er. Der Herzog hat mich hierher bestellt und Er hat mich anzumelden!« lautete die Antwort der Entrüstung. Der Kammerdiener ging und ehe die Aufregung sich gelegt hatte, stand der junge deutsche freie Mann vor seinem Fürsten. »Durchlaucht, Ihr Kammerdiener nennt mich Er, das muss ich mir ernstlich verbitten!« platzte er heraus. Der Herzog lachte laut und sagte: »Nun, beruhige dich nur, er wirds nicht wieder tun.« Nach einigen unbefangenen Antworten Spohrs erteilte er dann den Bescheid, er habe sich bei Maucourt nach ihm erkundigt und sei begierig ihn zu hören, es könne im nächsten Konzerte bei der Herzogin geschehen. Überglücklich eilte der junge Künstler nach Haus, um sich aufs emsigste vorzubereiten.
Die nächste Szene führt uns nun so recht in das ancien régime,1 wo auch die Kunst, vor allem die Musik noch die gefällige Magd des Vergnügens war, aus der erst männlich große Erscheinungen wie Beethoven, Liszt und Wagner die Muse, die Prinzessin, die Königin gemacht haben. Doch erkennen wir, dass auch unserem jungen Künstler das Gefühl dieser Würde nicht fehlte, die das Innere des Menschen selbst zu erheben, zu adeln geschaffen und geeignet ist.
In den Konzerten der Herzogin wurde nämlich Karten gespielt und um dies nicht zu stören, musste das Orchester ohne Pauken und Trompeten und immer piano bleiben, ja es war demselben noch ein dicker Teppich untergebreitet, sodass das »ich spiele, ich passe« lauter war als die Musik. Diesmal waren allerdings Spieltische und Teppich verschwunden und dem Herzog gefiel des jungen Künstlers Talent so sehr, dass er ihn zum Kammermusikus ernannte. Allein in der Folge trat auch die alte Pein wieder hervor. Jedoch einmal, als Spohr dort ein neues Konzert probierte, vergaß er, ganz erfüllt von seinem Werke, das er zum ersten Mal mit Orchester hörte, völlig des strengen Verbotes und spielte mit aller Kraft und allem Feuer, sodass er selbst das Orchester mit fortriss. Plötzlich wurde er mitten im Solo von einem Lakai am Arme gefasst, der ihm zuflüsterte: »Die Frau Herzogin lässt Ihnen sagen, sie sollen nicht so mörderisch darauf losstreichen.« Wütend über diese Störung spielte er womöglich nur noch stärker, musste sich aber dafür einen Verweis vom Hofmarschall gefallen lassen.
Der Herzog lachte über den Vorfall, erinnerte sich dabei aber seines Versprechens, ihn mit der Zeit zu einem großen Meister zu senden. Dies ward natürlich jemehr Spohrs Wunsch, je tiefer er in den Geist seiner Kunst eindrang. Zuerst lernte er nun jene leichten französischen Operetten kennen, später aber auch Cherubinis »Wasserträger«. »Ich erinnere mich lebhaft der Abende, als die deux journées