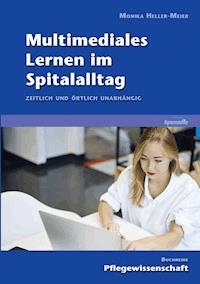
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In atemberaubender Geschwindigkeit werden die heutigen Standards und elektronischen Anwendungen im Spitalalltag erneuert. Im täglichen Leben kann beobachtet werden, dass die Aktualisierung der Anwendungen durch revolutionäre technische Möglichkeiten unaufhaltsam weitergeht. Die moderne Pädagogik mit ihren neuen Lernformen bietet bedarfs- und lösungsorientierte Möglichkeiten, das Wissen der Mitarbeitenden aktuell zu halten. Dieses Buch vermittelt Gestaltungsempfehlungen für Mobiles Lernen im Spital. Weitere Themen sind lehren und lernen mit Medien, Management der Wissensarbeit und die Umsetzung eines Pilotprojekts Lernplattform mit seinen Möglichkeiten und Grenzen. Behandelt werden auch "Leben und arbeiten mit Digitaler Kompetenz in der Informations- und Wissensgesellschaft" und die "Digitalen Lehr- und Lernbegleitenden". Die Beispiele beruhen auf Beobachtungen im Spitalbereich, können aber auch in anderen Fachbereichen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT TEIL 1
V
ORWORT
E
INLEITUNG
T
HEORIE DER
B
EGRIFFLICHKEITEN
G
LOBALISIERUNG UND
M
OBILES
L
ERNEN
B
EDARFSABKLÄRUNG
M
OBILES
L
ERNEN IM
S
PITAL
Z
OFINGEN
M
ÖGLICHKEITEN UND
G
RENZEN DES
M
OBILEN
L
ERNENS IM
S
PITAL MIT
F
OKUS AUF
G
ESUNDHEITSFÖRDERUNG
E
MPFEHLUNGEN
R
ÜCKBLICK
, Z
USAMMENFASSUNG
L
ITERATURVERZEICHNIS
VORWORT
Bereits bei der Erarbeitung meines Buches „Wissensorientierte Spitalführung, effizientes Lernen und Arbeiten mit Computerunterstützung“ war mir klar, dass im Gesundheitswesen weitere Herausforderungen auf uns warten. Die Entwicklung in den Bereichen „Anspruch auf das Wissen in der Welt“, „Die digitale Welt im Gesundheitswesen“ und „Das globale Bildungsmanagement im Spital“ unaufhaltsam weiterging, entschied ich mich als erstes eine Literaturrecherche über diese Themen zu erarbeiten. Es entstand eine neue faszinierende Idee mit dem Grundgedanken, das Thema „Mobiles Lernen“ zu erarbeiten.
Durch diese Entwicklungen werden sich die heutigen Standards verändern. Wichtig ist daher, im Spital die moderne Pädagogik mit ihren neuen Lernformen in den Alltag zu integrieren. Im Spitalalltag müssen bedarfs- und lösungsorientierte Anwendungen für das bestehende System entwickelt werden.
Im täglichen Leben kann beobachtet werden, dass die Aktualisierung der Anwendungen durch revolutionäre, technische Möglichkeiten unaufhaltsam weitergeht. In atemberaubender Geschwindigkeit vollziehen unterschiedliche Gerätschaften ein technisches Zusammenwachsen.
Der Anspruch an ein Spital begründet sich aber nach wie vor in einer kompetenten Institution gut behandelt und gut informiert zu sein. Anhand eines Konzeptes erarbeitete ich eine Lernplattform auf elektronischer Basis als Demoversion. Diese wurde mit Bildern visualisiert. Durch diese Interventionen ergab sich die Möglichkeit der Umsetzung.
Ich danke Frau Caroline Nyfeler und Herr Dr. med. Jürg Gurzeler für das Studium der wissenschaftlichen Texte und des Fragebogens über das Thema „Mobiles Lernen“ und das entgegengebrachte Vertrauen, dieses Thema im Spital Zofingen bearbeiten zu dürfen.
Ganz herzlichen Dank gilt all jenen Menschen, die mir während dieser Arbeit immer wieder beigestanden sind.
1. EINLEITUNG
Der Themenkreis „Lernen“ im Wissensmanagement wird vermehrt zum Lernen mit allgegenwärtigen Systemen und sozialen Medien genutzt. Wir werden unser Wissen weiterhin über informationstechnologische Zugänge erlangen können. Soziale Medien stehen schon heute für die Allgegenwärtigkeit von Informationen und werden daher auch zu einem Interessensschwerpunkt im Gesundheitswesen. Es stehen Fragen im Vordergrund, wie diese sozialen Media-Plattformen zukünftig funktionieren müssen und welche technologischen-didaktischen Anforderungen erfüllt sein sollten, damit diese für die flexiblen Lernprozesse fruchtbar gemacht werden können. Es ist eine besondere Herausforderung, durch zugeschnittene Medien nicht nur lebenslang, sondern auch in unterschiedlichen Kontexten zu lernen (vgl. digital-lernen).
Dieses Thema ist nicht isoliert im Schweizer Gesundheitswesen zu betrachten. Die WHO empfahl im Jahr 2011 ebenfalls, eine multisektoriale Zusammenarbeit anzustreben und gemeinsame und evidenzbasierte Standards und Normen für E-Health zu etablieren. Wie vielfältig die Informations- und Communications-Technology (ICT) in der Grundversorgung eingesetzt werden kann, zeigt die Fülle von Beispielen weltweit. Wirkungsorientierte Studien für effektive E-Health-Innovationen gibt es derzeit noch zu wenige. Lange Zeit war die Entwicklung von E-Health technologiegetrieben. Damit die Patienten ICT-gestützte Gesundheitsversorgung nutzen, müssen diese nicht nur evaluiert werden, es braucht auch bedarfs- und lösungsorientierte Anwendungen.
Chancen
ICT bietet grosses Potenzial, dem Mangel an Gesundheitspersonal entgegenzu wirken und bislang Unerreichte und Unterversorgte in die Gesundheitsversorgung einzubinden.
Durch M-Health kann man Kosten für Diagnose und Behandlung reduzieren und so mehr Patienten behandeln.
Patienten, Ärzte und Dienstleistungen können effektiv überprüft und Veränderungen frühzeitig wahrgenommen werden.
Patienten werden durch Zugang zu Informationen und Möglichkeiten des Aus tauschs gestärkt.
Risiken
Das Wissen über die zahlreichen E-Health-Innovationen wird noch zu wenig geteilt (Best Practice) und die Produkte zu wenig evaluiert (Lessons learned), so dass Qualität und Nachhaltigkeit oft nicht nachgewiesen werden können.
Der persönliche Kontakt, der vor allem bei chronisch Kranken sowie Älteren wichtig ist, geht zum Teil verloren.
Die Fernbeobachtung und Telemedizin fordern von Ärzten neue Kompetenzen und setzen fähige Patienten voraus, was nicht bei jedem Krankheitsbild oder Bildungsstand gegeben ist.
Um die Trendwende in der Gesundheitsversorgung effektiv zu gestalten, wird eine stärkere Zusammenarbeit von öffentlicher und privater Hand in Forschung und Umsetzung immer wichtiger (vgl. Doc Handy, Trendreport).
Dass dies eine grosse Herausforderung für das Gesundheitswesen ist, steht fest. Die demografischen Gegebenheiten einer Gesellschaft in Bezug auf die neuen Medien und Techniken müssen daher im Auge behalten werden. Es ist wichtig, die neuen Medien in der Pflege und Medizin in Bezug auf die Prävention und Gesundheitsförderung entsprechend zu fördern. Da praxisnahe Informationen in elektronischer Form zu diesen Gebieten weitgehend fehlen, müssen diese erarbeitet werden. Die ältere Generation ist ebenfalls aufgefordert, sich mit den neuen Medien auseinander zu setzen. Die Schulen sind zwar auf dem richtigen Weg, aber die Medienarbeit muss weiter entwickelt werden, da die Technologien sich rasant vorwärts bewegen. Bei Beachtung dieser Punkte in der Prävention wird das Gesundheitssystem gestärkt, was ebenfalls einen substantiellen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung leistet. Die zentrale These dieser Arbeit ist, dass sich die Gesellschaft durch die Bildung in diesen Themenbereichen weiterentwickeln kann.
Im folgenden Kapitel werden als erstes die Theorien über Globalisierung, mobiles Lernen, mobiles Lernen im Gesundheitswesen und im Spital beschrieben.
Im dritten und vierten Kapitel wird beschrieben, wie eine Idee zur Weiterentwicklung einer Wissensplattform angeregt wurde sowie welche Möglichkeiten und Grenzen sich bei einem solchen Beispiel aufzeigen. Im fünften Kapitel werden anhand von Empfehlungen verschiedene Anregungen gezeigt, die hilfreich sein können, um diese grosse Herausforderung positiv zu gestalten.
Das Schlusskapitel bietet eine Zusammenfassung und Ausblick für die Weiterentwicklung dieser Idee des mobilen Lernens.
Diese Arbeit richtet sich an Mitarbeitende in Spitälern, die als Vorarbeit für ein komplexes Thema eine Situationsanalyse angehen möchten und erste Schritte erproben für eine definitive Umsetzung.
Im EDV-Bereich werden zahlreiche Ausdrücke auf verschiedene Arten geschrieben. Wir verwenden in dieser Arbeit die zurzeit meist verwendeten Trends wie E-Health, E-Learning, E-Tutor etc.
2. THEORIE DER BEGRIFFLICHKEITEN GLOBALISIERUNG UND MOBILES LERNEN
Im folgenden Teil betrachten wir die verschiedenen Elemente der Globalisierung, mobiles Lernen und das Netzwerk vom Lernen. Mobiles Lernen im Gesundheitswesen und im Spital sind weitere Themen, welche wir in unsere Betrachtungen einbeziehen.
2.1 GLOBALISIERUNG
Das Wort „global“ ist aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie Kugel. Im übertragenen Sinn heisst das erdumfassend oder gesamt. Die Enzyklopädie „Wikipedia“ bietet folgende Begriffserklärung über die Globalisierung:
„Die Globalisierung ist der Vorgang der zunehmenden weltweiten Verflechtung in allen Bereichen (Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt, Kommunikation etc). Diese Verdichtung der globalen Beziehungen geschieht auf der Ebene der Individuen, Gesellschaften und Staaten. Als wesentliche Ursachen der Globalisierung gelten der technische Fortschritt, insbesondere in der Kommunikations- und Transporttechnologien, sowie die politischen Entscheidungen zur Liberalisierung des Welthandels“ (vgl. Globalisierung, 2013).
2.1.1 SCHWEIZER GESUNDHEITSAUSSENPOLITIK
Im Jahre 2006 veröffentlichte die Schweiz als erstes Land eine nationale Strategie zur globalen Gesundheit. Heute zeigt auch der Vernehmlassungsprozess der Schweizerischen Gesundheitsaussenpolitik (GAP) vom 9. März 2012 auf, dass der Bundesrat vor Gesundheitsfragen nicht halt macht. Spätestens in sechs Jahren soll dieser Vertrag wieder überprüft werden. Diese Vereinbarung regelt sämtliche Kontakte mit dem Thema Gesundheit zwischen Nachbarländern, Europapolitik, aber auch die Entwicklungspolitik mit den ärmsten Ländern. An Stelle einer klassischen Zusammenarbeit wird je länger je mehr ein Austausch zwischen gleichberechtigten Staaten gefordert, lebt doch zwei Drittel der Menschheit in Schwellenländern. Eine Vielzahl von Organisationen wie z. B. WHO, EU, Weltbank etc. sind in der Gesundheitszusammenarbeit tätig. Mit der Gesundheitsdirektorenkonferenz, Forschung, NGO’s sind die Mitarbeitenden in den Spitäler in diesen Vertrag involviert (vgl. Sägesser, 12/12, S. 18f.).
Die Gesundheitsaussenpolitik hat folgenden Leitfaden mit 20 Zielen basierend auf Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie geschrieben:
Die 20 Ziele der Schweizerischen Gesundheitsaussenpolitik
Die Zusammenarbeit mit der EU zu Gesundheits- und Verbraucherschutzfragen vertraglich regeln.
Die WHO als leitende und koordinierende Behörde der globalen Gesundheit stärken.
Die Wirkung, Effizienz und Kohärenz der globalen Gesundheitsarchitektur verbessern.
Die Stärkung leistungsfähiger, qualitativ hochstehender,erschwinglicher und fairer Gesundheitssysteme ins Zentrum der GAP rücken.
Gesundheit als wesentlichen Pfeiler der Aussenpolitik integrieren.
Die Stellung von Genf als internationale Gesundheitshauptstadt konsolidieren und gezielt stärken.
Rahmenbedingungen zur Stärkung der Forschung im Bereich der globalen Gesund heit schaffen.
Die Stärken der Schweizer Gesundheitswirtschaft international positionieren.
Geistiges Eigentum als Anreiz für die Forschung angemessen schützen.
Wirtschaftliche, soziale und ökologische Determinanten der Gesundheit nachhaltig verbessern.
Das Potenzial der technologischen Entwicklung und der sozialen Medien im Bereich der globalen Gesundheit ausschöpfen.
Das international vernetzte System zur Kontrolle und Bekämpfung von Infektions krankheiten weiter stärken.
Die Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Strahlenschutz und Chemikalien schützen.
Globalen Mangel und ungleiche Verteilung von Gesundheitspersonal bekämpfen.
Zugang zu unentbehrlichen, bewährten wie neu entwickelten, qualitativ einwandfreien und bezahlbaren Arzneimitteln und Medizinprodukten verbessern.
Prävention, Diagnose und Behandlung nichtübertragbarer Krankheiten fördern.
Die vier Säulen der Drogenpolitik (Prävention, Therapie und Wiedereingliederung, Schadenminderung, Kontrolle und Repression) international etablieren.
Schweizer Kapazitäten und Kompetenzen für die Rettung und Sicherung von Leben und für die Wiederherstellung des gesundheitlichen Wohlbefindens bei humanitären Krisen zur Verfügung stellen.
Das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmass an körperlicher und geistiger Gesundheit fördern und verwirklichen.
Die Gesundheit von Mutter und Kind sowie die sexuelle und reproduktive Gesundheit fördern (zit. in Sägesser, 12/12 S. 19).
2.1.2 SCHWEIZER GESUNDHEITSINNENPOLITIK
Im Jahr 2006 wurde ein Konzept für eine nationale Strategie „E-Health“ erarbeitet und 2007 vom Bundesrat mitunterzeichnet. Da die Schweiz zu dieser Zeit über keine explizite Strategie verfügte, wurde durch die E-Health-Strategie eine grundsätzliche Überlegung der Struktur des Gesundheitssystems als übergeordnete Idee erfasst (vgl. Heller, 2012, S. 78f.).
Das Bundesamt für Gesundheit erarbeitete eine umfassende Strategie für das Gesundheitswesen, die vom Bundesrat im Januar 2013 als Gesamtschau „Gesundheit 2020“ verabschiedet wurde. Diese Strategie hat zum Ziel, das schweizerische Gesundheitssystem optimal auf die kommenden Herausforderungen auszurichten und gleichzeitig bezahlbar zu halten. Es geht darum, die Selbstkompetenz aller Bevölkerungsgruppen in Gesundheitsfragen zu erhöhen sowie unnötige Verhandlungen und Komplikationen zu vermeiden. Dadurch sollen transparente Strukturen sowie bessere und klarere Steuerungen des Systems ausgeschöpft werden, um die vorhandenen Reserven der Effizienz zu nutzen. Im Zentrum stehen die Menschen mit ihren Bedürfnissen und ihrem Wohlbefinden. Deshalb müssen diese Grundlagen weiterentwickelt werden (vgl. BAG, 2013, 1).
Welches sind die Prioritäten der Schweizer Gesundheitspolitik für die nächsten acht Jahre?
Der Bericht „Gesundheit 2020“ beinhaltet vier gesundheitspolitische Handlungsfelder mit 36 Massnahmen. Diese werden schrittweise umgesetzt. 12 Ziele sind formuliert, die dazu führen, das bewährte Schweizer Gesundheitssystem optimal auf die aktuellen und kommenden Herausforderungen auszurichten (vgl. BAG, 2013, S. 1).
Hier die vier Handlungsfelder der Agenda „Gesundheit 2020“:
Lebensqualität sichern
Chancengleichheit und Selbstverantwortung stärken
Versorgungsqualität sichern und erhöhen
Transparenz schaffen, besser steuern und koordinieren (vgl. BAG, 2013, S. 24)
Abb. 1: BAG, 2013, S. 6
Für die wirkungsvolle Umsetzung der gesundheitspolitischen Strategie sind selbstverständlich die Mitarbeit und die Unterstützung aller involvierten Partnerorganisationen nötig. Daher wurde vom BAG ab Februar 2013 eine Massnahmenliste ausgearbeitet, welche dem Bundesrat noch im selben Jahr vorgelegt wird. Für eine zweite Phase müssen weitere Massnahmen noch erarbeitet werden mit Berücksichtigung der Auswirkungen der bereits umgesetzten Massnahmen. Jede neue Massnahme wird dem Bundesrat zum Entscheid vorgelegt (vgl. BAG, 2013, S. 22).
Da die nationale Gesundheitspolitik die Unterstützung der Kantone benötigt, wird dies mit den Gesundheitsdirektoren aller Kantone und mit dem Vorstand der Gesundheitsdirektoren/-innenkonferenz diskutiert. Ebenfalls ist die aktive Mitarbeit aller Partner/-innen gefragt. Dazu gehören Leistungserbringer (FMH, H+ u. a.), die Versicherten, die Versicherer, die PatientInnen, viele Nonprofitorganisationen, aber auch private Unternehmen (vgl. BAG, 2013, S. 23). Die globale Gesundheit national und international ist eine grosse Herausforderung, sind doch verschiedene Akteure zu einer gemeinsamen Position zu bewegen (z.B. national: EDA, DEZA, SECO etc.). Es gelang dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) alle Bundesstellen einem konstruktiven, lösungsorientierten Dialog zu unterstellen.
Wie beteiligt sich die Schweiz am Reformprozess der WHO?
Die Schweizer Politik erarbeitete für die Entwicklungsländer den Zugang zu Medikamenten sowie einen angemessenen Schutz des geistigen Eigentums bei Innovationen. Aussenpolitische und internationale Beziehungen über das Thema Gesundheit sind im BAG angesiedelt.
Bei der WHO in Genf wurde ein Schweizer mit guten Kenntnissen in Gesundheit, Politik, Wirtschaft, Recht und Diplomatie als Seniorberater angestellt. Die WHO benötigt tief greifende Reformen, die Schweiz kann als Hauptakteurin in Debatten zur globalen Gesundheit beratend zur Seite stehen.
Bis heute ist das Thema „Gesundheit“ stark durch die Ärzteschaft monopolisiert. Ziel des Dialogs im aktuellen Gesundheitssystem ist, einen Perspektivenwechsel zu erreichen, um dadurch voneinander zu lernen. Im 21. Jahrhundert ist das Gesundheitssystem einer der wichtigsten Sektoren der Gesellschaft.
Der Reformprozess der WHO ist bereits angelaufen. Themen sind Programm-Prioritäten, Finanzen, Gouvernanz und Management. Als Beispiel: Entwicklungsprojekte dominieren und die normative Rolle kommt eher zu kurz. Daher braucht es Instrumente zur Priorisierung.
In einem Kernteam der Generaldirektion der WHO wird am laufenden Reformprozess gearbeitet. Die Arbeit bei der WHO ist in einem multikulturellen Umfeld, was mit Sicherheit viel Verhandlungsgeschick braucht (vgl. Gallati, 12/12, S. 20 – 21).
2.1.3 GLOBALER ANSPRUCH AUF DAS WISSEN DER WELT
Im Jahre 2001 tippte der Gründer Jimmy Wales mit der ersten Testzeile den Grundstein zum Weltwissen für die Online-Enzyklopädie „Wikipedia“. Aus einer kleinen informellen Gemeinschaft entwickelte sich schnell eine formale Organisation. Die Ziele dieses Projektes sind:
Das Wissen der Welt zu erfassen
Das Wissen für jeden zugänglich zu machen
Daraus entstanden bis heute 23 Millionen Artikel in 270 Sprachen. Dies ist das grösste Experiment eines Tandems aus einer informellen Community und einer formalen Organisation im partizipativen Management einer globalen-digitalen Gemeinschaft (vgl. Wales, 2001).
Das Organisationsprinzip der Wikipedia war sehr revolutionär. Ohne Registrierung konnte jede Person Artikel verfassen und im Nachhinein bearbeiten. Innert kürzester Zeit wurde Wikipedia zur umfangreichsten Online-Enzyklopädie.
In den Anfängen konnte die Wikipedia-Plattform weitgehend von der Wissenschaft ignoriert werden. Dies ist heute aber nicht mehr eindeutig der Fall. Für wissenschaftliches Arbeiten ist die Wikipedia jedoch ungeeignet, da es für die Zitierpraxis meist keine adressierbaren Autoren gibt. Es ist erstaunlich, dass ein derart dynamisches Format keine übliche zitierbare Quelle darstellt (vgl. König, 2012).
Wie geht es weiter? Was verbindet eigentlich Wissenschaft und Wikipedia? Wo liegt der Unterschied?
Enzyklopädien konzentrieren sich auf kurze und präzise Erfassungen von gesichertem Wissen. Die Wissenschaft hingegen beschäftigt sich mit der Generierung neuen Wissens. Auf konstruktive Weise begegnen sich heute die Wissenschaft und Wikipedia je länger je mehr. Forscher versuchen immer mehr, wissenschaftliche Inhalte mit zu gestalten. Durch die Regeln der Online-Community entsteht ein struktureller Konflikt, welcher zwischen der Wikipedia und dem Wissenschaftssystem nicht immer reibungslos verläuft. Durch den Druck der Popularität bietet sich eine ganze Reihe von Annäherungen an (vgl. König, 2012).
2.1.4 DIE DIGITALE WELT IM GESUNDHEITSWESEN
Im Gesundheitswesen braucht es für die äusserst sensiblen und vertraulichen Daten der Patientinnen und Patienten in der digitalen Welt der Kommunikation zwingend Sicherheitssysteme. Für die sichere Kommunikation zwischen Patienten und den Behandelnden, insbesondere Ärztinnen und Ärzte im Spital und Praxis, stehen heute geeignete Werkzeuge zur Verfügung. Daher ist im Schweizerischen Gesundheitswesen die E-Health-Strategie zur unverzichtbaren Plattform geworden.
Bereits 1996 hat als erstes die FMH die HIN (Health Info Net) gegründet. Für den Datentransport bildet die HIN-Technologie die Voraussetzung für die Wahrung des Arztgeheimnisses und den Datenschutz. 2006 hat die FMH als zweites mit der Health Professional Card (HPC) eine weitere Voraussetzung für die Digitalisierung geschaffen. Dadurch wird die Ärzteschaft auf die kommenden Herausforderungen der digitalen Welt vorbereitet. Durch einen eingebauten Chip können Ärztinnen und Ärzte sicher elektronisch signieren. Der Arzt wird eindeutig digital ausgewiesen (vgl. Stoffel, 45/12, S. 1637).
Im Schweizerischen Gesundheitswesen übernimmt der Berufsverband der FMH die Verantwortung für die Health Professional Card. Wer sich mit einem Sichtausweis oder mit einem elektronischen Zertifikat als Ärztin oder Arzt ausgibt, hat die entsprechende Qualifikation.
Es gilt, die Ängste in der Bevölkerung gegenüber der E-Health-Strategie abzubauen. Eine sichere und effiziente Nutzung der Werkzeuge HIN und HPC helfen mit, Vorbehalte gegenüber der elektronischen Welt abzubauen.
Die Verantwortung, die E-Health-Strategie zu realisieren, liegt bei Bund, Kantonen und der FMH. Durch Synergien und Ergänzungen werden die HIN- und HPC-Plattform weiter entwickelt (vgl. Stoffel, 45/12, S. 1637).
Wie sehen die Reformen im Gesundheitswesen und in den Spitälern aus?
Im Schweizerischen Gesundheitswesen stehen wir am Anfang von Neuerungen. Die Reformen „Swiss DRG“ und „E-Health“ sind eng miteinander verknüpft. Um den eigenen Betrieb zu positionieren, müssen die Spitäler die digitale Vernetzung vorantreiben. Die nächste Reform steht schon am Horizont. Durch das Bundesgesetz „E-Patientendossier“ (EPDG) schlägt der Bundesrat vor, dass die Spitäler fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes mit diesem Instrument arbeiten müssen. Das E-Patientendossier ermöglicht den digitalen Datenaustausch zwischen niedergelassenen Ärzten, Apotheken, Reha-Kliniken und anderen Behandelnden.
Im Interesse der Spitäler liegt eine rasche Entwicklung des E-Patientendossier und der E-Health-Strategie Schweiz. Der Motor der Veränderung ist das DRG-System. Beispiele für Anreize des DRG-Systems:
Anreiz „Effiziente und Kostengünstige Behandlung“.
Anreiz „minimale Behandlung“.
Anreiz „minimale Aufenthaltsdauer“.
Diese Anreize können den Eindruck erwecken, dass Kranke zur manipulierbaren Masse werden. Das Gegenteil ist aber der Fall. E-Health muss gut in die Behandlungspfade integriert werden. Durch diese Integration kann die Bevölkerung in Zukunft erwarten, dass die notwendigen Unterlagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung stehen. Unnötige und belastende Mehrfach-Untersuchungen fallen weg.
E-Health im Spital hat an Bedeutung gewonnen. Es benötigt strategische Vorarbeiten, welche vor allem eine Aufgabe des Spitalmanagements bilden. Die Vernetzungen intern und extern bedeuten kein technisches Problem, sie sind eine Frage des Managements.





























