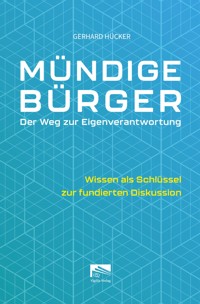
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Fakten gegen FAKE NEWS – Wissen als Schlüssel zur fundierten Diskussion Fake News beeinflussen unsere Meinung, Influencer diktieren mehr und mehr unser Verhalten. Durch das Handy, das als Kommunikationsmittel nicht mehr wegzudenken ist, bestimmen Dritte oft das eigene Denken. Die politische Diskussion wird zunehmend in Form einer persönlichen Auseinandersetzung geführt und nicht als Streit um die Sache und das Ringen um die beste Lösung. Umso unerlässlicher ist der Erwerb von Sachkompetenz. 66 Begriffe hat der Autor für dieses Buch ausgewählt. Sie stammen aus den Bereichen Ethik, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Texte zu diesen Begriffen beziehen Stellung zu aktuellen Problemen Deutschlands. Zugleich beleuchten sie die Themen aus unterschiedlichen Perspektiven, um so zu einer eigenen Schlussfolgerung zu kommen. Diese Standpunkte weiterzudenken, sie zu untermauern oder ihnen durch Argumente zu widersprechen, ist ausdrücklich erwünscht – denn eine Diskussion über wesentliche Punkte unserer Gesellschaft anzuregen, ist das Ansinnen dieses Buches.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In diesem Buch begegnen Ihnen 66 zentrale Begriffe aus den Bereichen Ethik, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Auseinandersetzung mit diesen Themen ist lohnenswert, da sie uns helfen, die Welt und unsere Rolle darin besser zu verstehen. Dieses Wissen ist die Basis für fundierte Entscheidungen – sei es im Alltag oder in Krisensituationen.
Ethik unterstützt uns dabei, unsere Werte zu hinterfragen und moralische Urteile zu fällen. Sie dient als innerer Kompass und gibt uns Orientierung, besonders in schwierigen Momenten.
Politisches Grundwissen befähigt uns, bewusst und verantwortungsvoll an Wahlen teilzunehmen und unseren Beitrag zur Demokratie zu leisten.
Wirtschaftliche Kenntnisse sind von besonderer Bedeutung, da wir mit Ihrer Hilfe ökonomische und gesellschaftliche Entscheidungen besser verstehen. Dieses Verständnis ist notwendig, um politische Prozesse und deren Auswirkungen zu durchdringen und aktiv am politischen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Gesellschaft umfasst uns alle – sie entsteht durch das Zusammenleben und die ständige Interaktion von Menschen. Nichts passiert im Alleingang, jede Handlung hat Auswirkungen auf das große Ganze.
Mit diesem Buch möchte ich aufzeigen, auf welche Weise diese Themen uns alle betreffen und wie wichtig es ist, sich mit ihnen auseinan-derzusetzen, um ein harmonisches Miteinander zu fördern.
Fakten gegen Fake News: Wissen als Schlüssel zur fundierten Diskussion
Fake News beeinflussen unsere Meinung, Influencer diktieren mehr und mehr unser Verhalten. Durch das Handy, das als Kommunikationsmittel nicht mehr wegzudenken ist, bestimmen Dritte oft das eigene Denken.
Die politische Diskussion wird zunehmend in Form einer persönlichen Auseinandersetzung geführt und nicht als Streit um die Sache und das Ringen um die beste Lösung. Umso unerlässlicher ist der Erwerb von Sachkompetenz.
66 Begriffe hat der Autor für dieses Buch ausgewählt. Sie stammen aus den Bereichen Ethik, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Texte zu diesen Begriffen beziehen Stellung zu aktuellen Problemen Deutschlands. Zugleich beleuchten sie die Themen aus unterschiedlichen Perspektiven, um so zu einer Schlussfolgerung zu kommen.
Diese Standpunkte weiterzudenken, sie zu untermauern oder ihnen durch Argumente zu widersprechen, ist ausdrücklich erwünscht – denn eine Diskussion über wesentliche Punkte unserer Gesellschaft anzuregen, ist das Ansinnen dieses Buches.
MÜNDIGE
BÜRGER
DerWegzur Eigenverantwortung
Wissen als Schlüssel
zur fundierten Diskussion
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Kapitel 1:Ethik
Ethik und Moral
Freiheit
Gerechtigkeit
Haltung
Leitkultur
Nachhaltigkeit
Selbstbestimmung und Egoismus
Kapitel 2: Politik
Asylpolitik
Berufspolitiker
Bürgergeld
Bundestag
Demokratie
Doppelte Staatsbürgerschaft
Einwanderung
Entwicklungshilfe
Europa
Föderalismus
Geschichte
Gesetze
Gewerkschaften
Industriepolitik
Klimawandel
Non-Governmental Organizations
Parteien
Rechtsextremismus
Rechtsstaat
Sanktionen
Sozialismus
Staat
Wahlalter
Wehrpflicht
Kapitel 3:Wirtschaft
Arbeitszeit
Atomkraft
Bargeld
Bürokratie
Deutsche Bahn AG
Elektroautos
Gehälter
Güterverkehr
Inflation
Kapitalismus
Mittelstand
Rente
Schuldenbremse
Steuern
Subventionen
Wachstum
Wettbewerb
Kapitel 4:Gesellschaft
Drogen
Familie
Fake News
Fernsehen
Homosexualität
Influencer
Integration
Kinder
Kopfnoten
Krankenversicherung
Künstliche Intelligenz
Religion
Schulsystem
Solidarität
Soziale Medien
Sprache
Toleranz
Zeitgeist
Exkurs: Ukraine
Die richtige Reaktion auf Putins Krieg
Vorwort
Eine Richtschnur für selbstbestimmtes Handeln
Zeit meines Lebens habe ich Wert darauf gelegt, für mich selbst verantwortlich zu sein. In jungen Jahren gab ich eine Topmanagement-Position auf. Das Resultat dieser Entscheidung: Ich erlebte die Erfolge, aber auch die Misserfolge eines Unternehmers. Beides gehört zusammen. In den seltensten Fällen geht es im Leben immer nur aufwärts.
In diesem Buch habe ich mir Gedanken zu Begriffen gemacht, die mir für die heutige Zeit bedeutsam erscheinen. Zur Diskussion über sie möchte ich mit diesem Buch anregen. Denn mich interessiert: Haben Sie andere Erfahrungen?
In meinem langen, interessanten Leben hatte ich die Möglichkeit, Erfahrungen auf allen fünf Kontinenten der Erde zu sammeln und mein Wissen in Vorlesungen, Lehrgängen, Vorträgen und Gesprächen weiterzugeben. Wissen kann man weitergeben, Erfahrungen will und muss jeder selbst machen, so sagt man. Trotzdem ist dieses Buch entstanden, obwohl es natürlich auch das Ergebnis meiner Lebenserfahrung ist. Es richtet sich an Menschen, die selbstbestimmt leben und sich zu wichtigen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Fragen der Gegenwart eine eigene Meinung bilden wollen. Denn in einer Welt, die sich ständig verändert, ist Wissen die wahre Macht.
Derzeit beeinflussen Fake News unsere Meinung, Influencer bestimmen mehr und mehr unser Verhalten. Durch das Handy, das als Kommunikationsmittel nicht mehr wegzudenken ist, bestimmen Dritte oft das eigene Denken. Die politische Diskussion wird zunehmend in Form einer persönlichen Auseinandersetzung geführt und nicht als Streit um die Sache und das Ringen um die beste Lösung. Umso unerlässlicher ist der Erwerb von Sachkompetenz. Nur wenn sie die Grundlage von Diskussionen ist, lässt sich dieser Missstand beheben.
Ich denke vor allem an junge Menschen, die zu Recht den Anspruch haben, die gemeinsame Zukunft mitzugestalten. Und ich denke auch an diejenigen Menschen, die aus dem Ausland – häufig aus anderen Kulturkreisen – zu uns kommen, und die zu bleiben gedenken. Sie sollten die Herausforderungen unserer Gesellschaft verstehen und über das Wissen verfügen, um im täglichen Leben mitreden zu können und wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft zu werden. Nicht nur, aber vor allem an diese beiden Gruppen richtet sich das Buch.
Ich habe einzelne Begriffe aus unterschiedlichen Bereichen zusammengetragen, die miteinander zusammenhängen und sich bisweilen überschneiden. Die Auswahl der Themen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zudem handelt es sich um kein wissenschaftliches Werk, trotzdem wurden die Aussagen selbstverständlich nach bestem Wissen überprüft. Zu jedem einzelnen Begriff habe ich Fakten, Meinungen Dritter und bereits gedachte, geäußerte und geschriebene oder auch neue Lösungsvorschläge zusammengetragen. Und zu jedem Begriff habe ich meinen eigenen Standpunkt formuliert – man mag ihn teilen oder nicht. Wichtig ist mir, dass sich jeder meiner Leser eine eigene, fundierte Meinung bildet – und auf dieser Basis das für ihn und unsere Gesellschaft Richtige tut.
Ich möchte Sie zum Nachdenken über die angesprochenen Probleme und Herausforderungen unserer Zeit anregen.
Kronberg, im Herbst 2024
Gerhard Hücker
Einleitung
66 Begriffe habe ich für dieses Buch ausgewählt. Sie stammen aus den Bereichen Ethik, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Texte zu diesen Begriffen beziehen Stellung zu einigen aktuellen Problemen Deutschlands. Zugleich beleuchten sie die Themen aus unterschiedlichen Perspektiven, um so zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Dieses Fazit weiterzudenken, es zu untermauern oder auch ihm durch Argumente zu widersprechen, ist ausdrücklich erwünscht – denn eine Diskussion über wesentliche Punkte unserer Gesellschaft anzuregen, ist das Ansinnen dieses Buches. Der Podcast „Mündige Bürger“ sowie die Social-Media-Plattformen LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok und YouTube bieten künftig zusätzlichen Raum für einen intensiven Diskurs.
In meinem beruflichen Leben habe ich oft mit jungen Leuten zu tun. Sie zu fördern, war und ist mir ein Anliegen. Zuallererst halte ich es dabei für unverzichtbar, über die für das eigene Leben ausschlaggebenden Themen informiert zu sein – was selbstverständlich nicht nur für junge Menschen gilt.
Jede Zeit hat ihre spezifischen Herausforderungen. Mir besonders relevant erscheinende Punkte habe ich in diese Sammlung aufgenommen und mich bemüht, sie möglichst knapp und verständlich auf das Wesentliche herunterzubrechen. Wenn dieser Band meinen Lesern dadurch im undurchschaubar anmutenden Dschungel der Fakten und Meinungen ein Wegweiser und zugleich Anstoß zur weiteren Beschäftigung mit diesen Fragen ist, hätte er seine wesentliche Aufgabe erfüllt.
Warum halte ich die ausgewählten Begriffe für wichtig?
Ethik fördert die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und des Charakters. Sie hilft Menschen, ihre Werte zu reflektieren, moralische Urteile zu fällen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch ethische Diskussionen lernen wir, anderen zuzuhören und verschiedene Standpunkte zu verstehen. Dies wiederum fördert Empathie und die Fähigkeit, Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Ethik bietet Hilfestellung bei der Bewältigung von alltäglichen und für das Leben entscheidenden Problemstellungen. Sie dient als eine Art innerer Kompass für moralisches Handeln, besonders in Krisensituationen.
Unser politisches System zeichnet sich dadurch aus, dass bei Wahlen jeder Bürger eine Stimme hat, unabhängig von Geschlecht, Intellekt und Bildung. Jede Stimme ist gleich wichtig und trägt zur Entscheidungsfindung über unsere Zukunft bei. Mit politischen Grundkenntnissen können Bürger begründete Entscheidungen bei Wahlen treffen. Sie können besser verstehen, wie politische Entscheidungen ihr Leben beeinflussen. Politisches Wissen ermöglicht es Menschen, sich aktiv am demokratischen Prozess zu beteiligen, ihre Meinung zu äußern und für ihre Interessen einzutreten. Es ist Voraussetzung, um die Funktionsweise von Regierung, Parlament und anderen politischen Institutionen zu verstehen. Ein solides politisches Grundwissen macht Menschen weniger anfällig für Desinformation, Propaganda und extreme politische Ansichten.
Wirtschaftliches Grundwissen ermöglicht dem Einzelnen, ökonomische und gesellschaftliche Entscheidungen zu treffen. Viele politische Entscheidungen basieren auf wirtschaftlichen Grundlagen. Ein Verständnis dieser Zusammenhänge ist nötig, um politische Prozesse und deren Auswirkungen besser nachzuvollziehen. Wirtschaft und Politik sind eng miteinander verflochten. Kenntnisse über diese Verflechtungen eröffnen einen tieferen Einblick in gesellschaftliche Prozesse. Wirtschaftliches Wissen hilft bei der Einschätzung von Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, etwa bei der Verteilung von Einkommen und Besitz zwischen verschiedenen Gruppen. Es ermöglicht, Konflikte zwischen verschiedenen Zielen – zum Beispiel Freiheit und Sozialismus – zu erkennen und mögliche Kompromisse zu verstehen. Wissen auf diesem Gebiet ist wichtig, um internationale wirtschaftliche Beziehungen und deren Auswirkungen auf verschiedene Länder und auf jetzige sowie nachfolgende Generationen zu verstehen. Insgesamt trägt die Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge dazu bei, dass Bürger aktiv und informiert am gesellschaftlichen und politischen Leben teilnehmen können. Auch die Auswirkungen wirtschaftlicher Entscheidungen auf ihr persönliches Leben und die Gesellschaft als Ganzes können sie so besser einschätzen.
Gesellschaft bezieht sich immer auf eine Gruppe von Menschen, die in irgendeiner Form zusammenleben oder miteinander interagieren. Nichts kann geschehen, ohne dass es auch andere betrifft. Wir sind keine Einzelkämpfer, auch wenn einige das glauben. Es ist mir wichtig, auf diese Zusammenhänge hinzuweisen und zu beschreiben, welche Faktoren und Verhaltensweisen zu einem gedeihlichen Miteinander beitragen können.
Kapitel 1: Ethik
Ethik und Moral
Bei Ethik und Moral handelt es sich um eng miteinander verbundene Begriffe. Sie stellen die Prinzipien des richtigen und falschen Handelns sowie des guten und schlechten Verhaltens ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie wissen, wovon ich rede?
Ethik ist die wissenschaftliche und philosophische Auseinandersetzung mit moralischen Fragen. Moral bezeichnet die Werte und Regeln, die in einer Gesellschaft oder Gruppe allgemein anerkannt sind. Ethische und moralische Überzeugungen beeinflussen, wie wir alltägliche Entscheidungen treffen – von der Wahl unserer Nahrung bis hin zu unserem Verhalten gegenüber anderen. Sie fördern die Selbstreflexion und das Gewissen. Denn sie ermutigen uns, unser Verhalten regelmäßig zu überdenken und sicherzustellen, dass es mit unseren ethischen Werten übereinstimmt. Moralische Prinzipien wie Respekt und Toleranz prägen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, und helfen, harmonische Beziehungen zu pflegen. Ethische Überlegungen fördern Verantwortungsbewusstsein und Fürsorge, sei es in der Familie, unter Freunden oder in der Gemeinschaft.
In vielen Berufen gibt es spezifische ethische Kodizes, die das Verhalten der Fachleute regeln, zum Beispiel in der Medizin, im Journalismus oder im Rechtswesen. Unternehmen werden ermutigt, ethische Geschäftspraktiken zu verfolgen, etwa was die faire Behandlung der Mitarbeiter, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit betrifft.
Viele Gesetze und gesellschaftliche Normen basieren auf ethischen und moralischen Prinzipien wie Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit. Politische Führer und Entscheidungsträger sind oft gezwungen, ethische Überlegungen in ihre Politik einzubeziehen, insbesondere bei Themen wie Menschenrechte, Umweltpolitik und der sozialen Gerechtigkeit. Ethische Überlegungen zu Verantwortung und Nachhaltigkeit fördern umweltfreundliches Verhalten, etwa in Form von Recycling, Energiesparen und bewusstem Konsum. Moralische Einstellungen beeinflussen, wie wir Tiere und die Natur behandeln, und fördern Initiativen zum Schutz der Umwelt und des Tierwohls.
Mit dem Fortschritt von Technologien wie künstlicher Intelligenz und Biotechnologie sind ethische Überlegungen entscheidend geworden für deren Regulierung und deren verantwortungsvollen Einsatz. Ethische Prinzipien beeinflussen, wie wir mit Datenschutz und Privatsphäre umgehen, insbesondere im digitalen Zeitalter. Insgesamt prägen Ethik und Moral nahezu jeden Aspekt unseres täglichen Lebens und unterstützen uns dabei, ein harmonisches und verantwortungsbewusstes Zusammenleben in der Gesellschaft zu gewährleisten.
Gleichzeitig ist jedoch festzustellen: Ethik ist keine starre Theorie, sondern erfordert eine praktische Anwendung in unserem täglichen Leben. Sie entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter und muss regelmäßig überdacht und angepasst werden. Wir müssen uns stets bewusst sein, dass unsere Handlungen Auswirkungen haben und dass wir für unser Verhalten verantwortlich sind. Nur so können wir aktiv dazu beitragen, eine positive Veränderung in unserer Umgebung zu bewirken.
Ob sich die Deutschen ethisch und moralisch einwandfrei verhalten, lässt sich nicht pauschal beantworten, da ethisches und moralisches Verhalten individuell und situationsabhängig ist. Und die Zusammensetzung unserer Gesellschaft hat zu einem schnellen Wandel des individuellen Verhaltens geführt.
Die grundsätzlichen Voraussetzungen für ethisches und moralisch einwandfreies Handeln sind in Deutschland vorhanden, zum Teil in unserem Grundgesetz formuliert. Wir müssen nur dafür sorgen, dass alle sie praktizieren. Darüber hinaus gibt es eine ausgeprägte Kultur des Nachdenkens und des Gedankenaustausches über die vorherrschende Ethik. In verschiedenen Bereichen wie Forschung, Medizin und öffentlicher Gesundheit wurden ethische Fragen intensiv diskutiert. Außerdem besteht ein großes Bewusstsein für die Verantwortung des Einzelnen und der Gesellschaft. Dies zeigt sich beispielsweise in der Betonung der Forschungsfreiheit, verankert in Artikel 5 des Grundgesetzes, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung.
In modernen pluralistischen Gesellschaften wie der deutschen existieren jedoch unterschiedliche Moralvorstellungen nebeneinander. Zudem findet ein ständiger Wandel der Moral statt. Dies führt zu einer Vielfalt ethischer Perspektiven und Verhaltensweisen.
Ethisches und moralisches Verhalten sind nicht immer einheitlich. Wie in jeder Gesellschaft gibt es auch in Deutschland Abweichungen von ethischen und moralischen Normen. Dennoch lässt sich sagen, dass es in Deutschland ein starkes Bewusstsein für ethische Fragen gibt. Viele Menschen sind bestrebt, sich an ethischen Prinzipien zu orientieren. Letztlich hängt ethisches und moralisches Verhalten von individuellen Entscheidungen ab, die von persönlichen Werten, gesellschaftlichen Normen und situativen Faktoren beeinflusst werden. Die deutsche Gesellschaft bietet jedoch einen Rahmen, der ethisches und moralisches Verhalten fördert und fordert.
Mein Standpunkt
Werte und Regeln einer Gesellschaft ändern sich mit den Generationen. Wer entscheidet, was ethisch und moralisch einwandfrei ist? Jeder Mensch hat doch subjektive Vorstellungen vom Begriff „Moral“. Kann Moral überhaupt objektiv sein? Ich meine: Ja! Ich finde sogar, es darf keine subjektive Moral geben. Moral kann keine Frage der persönlichen Anschauung und des individuellen Geschmacks sein. Was richtig und was falsch ist, muss sich vielmehr aus den Gegebenheiten des Lebens ergeben.
Ein Mensch handelt moralisch einwandfrei, wenn er sich an ethische Prinzipien hält, die als richtig und gerecht anerkannt werden. Dies kann jedoch – je nach philosophischer Perspektive und kulturellem Kontext – unterschiedlich sein. Jeder Einzelne sollte sich aber in seinen verschiedenen Rollen, zum Beispiel als Führungskraft, Mitarbeiter, Konsument und auch als Politiker, moralisch verhalten. Dies erfordert eine Reflexion über moralische Zwickmühlen und Konflikte zwischen Gewinn und Gewissen. Ein innerer Kompass, der durch theoretische Überlegungen und pragmatische, intuitive Gebote ausgerichtet wird, kann dabei helfen, moralisch einwandfrei zu handeln.
Moralisches Handeln erfordert ein Bewusstsein für die eigenen Handlungen und deren Auswirkungen. Es geht darum, sich ständig zu entscheiden und zu reflektieren, ob eine Handlung mehr Glück als Unglück stiftet. Auch wenn es keine perfekte moralische Bilanz gibt, ist das Bewusstsein für moralische Fallstricke entscheidend und die kontinuierliche Bemühung, besser zu handeln.
Zusammengefasst handelt ein Mensch moralisch einwandfrei, wenn er sich fortlaufend bemüht, ethische Prinzipien in seinen Handlungen zu berücksichtigen. Zugleich sollte er sich seiner moralischen Verantwortung bewusst sein und aktiv daran arbeiten, seine Entscheidungen und Handlungen zu reflektieren und zu verbessern. Ohne ethische Prinzipien und moralische Haltung wäre unser tägliches Zusammenleben problematisch. Wie zuvor angeführt, ist Deutschland nicht schlecht aufgestellt, hat aber aufgrund des raschen Wandels der gesellschaftlichen Strukturen eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Den Schulen kommt bei den Themen Ethik und Moral eine zentrale Rolle zu, und sie sollten sich ihrer noch mehr als bisher annehmen. Sie sollten dazu beitragen, die Schüler moralisch entscheidungsfähig zu machen, und zum verantwortlichen Handeln sowie zum Überdenken der eigenen Lebensgestaltung aufrufen.
Werte sind ausschlaggebend für Bildung und Erziehung und gehen über die reine Vermittlung von Lehrstoff hinaus. Für Schüler sollte Ethik deshalb ein Pflichtfach sein. Ziele dieses Unterrichts wären die Förderung eines Zugangs zu ethisch relevanten Themen und die Vermittlung von Sprachkompetenz im ethischen Argumentieren. Die Bereitschaft von Heranwachsenden zur Übernahme von Verantwortung sollte ebenfalls von den Lehrern gefördert und unterstützt werden. Der Ethikunterricht sollte darauf abzielen, dass Schüler nicht nur Werte und Normen verstehen, sondern auch lernen, warum diese gelten und wie wichtig sie für ein gelingendes Leben sind.
Statt eine bestimmte Moral zu vermitteln, sollte die Schule jedoch die Fähigkeit der Schüler fördern, moralische Fragen selbstständig, überlegt und verantwortungsvoll zu beurteilen. Die Entwicklung moralischer Kompetenzen ist ein lang andauernder Prozess, bei dem die Schule die Kinder begleiten und unterstützen muss. Schüler sollten lernen, nicht nur ihre eigene Position zu formulieren, sondern auch die Perspektiven anderer zu verstehen und zu berücksichtigen.
Diese Art der verstärkten Beschäftigung mit ethischen und moralischen Zusammenhängen würde Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, zu verantwortungsvollen Mitgliedern der Gesellschaft heranzuwachsen. Anders formuliert: Es ist wichtig, den Schülern auf diesem Gebiet Hilfestellung zu leisten, damit sie nicht nur ihre Rechte, sondern auch ihre Pflichten verstehen.
Freiheit
Die Freiheit des Menschen bezieht sich auf die Fähigkeit und das Recht eines Individuums, selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu handeln und zu entscheiden. Fühlen Sie sich frei?
„Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, das Geheimnis der Freiheit ist der Mut“, diesen Zusammenhang stellte der griechische Staatsmann Perikles (490–429 v. Chr.) bereits in der Antike her. In unseren Tagen umfasst die Vorstellung von Freiheit folgende Dimensionen:
das Recht, das eigene Leben nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten, ohne unrechtmäßige Einschränkungen durch andere,
das Recht, seine Meinung frei zu äußern und Informationen zu verbreiten, ohne Zensur oder Repressalien,
das Recht, eine Religion oder Weltanschauung frei zu wählen, auszuüben oder abzulehnen,
die Garantie, dass die persönlichen Freiheiten durch Gesetze geschützt sind und der Einzelne vor willkürlicher Verfolgung oder ungerechtfertigter Inhaftierung bewahrt wird,
das Recht, an politischen Prozessen teilzunehmen, Wahlen abzuhalten und politische Ämter zu bekleiden, und
die Möglichkeit, wirtschaftliche Entscheidungen frei zu treffen, Verträge einzugehen und Eigentum zu besitzen.
In einer freien Gesellschaft gibt es keinen höheren Wert als den der Freiheit. Alle Versuche, den Begriff der Freiheit in irgendeiner Weise zu instrumentalisieren, sind Anmaßungen.
Freiheit ist Freiheit – und nicht …
Gleichheit,
Fairness,
Gerechtigkeit,
menschliches Glück,
gutes Gewissen.
Die oben genannten Begriffe werden oft mit Freiheit verwechselt. Und übrigens: Auch der Zeitgeist kann der Freiheit nichts anhaben. Freiheit ist zeitlos. Die Freiheit des Einzelnen muss dort enden, wo die Freiheit des anderen beginnt. Wer durch sein Handeln die Trennlinie zwischen seiner Freiheit und der Freiheit des anderen überschreitet, muss in einem Rechtsstaat mit Konsequenzen rechnen.
Freiheit geht grundsätzlich von der Freiheit des Individuums aus. Dies setzt wiederum gegenseitiges Vertrauen darauf voraus, dass der jeweils andere fähig ist, sich seines Verstandes und seiner gedanklichen Freiheit so zu bedienen, dass daraus etwas Positives entsteht. Dazu bedarf es des Mutes. Ein Mensch, der nicht gelernt hat, von seiner Gedankenfreiheit Gebrauch zu machen, ist nie wirklich frei, für sich selbst zu entscheiden. Freiheit setzt voraus, dass man sich aus eigenen Stücken für seine Unabhängigkeit entscheidet. Alles andere ist Sklaverei. Keine wie auch immer zusammengesetzte „Mehrheit“ kann Freiheit ersetzen.
Mein Standpunkt
Freiheit ist Freiheit. Den Freiheitsbegriff zu verbiegen, um immer weitere staatliche Maßnahmen zu rechtfertigen, empfinde ich als irrwitzig.
Freiheit bedeutet für mich …
Mündigkeit,
Eigenverantwortung,
Offenheit und
Selbstbestimmung.
Ich empfinde es als fantastisch, von niemandem abhängig zu sein, niemandes Willkür zu unterliegen, von niemandem bevormundet zu werden und Entscheidungen für mich selbst, nach meinen Vorstellungen treffen zu können. Meine Freiheit bedeutet für mich allerdings auch, die Freiheit des anderen zu achten, sie unbedingt zu respektieren. Das sollten sich übrigens einige der derzeit Demonstrierenden zu Herzen nehmen.
Gerechtigkeit
Viele Politiker fordern Gerechtigkeit für alle Bürger. Alles soll gerecht zugehen und gerecht verteilt werden. Aber was ist Gerechtigkeit eigentlich? Behandeln Sie andere immer gerecht?
Gerechtigkeit bezeichnet eine menschliche Tugend und einen Maßstab für individuelles Verhalten im sozialen Zusammenleben. Die Grundbedingung für Gerechtigkeit ist, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird. In einem Rechtsstaat ist Gerechtigkeit das oberste Ziel, das durch die Verfassung und Gesetze gewährleistet werden soll. Allerdings ist die Frage „Was ist gerecht?“ oft nicht einfach zu beantworten, da unterschiedliche Ansichten und Interessenkonflikte bestehen. Gerechtigkeit ist ein Grundwert, aber ihre konkrete Umsetzung und Auslegung ist häufig umstritten.
Man kann Gerechtigkeit in soziale und individuelle Gerechtigkeit einteilen. Soziale Gerechtigkeit bezieht sich auf die Verteilung von Gütern, Chancen und Lasten in der Gesellschaft. Die individuelle Gerechtigkeit zielt auf die faire Behandlung des Einzelnen in zwischenmenschlichen Beziehungen ab und beinhaltet Prinzipien wie Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit von Leistung und Gegenleistung oder etwa Strafgerechtigkeit. Während soziale Gerechtigkeit die gerechte Gestaltung der Gesellschaft als Ganzes anstrebt, konzentriert sich individuelle Gerechtigkeit auf die faire Behandlung des Einzelnen in konkreten Situationen.
Der Philosoph Immanuel Kant hat aus der Position der Aufklärung heraus seine Vernunftethik formuliert. Eine göttliche oder naturgegebene Gerechtigkeit seien keine vernünftigen Kategorien, so Kant, weil beide für den Menschen grundsätzlich nicht oder jedenfalls nicht vollständig erkennbar seien. Gerecht handelt nach seinem kategorischen Imperativ derjenige Mensch, der sich über die Maximen seines Handelns unter „Anspannung seiner Geisteskräfte“ Rechenschaft ablegt und entsprechend handelt, sofern diese Maximen seines Handelns auch zum allgemeinen Gesetz erhoben werden könnten.
Der kategorische Imperativ ist für Immanuel Kant das grundlegende Prinzip der Moralphilosophie und ethischer Handlungsmaximen. Er lautet in seiner bekanntesten Formulierung: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“
Mein Standpunkt
Ich habe meine Probleme mit dem Begriff „Gerechtigkeit“. Er wird zu oft als Instrument der Gleichmacherei missbraucht. Eine gerechte, das Glück aller gewährleistende Ordnung kann es meines Erachtens nicht geben. Glück ist nämlich das subjektive Gefühl für das, was ein jeder von uns darunter versteht. Und damit ist es unvermeidlich, dass das Glück des einen mit dem Glück des anderen in Konflikt gerät. Denken Sie einmal daran, wie unterschiedlich Glück in verschiedenen Regionen der Erde, etwa einerseits in der Sahelzone Afrikas und andererseits in Deutschland, empfunden wird. Während man dort das tägliche Essen und Trinken als Glück ansieht, ist dies hierzulande, wo viele Menschen im Überfluss leben, nichts Besonderes. In Deutschland bedeutet Glück vielleicht den Sechser im Lotto – mit Zusatzzahl.
Gerechtigkeit ist nach klassischer Auffassung zwar ein Maßstab für ein individuelles menschliches Verhalten, bezeichnet aber diejenigen Ansichten, die von einem Einzelnen als gerecht angesehen werden. Wie Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird, wird davon abhängen, nach welchen Wertmaßstäben zwei Einzelfälle als zueinander gleich oder ungleich zu gelten haben.
Der kategorische Imperativ erscheint mir als sinnvoller Ansatz für die Definition der Gerechtigkeit: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Um zu prüfen, ob eine Maxime dem kategorischen Imperativ entspricht, muss man sich fragen: Was wäre, wenn jeder nach dieser Maxime handeln würde? Der kategorische Imperativ dient als Richtschnur und sollte für uns das oberste Prinzip sein.
Haltung
Haltung zeigen bedeutet, dass man zu seinen Überzeugungen, Werten und Prinzipien steht und diese konsequent nach außen vertritt. Zeigen Sie Haltung? In welchen Situationen?
Es geht insbesondere darum, nicht nur eine eigene Meinung zu haben, sondern zudem eine innere Festigkeit und Standhaftigkeit zu entwickeln, die das eigene Handeln leitet, also auch nach außen wirkt.
Eine Person, die Haltung besitzt, zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
Sie lässt sich nicht mehr von äußeren Umständen und Emotionen treiben, sondern bleibt ihrer inneren Haltung treu.
Sie überdenkt die eigenen Überzeugungen immer wieder und passt sie gegebenenfalls Veränderungen an, um flexibel zu bleiben.
Auch bei diesem Thema ist die Bereitschaft wichtig, die Haltung anderer zu akzeptieren und, wo notwendig, Kompromisse einzugehen. Es ist nicht immer möglich, seine eigene Meinung durchzusetzen. Aber man muss seine Haltung dafür nicht ändern, sondern kann klar kommunizieren, dass man eine andere Auffassung hat.
Mein Standpunkt
Ich wünsche jedem Menschen, dass er auf der Basis seines Verstandes eigene Überzeugungen, Werte und Prinzipien entwickelt und diese mit der gebotenen Toleranz gegenüber Andersdenkenden lebt und vertritt. Er sollte anderen gegenüber tolerant sein und die Fähigkeit besitzen, auf Rechthaberei zu verzichten und mit Kompromissen leben zu können.
Man könnte sich an Winston Churchill orientieren, der einem politischen Widersacher einst entgegnete, dass er dezidiert nicht seiner Meinung sei, aber immer dafür eintreten werde, dass dieser seine Meinung äußern dürfe. Hart in der Sache, aber fair im Umgang miteinander. Eben Haltung zeigen.
Leitkultur
Der Begriff Leitkultur wird in politischen Debatten häufig verwendet, um die grundlegenden Werte, Normen und Traditionen zu beschreiben, die eine Gesellschaft prägen und ihr Zusammenleben organisieren. Was verstehen Sie darunter?
Mit Thüringer Bratwürsten oder Schwarzwälder Schinken, wie manche Menschen hierzulande – auch manche Politiker – meinen, hat der Begriff rein gar nichts zu tun. In Deutschland wird die Diskussion um die Leitkultur oft im Zusammenhang mit Integration und dem Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft geführt.
Der Begriff Leitkultur wurde in den 1990er-Jahren von dem Politologen Bassam Tibi in die politikwissenschaftliche Debatte eingeführt. Er beschrieb damit einen auf deutschen und europäischen Werten basierenden gesellschaftlichen Konsens, der als Klammer zwischen Deutschen und Migranten dienen soll. Das zentrale Argument in der Debatte um Leitkultur ist die Frage, wie Integration gelingen kann.
Welche Werte sollen unsere Leitkultur bestimmen?
Tibis Werte für diese Leitkultur entspringen der kulturellen Moderne:
Demokratie,
Laizismus,
Aufklärung,
Menschenrechte und
Zivilgesellschaft.
Nach Tibi muss diesen Werten im öffentlichen Raum der Vorrang vor religiösen Normen, wie sie beispielsweise der Islam verlangt, eingeräumt werden.
Die Notwendigkeit einer Leitkultur in Deutschland wird damit begründet, dass Identität durch Ethnizität, also durch individuell empfundene Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe, definiert ist und dass Deutschland als Kulturnation Einwanderern per se keine Identität bieten kann. Wenn die Deutschen die Einwanderer in ihre Kulturnation integrieren wollten, müssten sie eine Leitkultur definieren: „Zu jeder Identität gehört eine Leitkultur“, stellte Tibi fest. Leitkultur im Sinne eines Wertekonsenses sei als eine Klammer zwischen Deutschen und Migranten unerlässlich. „Eigentlich bedeutet Leitkultur nichts anderes als eine Hausordnung für Menschen aus verschiedenen Kulturen in einem werteorientierten Gemeinwesen“, so der Politikwissenschaftler weiter.
Zu den Werten:
Der Begriff Demokratie stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Volksherrschaft“. Er bezeichnet eine Staatsverfassung, in der die Herrschaft bzw. die Machtausübung auf der Grundlage politischer Freiheit und Gleichheit sowie weitreichender politischer Beteiligungsrechte erwachsener Staatsbürger erfolgt. Das Volk ist also der staatliche Souverän, und die politischen Entscheidungen werden durch den Mehrheitswillen der Bevölkerung gefällt. Konkret bedeutet das die Ablösbarkeit der Regierung, ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung, die Unabhängigkeit der Gerichte, den Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und die Garantie der im Grundgesetz festgelegten Menschenrechte.
Der Begriff Laizismus bezeichnet die Trennung von Religion und Staat. In einem laizistischen Staat wird religiöse Neutralität gewahrt, und religiöse Institutionen haben keinen direkten Einfluss auf staatliche Entscheidungen. Laizismus sichert die Freiheit jeder Religion und von jeder Religion. Er stellt sicher, dass der Staat und seine Institutionen unabhängig von religiösen Überzeugungen agieren und dass Religion ausschließlich Privatangelegenheit ist. Daraus folgt, dass Religion nicht nur keine staatliche, sondern auch keine öffentliche Funktion hat. In einem laizistischen Verständnis sollte Bildung neutral sein. Schulen und andere Bildungseinrichtungen sollten Wissen vermitteln, ohne religiöse Dogmen zu propagieren. In Konsequenz darf es keine staatliche Finanzierung von Religionsgemeinschaften und keinen einseitigen, zum Beispiel nur christlichen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen geben. Die Regierung darf sich mit keiner Religion identifizieren und muss strikt neutral bleiben.
Das derzeitige kooperative Trennungsmodell von Kirche und Staat in Deutschland kennt hingegen kein striktes Trennungsgebot, sondern ein „getrenntes Miteinander“ von Staat und Kirchen. Der Staat ist zwar weltanschaulich neutral, fördert aber Religionsgemeinschaften in gewissem Rahmen, da sie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen – Stichwort „fördernde Neutralität“. Es gibt Staatsleistungen an die Kirchen, Religionsunterricht an Schulen und die Möglichkeit des Körperschaftsstatus für Religionsgemeinschaften.
Das Wort Aufklärung bezeichnet eine Denkrichtung und Epoche des 18. Jahrhunderts. Sie erklärte die Vernunft zum Maßstab des Handelns und begriff den Menschen als unabhängiges und selbstständiges Individuum. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit waren wichtige Ideale dieser Zeit.
Als Menschenrechte werden individuelle Freiheits- und Autonomierechte bezeichnet, die jedem Menschen allein aufgrund seines Menschseins gleichermaßen zustehen. Sie sind universell, gelten also überall für alle Menschen, sind unveräußerlich, können also nicht abgetreten werden, und unteilbar, sie können demnach nur in ihrer Gesamtheit verwirklicht werden. Sie umfassen dabei bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechtsansprüche.
Unter Zivilgesellschaft versteht man einen gesellschaftlichen Bereich, in dem Bürger freiwillig und selbst organisiert für das Gemeinwohl aktiv werden, unabhängig von Staat und Wirtschaft. Kennzeichnend sind: bürgerschaftliches Engagement in Form von Vereinen, Initiativen, Stiftungen etc., der Einsatz für gemeinnützige Zwecke und das Allgemeinwohl, Selbstorganisation und Unabhängigkeit von staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren sowie die Förderung von Werten wie Demokratie, Menschenrechten, Pluralismus und Gewaltfreiheit. Zivilgesellschaftliches Handeln basiert auf Prinzipien wie Mitgefühl, Verständnis, Respekt und dem Recht auf freie Gedanken, Ideen und Vorstellungen. Es dient der politischen Mitgestaltung im Sinne einer kritischen Öffentlichkeit.
Kritiker des Leitkulturkonzeptes warnen davor, dass es zu Ausgrenzung und Diskriminierung führen kann. Sie argumentieren, dass der Begriff oft dazu benutzt wird, um kulturelle Homogenität zu fördern und Unterschiede als nebensächlich darzustellen. Ein inklusives Verständnis, also ein auf Gleichberechtigung beruhendes Verständnis, sollte ihrer Meinung nach die Vielfalt und den gegenseitigen Respekt betonen, anstatt auf die Anpassung an die vorherrschende Kultur zu drängen. Ein pluralistischer Ansatz zur Integration betont, dass es nicht eine einzige, feste Leitkultur geben sollte, sondern dass eine Gesellschaft durch die Vielfalt ihrer Kulturen und Perspektiven bereichert wird. Integration wird als wechselseitiger Prozess verstanden, bei dem sowohl die Einwanderer als auch die Aufnahmegesellschaft lernen und sich anpassen müssen.
Mein Standpunkt
Letztlich geht es darum, eine Balance zu finden zwischen dem Schutz und der Förderung gemeinsamer Werte, die für ein friedliches Zusammenleben notwendig sind, und der Wertschätzung und Integration kultureller Vielfalt.
Die Zahl der Einwanderer steigt ständig. Deshalb braucht Deutschland einen Maßstab, eine Hausordnung, die von allen akzeptiert wird. Ein ausschließlicher Bezug auf unsere vor allem von den Traditionen des christlichen Abendlandes geprägte Kultur ist dazu nicht geeignet.
Asylanten, Flüchtlinge und auf Einladung zu uns kommende Menschen, die anderen Kulturkreisen entstammen, müssen sich einerseits in Deutschland wohlfühlen können. Andererseits müssen sie unsere Hausordnung anerkennen, und unser Rechtsstaat muss dafür Sorge tragen, dass dies auch geschieht. Damit verbunden ist zwangsweise ein Wertewandel vom christlich geprägten Abendland zu einem multikulturellen Staat, der allen Einwohnern die Möglichkeit gibt, sich mit ihm zu identifizieren. Keine Religion darf gegenüber einer anderen bevorzugt werden. Nur so ist eine Integration mit den Werten unserer Leitkultur möglich.
Wenn wir keine türkisch-arabisch-islamischen Subkulturen in Deutschland wünschen, besteht staatlicher Handlungsbedarf. Nur auf diese Weise lässt sich die staatliche Ordnung und Sicherheit aufrechterhalten.
Nachhaltigkeit
Es handelt sich schon fast um ein Modewort: Nachhaltigkeit. Sie ist das neue Leitprinzip für viele Bereiche unseres Lebens. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Thema?
Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts. Er beschrieb damals das Prinzip, nur so viel Holz zu schlagen, wie nachwachsen kann. Heute hat sich die Bedeutung erweitert und umfasst verschiedene Bereiche unseres Lebens und der Gesellschaft.
Wir nutzen das Wort bei der Forderung nach Entwicklung nachhaltiger Strategien und Gesetze, der sogenannten Corporate Social Responsibility (CSR). Der Begriff bezieht sich auch auf die Forderung nach nachhaltiger Unternehmensführung, nach bewusstem Konsum und nachhaltigen Lebensstilen sowie nach der Entwicklung umweltfreundlicher und ressourcenschonender Innovationen.
Nachhaltigkeit lässt sich definieren als die verantwortungsbewusste Nutzung von Ressourcen, um die Bedürfnisse der heutigen Generation zu erfüllen, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.
Kernaspekte der Nachhaltigkeit sind:
Schutz und Erhalt natürlicher Ressourcen,
Reduzierung von Umweltverschmutzung und Treibhausgasemissionen,
Förderung der Biodiversität,
langfristig orientiertes Wirtschaften,
effiziente Nutzung von Ressourcen,
Förderung von Innovation und nachhaltigen Geschäftsmodellen,
Gewährleistung von Chancengleichheit,
Verbesserung der Lebensqualität für alle Menschen sowie die
Förderung von Bildung und Gesundheit.
Nachhaltigkeit spielt heute eine zentrale Rolle in der Entwicklung politischer Strategien und gesellschaftlicher Normen. Sie ist Thema internationaler Abkommen wie des „Pariser Klimaabkommens“ und der „Agenda 2030“ der Vereinten Nationen mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. Unternehmen integrieren Nachhaltigkeit in ihre Geschäftspraktiken durch „Corporate Social Responsibility“ und nachhaltiges Lieferkettenmanagement, um langfristige Gewinne und positive Umweltauswirkungen zu gewährleisten.
Alle Menschen können durch bewusste Entscheidungen im Alltag wie Recycling, Energieeinsparung und nachhaltigen Konsum zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Fazit: Nachhaltigkeit ist ein umfassendes Konzept, das ökologische, ökonomische und soziale Dimensionen vereint. Es zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen menschlichen Aktivitäten und der Natur zu schaffen, um ein langfristig gesundes und gerechtes Leben für alle zu ermöglichen. Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Mein Standpunkt
Nachhaltigkeit ist zu Recht ein wichtiger Aspekt unseres Lebens. Wir müssen zum Erhalt der Lebensqualität zukünftiger Generationen verantwortungsvoll und zukunftsorientiert handeln. Die Umsetzung von Nachhaltigkeit stellt uns vor große Herausforderungen, bietet aber auch Chancen für eine bessere Zukunft. Sie erfordert ein Umdenken in vielen Bereichen unseres Lebens und unserer Gesellschaft, kann aber langfristig zu einer gerechteren, gesünderen und stabileren Welt führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nachhaltigkeit ein ganzheitliches Konzept ist, das darauf abzielt, ökologische, ökonomische und soziale Aspekte in Einklang zu bringen, um eine lebenswerte Zukunft für alle zu gestalten. Wir haben keine Alternative – wenn nur die Umsetzung nicht so schwierig wäre!
Selbstbestimmung und Egoismus
Egoismus kann auch „gesund“ sein, meine ich. Und zwar dann, wenn er bewirkt, dass man selbstbestimmt leben kann und nicht in Abhängigkeit gerät. Möchten Sie selbstbestimmt leben oder sich von anderen reglementieren lassen?
Selbstbestimmung ist eine Form von gesundem Egoismus, bei der man an sich selbst glaubt und seine Ziele verfolgt. Diese Auffassung bedeutet, das eigene Leben nach den eigenen Wünschen und Überzeugungen zu gestalten, ohne dabei anderen zu schaden. Egoismus wird in unserer Gesellschaft fast immer als ein negativer Begriff verstanden. Der Duden beschreibt Egoismus als „Selbstsucht“, „Ich-Sucht“ und „Eigenliebe“. Ein Egoist strebe demnach nach Vorteilen für sich selbst, ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Solidarität und Einfühlungsvermögen, so heißt es, seien Egoisten fremd.
Egoismus wird abwertend als Synonym für rücksichtsloses Verhalten verwendet und als unanständig beurteilt. Der Begriff beschreibt demzufolge die Haltung einer Person, die ausschließlich persönliche Interessen verfolgt und dabei keine Rücksicht auf die Belange anderer nimmt – im schlimmsten Fall sogar auf Kosten anderer handelt. Orthodoxe Moralvorstellungen vermitteln uns, dass die „moralistischste“ Handlung stets die am wenigsten egoistische ist. Anders gesagt: Die meisten von uns denken, dass gute Men-schen immer selbstlos handeln, während schlechte Menschen nur eigennützige Zwecke verfolgen. Das ist der allgemeine Grundtenor in unserer Gesellschaft.
Mein Standpunkt
Ich halte diese Betrachtungsweise für grundlegend falsch. Mein Verständnis von Egoismus ist ein völlig anderes. Denn die geschilderten Moralvorstellungen ignorieren die natürliche Verpflichtung eines jeden Menschen, zunächst auf seine eigenen Interessen zu achten. Ich bin der Meinung, dass es nicht meine Aufgabe ist, andere Menschen glücklich und zufrieden zu machen. Umgekehrt erwarte ich von meinen Mitmenschen nicht, dass sie mich glücklich und zufrieden machen. Ich möchte nur selbstbestimmt leben und mich nicht bevormunden lassen – vor allem nicht von jungen Politikern, die keine Lebenserfahrung haben. Nach meiner Auffassung hat jeder Einzelne die Verantwortung, für sein Wohl selbst zu sorgen. Ich möchte nicht auf Kosten anderer leben, auch nicht auf Kosten des Staates, denn das sind letztlich wir alle. Ebenso wenig möchte ich von anderen abhängig sein, da ich das für unmoralisch halte. Ich befürworte die beschriebene Art eines „gesunden“ Egoismus. Jeder von uns sollte das Recht haben, selbstbestimmt zu leben – selbstverständlich mit Rücksicht auf andere. Mein Rat lautet: Auch Sie sollten so denken.
Kapitel 2: Politik
Asylpolitik
Seit 2015 kommen viele Asylsuchende nach Deutschland. Das hat zu großen Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung geführt, da diese Menschen zumeist aus anderen Kulturkreisen stammen, deren Sitten und Bräuche uns fremd sind. Sind Sie für oder gegen die Aufnahme von Asylanten? Sollten wir unsere Grenzen schließen?
Unter Asyl versteht man einen Zufluchtsort, der vor äußeren Gefahren schützen soll. Nach Artikel 16a unseres Grundgesetzes bietet Deutschland Menschen, die Asyl suchen, Schutz vor Gefahr und Verfolgung durch eine vorübergehende Aufnahme. Die zentrale Voraussetzung für die Gewährung von Asyl ist, dass der Antragsteller sein Herkunftsland aus begründeter Furcht vor politischer Verfolgung verlassen hat, weil eine ernsthafte persönliche Bedrohung vorliegt.
Politische Verfolgung liegt vor, wenn der Staat selbst oder von ihm geduldete nicht staatliche Akteure die Person aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe verfolgen und ihre Grundrechte und Menschenrechte massiv verletzen. Allein die allgemeine Benachteiligung oder Unterdrückung reicht nicht aus. Unter Verletzung der Grund- und Menschenrechte sowie persönliche Bedrohung fallen eine zu befürchtende Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter, unmenschliche bzw. erniedrigende Behandlung oder Bestrafung und willkürliche Gewalt im Rahmen eines bewaffneten Konflikts.
Eine weitere gesetzliche Voraussetzung für ein Asyl in Deutschland ist, dass für den Antragsteller keine inländische Fluchtalternative in einen anderen Teil des Herkunftsstaates besteht, wo er vor Verfolgung sicher wäre. Der Asylsuchende darf darüber hinaus nicht über einen sicheren Drittstaat einreisen, in dem er bereits Schutz vor Verfolgung hätte finden können – und derzeit sind alle an Deutschland grenzenden Staaten sichere Drittstaaten. Außerdem darf es keine Ausschlussgründe für das Asyl geben wie schwere Straftaten oder die Gefährdung der inneren Sicherheit Deutschlands.





























