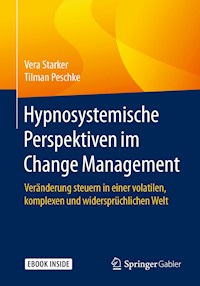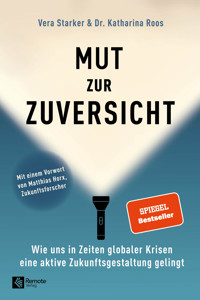
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Remote Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie Sie in unsicheren Zeiten mit Zuversicht den Krisenmodus überwinden können Krisen, wohin man schaut – ist Zuversicht überhaupt noch möglich und erlaubt? Unbedingt sogar! Vera Starker und Katharina Roos kombinierenin "Mut zur Zuversicht" wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse mit konkreten Beispielen und praktischen Ansätzen, um in Krisenzeiten Zuversicht zu entwickeln, gelassener zu werden und sich auf das Positive und Machbare zu fokussieren. Auf ebenso einfühlsame wie humorvolle Weise bieten sie eine ganzheitliche Perspektive auf die Krisen unserer Zeit und Lösungswege, um mit diesen umzugehen. Dieses Buch liefert hilfreiche Ansätze, wie wir ins Handeln kommen können. - Finden Sie Kraft und Mut, um Zuversicht zu entwickeln. - Werden Sie aktiv, um Gefühle von Ohnmacht zu reduzieren. - Bauen Sie einen Schutz gegen Negativität auf. - Gestalten Sie Ihren Weg für eine bessere Zukunft."Dieses wunderbare Buch versucht aufzuklären. Über die Zukunft IN uns. Um die Zukunft (wieder) zu spüren, müssen wir lernen, uns selbst 'inwendig' zu verstehen." Matthias Horx, Zukunftsforscher "Ein wunderbar kluges Buch zu der für uns alle so entscheidenden Frage, wie wir nicht verzagen im Angesicht der vielfältigen Krisen, für deren Bewältigung unser aller Engagement unerlässlich ist." Patricia Döhle, Brandeins
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Haftungsausschluss:
Die Ratschläge im Buch sind sorgfältig erwogen und geprüft. Alle Angaben in diesem Buch erfolgen ohne jegliche Gewährleistung oder Garantie seitens der Autorinnen und des Verlags. Die Umsetzung erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko. Eine Haftung der Autorinnen bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden oder sonstige Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, ist ausgeschlossen. Verlag und Autorinnen übernehmen keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und ebenso nicht für Druckfehler. Es kann keine juristische Verantwortung und keine Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstehende Folgen vom Verlag bzw. von den Autorinnen übernommen werden.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
1. Auflage 2024
© 2024 by Remote Verlag, ein Imprint der Remote Life LLC, Powerline Rd., Suite 301-C
33309 Fort Lauderdale, Fl., USA
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Projektmanagement: Tatjana Helmke
Lektorat und Korrektorat: Susanne Schulten, Luise Hartung
Umschlaggestaltung: Verena Klöpper
Satz und Layout: Julia Krämer
Illustrationen und Grafiken: Julia Krämer
Abbildungen im Innenteil: © Vera Starker
ISBN Print: (Taschenbuch) 978-1-960004-31-4
ISBN E-Book: 978-1-960004-32-1
www.remote-verlag.de
Für unsere Kinder
An die Zu-versichtigen – ein Vorwort
Ist Ihnen in der letzten Zeit öfter in den Sinn gekommen, dass es keinen Zweck mehr hat, mit der Zukunft und überhaupt? Geht dieser Gedanke, dass alles zu spät, der Zug der Menschheit bereits abgefahren ist, einfach nicht weg? Dann willkommen im Club der »Doomer«. Derjenigen, die die Welt verloren geben. Die gern Doomsaying betreiben – eine Prognostik des Untergangs, die sich gern wissend, überlegen gibt. Haben wir es nicht immer schon gewusst, dass es mit der blöden Menschheit nicht gut gehen kann?
Nach einer breit angelegten Umfrage in 18 Ländern glauben 56 Prozent der 16- bis 25-Jährigen daran, dass die Welt, die Menschheit nicht mehr zu retten ist …
Aus der Sicht der systemischen Zukunftsforschung ist das keineswegs ein neues Phänomen. Es gab immer schon Zeiten, Epochen der Turbulenz, der Verwirrung und Verirrung, in der das Alte nicht aufhören wollte und das Neue noch nicht wirklich begann. Wir kennen solche Übergangsperioden auch aus unserem privaten Leben, aus persönlichen Krisen, Trennungen, Altwerden, Pubertät. Jedes Mal befällt uns die Idee, dass es sich um das Ende handelt, obwohl es doch nur ein Übergang ist, der dringend bevorsteht. Die Angst vor dem Ende ist anthropologisch in uns eingebaut und sie beeinflusst unsere Wahrnehmungen im Sinne eines Cognitive Bias, einer Wirklichkeitsverzerrung. Das liegt einerseits daran, dass wir heute in einem verrückten Medien-Universum leben, das nur noch auf Reize und Verängstigungen setzt – bleiben Sie dran, liebe Zuschauer, nach dem Werbeblock geht’s weiter mit dem Untergang! Andererseits hat es etwas damit zu tun, dass sich unsere Urvorfahren in Gefahrenangelegenheiten keinen Irrtum erlauben durften. Es war immer besser, einen Stock mit einer Schlange zu verwechseln, als umgekehrt eine Schlange für einen Stock zu halten.
Dieses wunderbare Buch versucht aufzuklären. Über die Zukunft IN uns. Um die Zukunft (wieder) zu spüren, müssen wir lernen, uns selbst »inwendig« zu verstehen. Wie Ängste in uns entstehen, wachsen, wuchern, und wie aus Ängsten Fehlhaltungen und -handlungen, Verkrampfungen und Engführungen entstehen. Wo Angst uns nicht mehr anleitet, uns zu wehren oder zu fliehen (was ihre vitale Aufgabe ist), beginnt das Land der Paranoia. Paranoia ist ein sich selbstverstärkendes System, das man politisch-manipulativ hervorragend funktionalisieren kann. Siehe Putin, siehe den bösartigen Populismus, siehe die hysterischen Stürme des Internets. Angst ist in unserer modernen Mediengesellschaft nur allzu oft ein Manipulations-Tool. Man kann sogar, ohne es zu wissen, sich selbst in einen Untergangsschwurbel hineinmanipulieren.
Wir sollten dieses dunkle Spiel, das heute so in Mode gekommen ist, nicht mitspielen. Ein besseres Spiel heißt Zuversicht. Zuversicht ist etwas anderes als Hoffnung. Während Hoffnung sich passiv generiert, im braven Weltvertrauen, in der Geduld des Errettetwerdens, ermöglicht die Zuversicht einen anderen Weltzugang. Zuversicht ist nicht nur eine Haltung, sondern eine aktive Handlungsweise der Welt gegenüber. Das hat mit Apfelbäumchen zu tun, die man pflanzen kann. Aber auch mit Träumen, die man schrittweise verwirklicht, indem man nicht aufgibt und das Kleine im Großen nicht verachtet. Mit der Zuversicht nehmen wir uns selbst in die Verantwortung. Sie beinhaltet das Liebevolle, das Zugeneigte, aber auch das Trotzige und Rebellische, das sich nicht kleinkriegen lässt. Zur Zuversicht gehört auch eine gewisse Resistenz oder gar RENItenz gegen die ewigen Pessimisten. Sagen wir es ein bisschen provokativ mit dem Wandlungsforscher Kets de Vries: »Pessimisten benutzen andere als Mülleimer. Die Nörgler erleichtert das, alle anderen erschöpft es.«
Matthias Horx, März 2024
Inhalt
An die Zu-versichtigen – ein Vorwort
Die Sache mit der Taschenlampe – eine Einleitung
Willkommen in der Geisterbahn – have a scary trip!
Der Wahnsinn hat System
Wer ist eigentlich Walter?
Sie dürfen aussteigen
Die rosarote Brille – oder was Zuversicht eigentlich ist …
Et hätt noch immer jot jejange
Zuversicht ist ein Tun!
Unser seelisches Immunsystem
Gerade war die Welt noch in Ordnung – die Sehnsucht nach früherer Stabilität
Die Welt scheint außer Rand und Band zu sein
Sehnsucht nach gestern: Nostalgie als Anker?
Das Morgen braucht genau Sie!
Zuversicht und Angst – wie passt das zusammen?
Kein Wunder, dass wir uns gruseln
Angst kann was – auf die Menge kommt es an
Zuversicht braucht Mut
Stress runter, Zuversicht rauf!
Der 14-Stunden-Tag
Handy & Co. – unsere besten Freunde
Arbeit als ein guter Ort?
Hass ist infektiös – wie Zuversicht einen Schutzschild bildet
Hass ist kein Geschenk
Die Empörungsspirale – um wen geht es eigentlich?
Großzügig sein
Drama, wohin man schaut – ist Zuversicht überhaupt erlaubt?
Medien – Betreiber der Geisterbahn
Die Dosis macht das Gift
Anteilnahme ist auch ein Tun
Der Weltuntergang naht – ist Zuversicht nicht naiv?
Wer ist hier eigentlich naiv?
Umgang mit dem Unabänderlichen
Jede Aktion zählt!
Zuversicht braucht Kraft – wo investieren wir sie täglich?
Wenn Ihre Kraft eine Währung wäre
Setzen Sie auf das richtige Pferd?
Kluge Investitionsentscheidungen
Die Zuversichtswende braucht es überall Nie zu alt für Zuversicht
Die Familie als Kraftort – Kinder brauchen Zuversicht
Demokratie braucht zuversichtliche Menschen
Ein letzter Blick in die Geisterbahn – warum Zuversicht alternativlos ist
Was passiert, wenn nichts passiert
Das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir zuversichtlich sind
Sich jeden Tag neu für sich entscheiden
Die innere Taschenlampe – Zuversicht ist eine Entscheidung
Zuversicht passiert nicht einfach
Immer wieder der Säbelzahntiger
Wer gibt die Erlaubnis – außer Ihnen?
Zuversicht ist der Treibstoff für positive Veränderung
Unser Gehirn schaut in den Rückspiegel
Wenn es nur dringlich genug ist?
Ein attraktives Zielbild – dann klappt’s auch mit Walter
Über die Autorinnen
Literaturverzeichnis
Online-Quellen
Studien
Anmerkungen
Hilfestellungen
Die Sache mit der Taschenlampe – eine Einleitung
Jeden Tag eine neue Horrormeldung in den Medien. Migrationsdilemma, Corona, Krieg, Hungersnöte, wieder Corona und nicht zuletzt gefühlt ständiger Streit in der Politik. Die Ausnahmezustände nehmen zu und wir erschöpfen angesichts all der belastenden Emotionen. Gefühle der eigenen Hilflosigkeit führen zu Wut und Ärger. Gleichzeitig Klimawandel, Erde erschöpft, apokalyptische Zukunftsszenarien. Den Rest geben uns Fake News, die eine gezielte Empörungsspirale anzetteln, die zu Gefühlen von Ohnmacht führt und uns damit den Sinn für das Wesentliche versperrt.
Warum setzen wir uns dem eigentlich täglich aus? Das ist eine gute Frage. Nun, zum einen hat unser Gehirn mehr Rezeptoren für kritische als für gute Nachrichten. »Wir alle tragen den sogenannten Negativity Bias in uns, also einen Fokus auf negative Inhalte. Wir speichern negative Informationen und potenzielle Gefahren nicht nur besser ab und reagieren intensiver auf sie, sondern suchen auch mehr danach«, so die Neurowissenschaftlerin Prof. Dr. Maren Urner. »Negatives verarbeiten wir besser, schneller und intensiver als Positives oder Neutrales. Aus evolutionspsychologischer Perspektive ist der Negativity Bias sinnvoll und ein Überlebensvorteil.«1
Das bedeutet: Der Normalmodus unseres Gehirns ist darauf ausgerichtet, vor allem Negatives zu bemerken, um uns zu schützen. Klingt logisch. Denn wer sich damals unvermittelt einem Säbelzahntiger gegenübersah und in diesem Moment trotzdem eine schöne Blume am Wegesrand interessanter fand als das gefährliche Raubtier, gehörte nicht länger – zumindest evolutionsgeschichtlich betrachtet – zum Club der Sieger. So gesehen ergibt es Sinn, wenn Ihr Gehirn auf tatsächlich oder vermeintlich Gefährliches fokussiert.
Wir sind dieser Fokussierung allerdings nicht ausgeliefert. Wir können unseren Fokus, also unsere Aufmerksamkeit, mit einem Scheinwerfer vergleichen oder noch besser, mit einer Art innerer Taschenlampe, deren Lichtstrahl wir jederzeit in die Richtung lenken können, auf die wir uns konzentrieren wollen.
Haben Sie schon einmal einen Stromausfall erlebt? Oder waren Sie abends noch nach dem Einbruch der Nacht im Wald unterwegs? Und alles um Sie herum war dunkel? Sie haben Ihre Taschenlampe eingeschaltet und hin und her bewegt und nur das gesehen, was vom Lichtkegel erfasst wurde, richtig? Alles jenseits des Lichtkegels haben Sie, wenn überhaupt, nur schemenhaft erkennen können. Auf diese Weise entsteht ein Fokus auf das, was Sie mit Ihrer Lampe anleuchten, und alles andere bleibt im Dunkeln und damit unentdeckt. Wenn wir jedoch mit unserer inneren Taschenlampe nur das Negative beleuchten, weil unser Gehirn uns durch diesen Fokus eigentlich schützen will, nimmt das Negative in unserem Denken überhand, und wir landen schließlich in einer regelrechten Negativspirale, weil das Positive und Gelingende gar nicht mehr im Lichtkegel erscheint – damit zunehmend unserer Wahrnehmung entgeht und in der Folge als irrelevant eingestuft wird.
Wir registrieren nur noch die Ungerechtigkeiten, denen wir uns ausgesetzt fühlen, und alles das, was nicht so zu funktionieren scheint, wie wir es gern hätten. Wir ärgern uns am laufenden Band – egal, ob uns morgens der Bus im strömenden Regen vor der Nase wegfährt, der Kollege uns in der Büroküche schon wieder zuvorgekommen ist und unsere Lieblingstasse genommen hat oder die Regierung mal wieder etwas nicht hinbekommt. Die großen Krisen wie Klimawandel, Hungersnöte und Kriege gehen uns nicht aus dem Kopf und ängstigen uns zunehmend. Erst recht seit der Corona-Pandemie mit ihren vielen Hiobsbotschaften verfügt unser Gehirn über einen hervorragend trainierten negativen Fokus, der uns mehr und mehr auf die nächste schlechte Nachricht warten lässt. Denn es arbeitet nach einer einfachen Formel: Wenn wir etwas mehrfach erleben, dann neigen wir unbewusst dazu, es auch künftig zu erwarten, nach weiteren Wiederholungen suchen wir sogar die bestätigenden Signale für unsere Erwartungen – und unsere Wahrnehmung verengt sich dementsprechend immer mehr. Tatsächlich schüttet das Gehirn sogar Dopamin, einen Neugierde und Glücksempfinden vermittelnden Botenstoff aus, wenn wir etwas Schlechtes erwarten und dieses Schlechte dann auch wirklich eintritt … einfach, weil wir mit unserer Vorhersage richtig lagen. Eine negative Erwartung wird also mit einem angenehmen Gefühl belohnt. Sie merken, unser Gehirn hat eine sehr eigene Logik!
Irgendwann unterscheiden wir dann auch nicht mehr zwischen kleinen Ärgernissen, wirklichen Problemen und echten Krisen – wir werden Teil einer um sich greifenden Empörungskultur, die aber eben nicht ins Handeln kommt, so wie es der ehemalige französische Widerstandskämpfer und UN-Diplomat Stéphane Hessel in seinem 2010 veröffentlichten Essay Empört Euch! (Originaltitel: Indignez-vous!) verstanden wissen wollte. Seine Abhandlung wurde allein bis Februar 2011 mehr als eine Million Mal verkauft und auch in Deutschland ein Bestseller. Hessel kritisierte in seiner Schrift mit Vehemenz zahlreiche Aspekte gegenwärtiger politischer Entwicklungen und rief zum politischen Widerstand auf. Wenn wir in diesem Buch von Empörung sprechen, dann reden wir, im Unterschied zu Hessel, von dieser nicht handelnden, über Social Media angestachelten untauglichen Empörung, die nichts bewegt, uns lähmt und allein lässt mit den Krisen der Welt und ihren täglichen Schreckensnachrichten. Schauen Sie sich um unter den Menschen, denen Sie im Alltag begegnen – ihre Gesichter sehen häufig gestresst aus. Und überlegen Sie: Wann haben Sie zum letzten Mal jemanden getroffen, der Ihnen auf Ihre Nachfrage geantwortet hat: »Uns geht es total gut und wir genießen jeden Tag.«
In der Welt um uns herum und mittlerweile auch in unseren Köpfen scheinen die Krisen unserer Zeit allgegenwärtig. Ergibt es da überhaupt noch Sinn, auf positive Weise an die Zukunft zu denken? Geschweige denn an sie zu glauben? Oder sollten wir sie im Dienste unserer geistigen Gesundheit nicht besser ausblenden oder sogar leugnen und uns in unsere eigene kleine Welt zurückziehen?
Wir finden: nein. Deswegen haben wir dieses Buch über Zuversicht geschrieben. Über Zuversicht in unsicheren Zeiten, wenn man es genau nimmt. Es ist zwar eine tägliche Herausforderung und erfordert eine ordentliche Portion Mut, trotz all der Krisen zuversichtlich zu bleiben, aber wir werden hier anhand vieler Beispiele aufzeigen, dass Zuversicht in diesen Zeiten nicht nur möglich, sondern auch – als wirksamer Schutz für unser seelisches Immunsystem – absolut notwendig ist, damit wir handlungsfähig bleiben und auch weiterhin ein gutes Leben führen können.
Wenn wir es schaffen, trotz all der Krisen um uns herum unsere Aufmerksamkeit (wieder) den Dingen zuzuwenden, die wir beeinflussen und die uns gelingen können, dann entsteht anstelle der Negativspirale eine Positivspirale, die uns schützt und Kraft gibt und es uns ermöglicht, Lösungen zu finden für jene Dinge, die wir verändern können. Wir werden sozusagen in die Lage versetzt, unsere geistige Taschenlampe nicht mehr (nur) auf Krisen, sondern auch auf Lösungsmöglichkeiten zu richten. Dieser Aspekt – dass wir selbst etwas tun können, etwas in der Hand haben – ist absolut entscheidend für unsere Fähigkeit, Krisen zu bewältigen. Wir Menschen haben ein Grundbedürfnis, uns wirksam zu fühlen – denn Ohnmacht lähmt uns.
Und so definieren wir hier Zuversicht – wie wir später noch ausführlich darstellen werden – als einen klaren Blick auf unsere Herausforderungen, gepaart mit der Entwicklung und Nutzung von Handlungsmöglichkeiten, und seien sie auch noch so klein. Und dafür müssen wir auf das fokussieren, was wir bewirken und verändern können. Und das ist sehr viel mehr als wir denken!
Wir hoffen, dass Sie beim Lesen Mut schöpfen und in der Folge Ihre Zuversicht sowie die der Menschen in Ihrer Umgebung stärken können. Und hier ist sie wieder, die Sache mit der Taschenlampe. Denn zum Glück haben Sie sie ja in der Hand und können daher jederzeit entscheiden, auf was Sie ihren Lichtstrahl richten wollen – in die Geisterbahn mit all ihren Krisen oder auf das Riesenrad, unsere Möglichkeit zum Perspektivwechsel.
Wie Sie sehen, setzen wir mit unseren Bildern, die wir zur Verdeutlichung unserer Vorgänge im Gehirn nutzen, auf Humor. Denn wie der Zukunftsforscher Matthias Horx so treffend sagte: »Humor ermöglicht uns eine gewisse Distanz zur Welt. Und nur dann kann man klar denken.«
Und genau das wollen wir zusammen mit Ihnen – klar denken. Dafür geben wir Beispiele, wie Sie Ihre innere Taschenlampe nutzen und auf das fokussieren können, was Sie beeinflussen und verändern – und wie Sie dadurch Zuversicht aufbauen können. Zuversichtliche Menschen sind starke Menschen. Sie überstehen Krisen, finden Lösungen für ausweglos erscheinende Situationen und vergessen nicht, dass es eine Zukunft gibt, die diese Mühe lohnt. Unser aller Zukunft.
Willkommen in der Geisterbahn – have a scary trip!
Bestimmt sind Sie schon mal Geisterbahn gefahren. Eventuell sogar mit einer Geisterbahn älteren Jahrgangs. Noch während Sie in der Warteschlange standen, hörten Sie das Anrauschen der Wagenschlange, die – dem fortgeschrittenen Alter der Kirmesattraktion geschuldet – etwas ruckelig um die Ecke bog, einfuhr und schließlich zum Halten kam. Die Bügel hoben sich, und einige ziemlich blasse Menschen stiegen aus den kleinen Wagen. Sie wiederum suchten sich Plätze aus, stiegen ein, und Ihr Adrenalinspiegel stieg bereits an durch Ihre Vorfreude aufs Gruseln. Sie setzten sich, die Bügel klappten herunter – ein untrügliches Signal: Aus dieser Nummer komme ich nicht mehr raus. Die Wagen ruckten an, langsam kam das Ganze ins Rollen, unerbittlich in Richtung des Tunneleingangs, geschmückt mit bunten Fratzen und Totenköpfen – und los ging die Fahrt ins Grauen, untermalt von Gespenstergeheul und hämischem Hexengelächter.
»Eine Geisterbahn dient dem Zweck, ihre Besucher und Fahrgäste gegen ein Eintrittsgeld zu erschrecken«, definiert Wikipedia den Begriff ein wenig lakonisch. 1931 gab es die erste Geisterbahn auf dem Hamburger Dom – eine Sensation. Seit damals fallen die Geisterbahnen auf jeder Kirmes sofort auf, denn sie stechen durch ihre auffällige Aufmachung heraus, und die Menschen bezahlen viel Geld, um sich erschrecken zu lassen und den Stoß des Adrenalins zu spüren.
Die Frage lautet jetzt: Was haben Geisterbahnen in einem Buch über Zuversicht verloren?
Der Wahnsinn hat System
Steig ein und dreh eine Runde mit mir!
Im Leben treffen wir immer wieder auf Menschen, die zwar psychisch gesund sind, sich aber ständig ärgern, übermäßig viel jammern und grundsätzlich jedes Glas für halb leer erklären. Vielleicht werden Sie mittlerweile auch das Gefühl nicht los, dass die Zahl dieser Leute in den letzten vier Jahren zugenommen hat. Diese stets jammernden Menschen ordnen wir hier – ausnahmsweise wollen wir mal in Kategorien denken – der Kategorie eins zu. Dann gibt es die Menschen der Kategorie zwei, diejenigen, die ebenfalls psychisch gesund sind, aber davon profitieren, wenn andere sich ärgern, jammern und Kraft verlieren. Auf letztere Kategorie werden wir hier noch mehrmals zu sprechen kommen. Und schließlich haben wir noch die Kategorie drei, zu der eventuell auch Sie gehören. Das sind nämlich die Menschen, die versuchen, die Leidenden, Jammernden zu trösten und zu stabilisieren, möglichst ohne selbst dabei unterzugehen. Diese Unterteilung ist sehr grob, für das folgende Gedankenspiel aber hilfreich.
Professor Robert Sapolsky von der Universität Stanford konnte nämlich zeigen, dass Menschen, die chronisch jammern (Kategorie eins), negative körperliche Auswirkungen ihres Jammerns erleben. Durch die ständige Wiederholung von schlechten, traurigen, wütenden und ohnmächtigen Gefühlen können, so Sapolskys Studienergebnisse, die Neurotransmitter im Gehirn eine neuronale »Neuverdrahtung« durchlaufen, die negative Gedankenmuster verstärkt. Ein ständiger Kreislauf negativer Gedanken kann sogar Schäden am Hippocampus verursachen, dem wichtigen Teil des Gehirns, der für Problemlösungen und kognitive Funktionen zuständig ist.2 Wir geraten in eine emotionale Höllenspirale, wie es Stefan Kölsch, Professor für Biologische Psychologie, erklärt.3
Geteiltes Leid ist nicht halbes Leid,
sondern doppeltes Leid.
Chronische Nörgler übertragen – teils natürlich unbewusst – ihre negativen Gefühle auf andere, ein Phänomen, das sich projektive Identifikation nennt. Viele Menschen arbeiten sich nämlich daran ab, diese Nörgler zufriedenzustellen und ihnen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen, eine Arbeit, die jedoch oft dem Versuch gleicht, Wasser mittels eines Siebs zu schöpfen. Und das bringt die Helfenden schließlich selbst in Gefahr, weil sie über ihre empathische Begleitung der Nörgler beginnen, ihren Fokus ebenfalls auf das Schlechte zu richten.
Angst, Ärger und Wut lösen Hilflosigkeit aus.
Positive Gefühle hingegen stärken uns und machen uns handlungsfähig.
– Prof. Dr. Maren Urner,
Neurowissenschaftlerin und Autorin
Forschungsergebnisse unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen belegen überdies, wie der Prozess der Aufmerksamkeitsfokussierung – also wohin wir unsere innere Taschenlampe richten – menschliches Erleben mental und physiologisch beeinflusst: Forschende gaben einer Gruppe von Menschen die Aufgabe, aus bestimmten Wörtern einen Satz zu bilden. Dann sollten sie für eine zweite Aufgabe in einen anderen Raum am Ende eines Korridors gehen. Nun wurde gemessen, wie viel Zeit die Probanden für die Gehstrecke benötigten. Die eine Hälfte der Versuchspersonen, die Experimentalgruppe, hatte Wortlisten bekommen, die Begriffe wie Florida, vergesslich, Glatze, grau oder Falte enthielten – also Wörter, die mit alten Menschen assoziiert werden.
Diese Gruppe ging tatsächlich deutlich langsamer als die Kontrollgruppe, die eine Liste mit neutralen Wörtern bekommen hatte. Die Probanden gingen natürlich davon aus, dass ihr Verhalten ihrer bewussten Kontrolle unterlag. Tatsächlich aber wurden sie unwillkürlich in ihrem Verhalten beeinflusst – allein durch das Lesen bestimmter Begriffe. 4
Wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken –welche Stellen wir also mit unserer inneren Taschenlampe anleuchten –, entscheidet darüber, wie wir uns fühlen und wie wir physiologisch reagieren.
Kommen wir zurück zur Geisterbahn. Natürlich haben wir hier in Deutschland und in der Welt mit einer ganzen Reihe großer Herausforderungen zu kämpfen. Daran gibt es nichts zu deuteln. Vermittelt werden uns diese Krisen in der Regel als »Ist so!«, mit einer fatalen Betonung der statischen Unveränderbarkeit. Und das löst bei vielen Menschen und bei Ihnen vielleicht auch Gefühle von Hilflosigkeit, Empörung und Ohnmacht aus. Wenn das in einer Gruppe geschieht, erleben deren Mitglieder sogar eine (tröstliche) Bindung, gestiftet durch gemeinsame Betroffenheit. Auch abwertendes Reden über bzw. Beschimpfen von anderen Menschen oder Gruppen erfüllt einen verwandten Zweck: Dies alles dient der Identitätssicherung und sorgt für Bindung über die Ingroup-Outgroup-Logik (ich bin bei denen, die schimpfen, also gehöre ich dazu, und die, über die wir gemeinsam schimpfen, gehören nicht dazu). Und wenn Sie dann nach Hause kommen und sich dort am besten noch einmal über das aufregen, was Sie an diesem Tag über sich ergehen lassen mussten, wird Ihre Psyche mit negativen Gefühlen nachgerade geflutet.
Sollten Sie jetzt noch auf die Idee kommen, den Fernseher anzuschalten und die Nachrichten zu schauen, werden Sie gar nicht anders können, als mit Ihrer inneren Taschenlampe die Katastrophen dieser Welt auszuleuchten. Mit anderen Worten: Sie absolvieren eine Runde in der Geisterbahn und noch eine und noch eine … Und während Ihr Körper sich noch damit abmüht, die Stresshormone wieder abzubauen, macht sich eine tiefe Erschöpfung breit.
Selbst wenn Sie ein in der Regel positiv gestimmter Mensch sind, haben Sie derzeit vielleicht manchmal das Gefühl, dass Ihnen – insbesondere seit der Corona-Pandemie, sehr viele Einladungen zur Geisterbahnfahrt unter die Nase gehalten werden. Die Mitmenschen der Kategorien eins und zwei winken Ihnen aus ihren Geisterbahnwagen zu und laden Sie ein, mit ihnen gemeinsam eine weitere Fahrt zu wagen. Allzu oft steigen Sie ein, nicht wahr? Dann werden die Bügel heruntergeklappt – und los geht die wilde Fahrt zu neuer Empörung, schäumender Wut und schließlich zur Frustration und Hilflosigkeit. Und darauf reagiert natürlich auch unser Walter. Moment … Walter?
Wer ist eigentlich Walter?
Wer denkt, ist nicht wütend.
– Theodor W. Adorno, Philosoph und Soziologe
Machen wir es kurz: Walter ist der Chef Ihrer körpereigenen Alarmanlage, zu der unter anderem die Amygdala gehört. Sie ist ein Teil des sogenannten limbischen Systems, einer sehr wichtigen Hirnregion, zuständig für unser Erleben von Stress und Angst. Beschreiben kann man die Amygdala als einen kleinen, mandelförmigen Komplex von Nervenzellen im unteren Bereich des Gehirninneren. Das limbische System ist ein Verbund verschiedener Hirnstrukturen, der eine große Rolle bei der Verarbeitung von Emotionen spielt.
Die Amygdala steuert – zusammen mit anderen Hirnregionen – unsere psychischen und körperlichen Reaktionen auf Stress und Angst auslösende Situationen. Treffen bei ihr Signale ein, die höhere Aufmerksamkeit erfordern, zum Beispiel, wenn etwas neu oder gefährlich ist, dann feuern ihre Nervenzellen Impulse ab und wir werden wacher und aufmerksamer. Dies geschieht übrigens bereits, bevor wir die Gefahr bewusst erkennen. Ab einer bestimmten Schwelle der Nervenaktivität setzt die Amygdala eine Stressreaktion in Gang und aktiviert so unsere Kampf-oder-Flucht-Reaktion. In Notfällen schlägt Walter also mit der Faust auf den roten Alarmknopf und sorgt so dafür, dass die Alarmanlage aktiviert und in nur Bruchteilen von Sekunden eine Notfall- und Stressreaktion in Ihrem Körper ausgelöst wird.
Wir haben im Gehirn ein Angstsystem,
das auf der Stufe eines Huhns ist.
– Professor Borwin Bandelow,
Psychiater und Angstexperte, Universität Göttingen
Diese Notfall- und Stressreaktion ist ein sehr alter und rasend schneller evolutionärer Mechanismus, der einst – Stichwort Säbelzahntiger – unser Überleben gesichert hat und bis heute nahezu unverändert aktiv ist. Deswegen wird dieser Teil des Gehirns oft auch als Reptiliengehirn bezeichnet. Damals galt es, innerhalb von wenigen Millisekunden auf eine Gefahr zu reagieren, um möglichst sofort flüchten oder kämpfen zu können – oder zu erstarren, wenn weder die eine noch die andere Option infrage kam. Gesteuert werden diese Reaktionen nicht nur über das vegetative Nervensystem, sondern auch durch Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol usw. Dies führt zu reflexartigen Veränderungen in unserem Körper, die einhergehen mit Puls- und Blutdruckanstieg, Erhöhung der Atemfrequenz, gesteigertem Muskeltonus, Mobilisierung der Energiereserven und Reduktion der Schmerzempfindlichkeit. All dies eignete sich damals sehr gut dazu, nicht allzu früh ein unfreiwilliger Teil der Nahrungskette zu werden.
Aber heute? Läuft es immer noch genauso ab. Nur der Säbelzahntiger wurde ersetzt.
Haben Sie schon einmal versucht,
Menschen mit Flugangst im Flieger zu beruhigen, indem Sie ihnen mithilfe von Statistiken
aufzeigen wollten, wie sicher das Fliegen und wie unrealistisch ein Absturz ist?
Diese Kampf-oder-Flucht-Reaktion ist die Übersetzung von Fight or flight, eines Begriffs, den der US-amerikanische Physiologe Walter Cannon bereits 1915 prägte. Die Konfrontation-oder-Flucht-Reaktion beschreibt die rasche körperliche und seelische Anpassung von Lebewesen als Stressreaktion in Gefahrensituationen. Egal ob das Ganze nur ein paar Sekunden dauert oder viele Stunden: Der denkende Teil unseres Gehirns, nennen wir ihn hier einmal Schlaumeier, hat keinen Zugriff auf das, was in diesen Augenblicken passiert, denn Walter hat das Steuer übernommen und lässt es sich auch so schnell nicht wieder entreißen. Und das ist zunächst auch gut so.
Wenn jetzt dort, wo Sie gerade sitzen, ein Teil der Zimmerdecke herunterfallen würde, und Ihr Schlaumeier würde erst noch einen diffizilen Plan festlegen, wie Sie am besten fliehen könnten, würden Sie das Ganze aller Wahrscheinlichkeit nach nicht überleben. Die langsamen Denkvorgänge gefährden uns in Notfallsituationen nur. Also übernimmt ein älterer Teil unseres Gehirns die Initiative und wir können uns schnell retten. Dieser Teil orientiert sich übrigens stark an Bildern und nicht an Sprache. Daher gibt es Bilder von Feuerlöschern und von Notausgängen, es gibt international verständliche Symbole und Warnfarben – alles darauf ausgerichtet, uns schnelle Orientierung zu bieten, wenn unser Schlaumeier, also der kognitive Bereich des Gehirns (präfrontaler Cortex), in den Hintergrund getreten ist und Walter das Ruder übernommen hat. Neuere Forschungen dazu haben übrigens ergeben, dass die Kampf-oder-Flucht-Reaktion bei Frauen anders ausgeprägt ist als bei Männern und dass sie sich in Gefahrensituationen eher schutzbietenden Gruppen anschließen, wie Sheldon Cohen und Thomas A. Wills ermittelten.5 Die Psychologieprofessorin Shelley Taylor von der University of California formulierte dafür den Begriff Tend and befriend als mögliche weibliche Alternative zu Fight or flight: den Nachwuchs beschützen (tend) und Freundschaft anbieten (befriend).6
Kurzfristig ist der Fight-or-flight-Modus auch heute noch eine intelligente, aber eben auch kräftezehrende Strategie. Denn es gibt natürlich immer noch lebensgefährliche Situationen, die wir aber in diesem Buch ausdrücklich ausnehmen. Der hierbei entstehende Stress ist im ganzen Körper zu spüren. Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie sich das letzte Mal so richtig erschreckt haben? Ihr Herz schlug rasend schnell, Ihre Atmung beschleunigte sich usw. In kurzen, zeitlich begrenzten Phasen ist Stress auch kein Problem, vorausgesetzt, im Anschluss folgt eine Phase der Erholung. Der Neurologe Prof. Dr. Volker Busch schaut daher auch kritisch auf den Stress mit dem Stress. »Gemeinhin wird Stress als viel gefährlicher und belastender eingeschätzt als er ist. Jedes Frauen- oder Herrenmagazin singt heutzutage das Hohelied einer unbedingten Stressvermeidung, und kaum ein Weiterbildungsseminar kommt ohne Warnhinweise vor einer gesundheitsschädlichen Schädigung durch Stress aus. Dabei geht ohne ihn im Leben nichts. Stress ist unverzichtbar! Stress hat sogar unter dem Strich viel mehr positive als negative Aspekte, und er ist weit besser als sein Ruf!«7