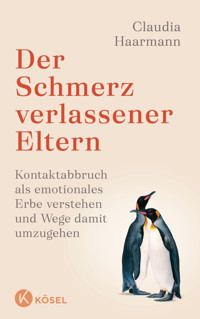19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Verbindung zur Mutter prägt uns fürs Leben
Neuausgabe des Buches »Mütter sind auch Menschen«.
Die Heilpraktikerin für Psychotherapie Claudia Haarmann plädiert in der Neuausgabe ihres Buchs »Mütter sind auch Menschen« für eine neue Beziehungskultur zwischen Müttern und Töchtern. Ihre Hauptthese: Jede Mutter will ihrem Kind das Beste geben, doch es gibt etwas in ihrem Leben, das sie daran hindert.
Anhand neuester Erkenntnisse aus Hirnforschung und Traumatherapie, erklärt sie, wie erlebte Traumata früherer Generationen das Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern nachhaltig beeinflussen. In Gesprächen mit Experten und in der Betrachtung von Lebensgeschichten arbeitet sie heraus, wie eine respektvolle Ablösung und gegenseitige Annahme aussehen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Die Verbindung zur Mutter prägt uns fürs Leben
»Für uns Frauen gibt es ein beharrliches Dauerbrennerthema: unsere Mutter. Denn sie ist immer wieder Gegenstand unserer Gedanken, Gespräche und Träume.«
Die Therapeutin Claudia Haarmann plädiert in der Neuausgabe ihres vormals unter dem Titel »Mütter sind auch Menschen« erschienenen Buchs für eine neue Beziehungskultur zwischen Müttern und Töchtern. Ihre Hauptthese: Jede Mutter will ihrem Kind das Beste geben, doch es gibt etwas in ihrem Leben, das sie daran hindert.
Anhand neuester Erkenntnisse aus Hirnforschung und Traumatherapie, erklärt sie, wie erlebte Traumata früherer Generationen das Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern nachhaltig beeinflussen. In Gesprächen mit Experten und in der Betrachtung von Lebensgeschichten arbeitet sie heraus, wie eine respektvolle Ablösung und gegen-seitige Annahme aussehen können.
Die Autorin
Claudia Haarmann, geboren 1951, arbeitete lange als freie Journalistin und ist heute Heilpraktikerin für Psychotherapie. Schwerpunkt ihrer Arbeit sind die Bindungs- und Beziehungsdynamiken in Familien und deren Auswirkungen im Erwachsenenalter. Sie setzt vorwiegend körperorientierte Psychotherapieverfahren und Gesprächstherapie ein. Die Autorin lebt in Essen.
Claudia Haarmann
Mütter sind eben Mütter
Was Töchter und Mütter voneinander wissen sollten
Kösel
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des Titels Mütter sind auch Menschen. Was Töchter und Mütter voneinander wissen sollten, erstmals erschienen 2008 im Orlanda Frauenverlag GmbH, Berlin.
Copyright © 2019 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Weiss Werkstatt, München
Covermotiv: © shutterstock/Dean Drobot
Lektorat der Ausgabe 2008: Patricia Mangelsdorff
Lektorat der überarbeiteten Auflage 2012 und Übersetzung: Ekpenyong Ani
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-24723-2V003
www.koesel.de
Inhalt
Vorwort
Vorwort zur überarbeiteten Auflage 2012
Vorwort zur Neuausgabe 2019
Kapitel 1 Mütter sind auch Menschen. Wieso Menschen? Mütter sind doch Mütter!
Kapitel 2 Der Bindungsreigen – ein schwieriger Tanz
Du bist eine andere! Pubertät – die schwierige Nahtstelle
Gespräch mit der Therapeutin Regina König
Die Liebe ist kein einfaches Spiel
Gespräch mit der Psychotherapeutin Kate White
Kapitel 3 Meine Mutter, der Schrecken und ich
Kapitel 4 Das Echo der Vergangenheit
Kapitel 5 Wenn etwas sichtbar wird, bleibt es nicht, wie es ist
Kapitel 6 »Erzähl mir vom Schicksal deiner Mutter«
Kapitel 7 Biografische Einblicke:
Im Grunde ist sie wie ein Dampfdrucktopf
Du bist meine Große
Aus meiner Mutter ist ein Niemandskind geworden
Kapitel 8 Wenn nichts mehr geht – der Kontaktabbruch?
Bibliografie
In Erinnerung an meine Eltern und für meinen Sohn Till
Vorwort
Die Zeit, in der ich all die kleinen Notizen verarbeitete, die meine Gedanken in Fluss hielten, ist vorbei. Hunderte von Zetteln mit Ideen und Zitaten hatte ich zusammengetragen, denn jedes Mal, wenn ich mit Frauen jeden Alters zusammen saß und davon sprach, ein Buch über Mütter und Töchter zu schreiben, sprudelten die Hinweise und Kommentare. Auf einem dieser Zettel stand: »Buch zur Mutter – na dann viel Spaß!«, auf einem nächsten: »Meine Mutter, geh mir weg, das Kapitel ist abgeschlossen!« oder: »Sie wollte mich immer anders haben und kann nicht akzeptieren, wie ich bin.« Auf mehreren Notizzetteln hieß es: »Meine Oma, die war lieb, aber mit meiner Mutter komme ich bis heute nicht klar.« Es gab fürsorgliche Äußerungen: »Ich kümmere mich um sie, sie braucht mich einfach.« Sehr viel seltener Bekundungen wie: »Sie ist mein Ruhepol« oder: »Wenn es mir mal schlecht ging, habe ich mich noch als junge Frau an ihren Rücken kuscheln können. Herrlich! Das hat meist schon geholfen.« In meiner Sammlung fanden sich auch Bemerkungen junger Mütter, die sich heute schon fast bange fragen: »Wie wird meine Tochter später wohl von mir sprechen?«
All diese kleinen Zettel sind Indizien: Die Beziehung zwischen Töchtern und ihren Müttern ist etwas Besonderes. Sie dreht sich um die Liebe – mal wird sie vermisst oder ist nicht die richtige, mal ist sie überladen von Ansprüchen oder belastet von Schuldgefühlen. Oftmals wird ein Weg aus der Endlosschleife schwieriger Verhaltensmuster gesucht, die man eigentlich nicht will und doch nicht weiß, wie man sich aus ihnen löst. Mutter und Tochter haben es nicht leicht, zueinander zu finden, sie bewegen sich zwischen Unverständnis, Sprachlosigkeit, Vorwürfen, Aufopferung und der Sehnsucht nach innigem Kontakt. Liegt das eigentlich an der Henne oder am Ei? Gibt es einen Anfang, einen Grund, der diese Verbindung so kompliziert macht? Was prägt diese Beziehungsdynamik, was ist der Hintergrund? Die Mutter scheint sich in diesem Drama sämtlichen Regieanweisungen zu entziehen, das macht es nicht leichter. Was aber hat sie zu dem gemacht, was sie geworden ist? Wer war sie, wer ist sie und was habe ich als Tochter mit all dem zu tun? Das sind Fragen, denen ich in diesem Buch folge.
Bei der Beantwortung waren aktuelle Sichtweisen der Neurobiologie und der Bindungsforschung hilfreich. Denn wir kommen nicht umhin, anzuerkennen: Die Mutter war unsere erste Beziehung! Und die Verbindung mit ihr hat gewichtige Auswirkungen auf unser Leben. Die Systemische Therapie und die Trauma-Forschung zeigen uns, ohne die generationsübergreifenden Aspekte lässt sich das sensible Beziehungsgeflecht nicht verstehen. Die Vergangenheit, die Geschichte der Mutter, berührt auch uns und in der Folge unsere Kinder.
In meinen Notizen wiederholte sich ein Satz: »Meine Mutter, die ist nicht so interessant, mein Vater, das ist ein Thema, darüber solltest du schreiben.« Der Vater ist für viele Frauen Hauptreibungspunkt im Guten und im Schlechten. Und ich konnte diesen Hinweis gut verstehen, hatte ich mich doch selbst über viele Jahre an meinem Vater »abgearbeitet«, bis mir klar wurde, wenn ein Thema für mich von Bedeutung ist, dann die ungeklärte Beziehung zu meiner Mutter. Mein Klärungsprozess mit ihr war die Motivation, dieses Buch zu schreiben. So ist es in erster Linie aus meiner Sicht als Tochter entstanden. Sie, und damit unsere Verbindung zu verstehen, war der wichtigste Schritt in mein eigenes Leben und meine Unabhängigkeit.
Die Fragestellung um den Vater und die Mutter scheint mir vergleichbar mit dem Modell von »Standbein und Spielbein« zu sein: Wird nur ein Bein gesehen und belastet, kommt es zu Problemen in der Statik des Körpers. Beide Beine müssen zur Verfügung stehen, um in Balance zu sein und damit gut im Leben zu stehen.
»Was ist denn mit den Söhnen?«, wurde ich gefragt. Obwohl es im Untertitel heißt »Mütter und Töchter begegnen sich neu«, wird vieles auf die Söhne zutreffen, denn natürlich nagen auch sie an den »Unterlassungssünden« ihrer Mutter. Zu erkennen, was die Mutter zu der gemacht hat, die sie ist, warum das Verhältnis zu ihr oft so kompliziert ist, trifft Töchter und Söhne gleichermaßen. So werden die Kapitel »Der Bindungsreigen« und »Das Echo der Vergangenheit« Männer weitestgehend auch betreffen. Auch wenn die Söhne sich im Laufe der Kindheit mehr und mehr mit dem Vater, dem Männlichen identifizieren, bleiben die ersten Erfahrungen mit der Mutter wesentlich.
Meine Notizsammlung macht mir deutlich, das Thema ist so groß und umfangreich, dass verschiedene Aspekte nur angerissen und nicht ausgeführt werden konnten. Dazu gehören die neuen Erkenntnisse über die vorgeburtliche Zeit. Heute wissen wir, dass die Schwangerschaft außerordentlich bedeutsam für das Kind ist und auch für die Beziehung zwischen ihm und der Mutter. In dem Kapitel über den Bindungsreigen wird Grundlegendes beschrieben, was sicher auch Gültigkeit hat für die allererste Zeit zwischen Mutter und Kind.
An meiner Pinnwand hängt noch der Zettel, auf dem steht: »Die alte Mutter – Krankheit und Pflege«. Für viele Leserinnen wird der Umgang mit der alten Mutter ein Thema sein oder in Zukunft eines werden. Und es ist herausfordernd, sich um die Mutter zu kümmern, mit der es zeitlebens nicht leicht oder sogar konfliktreich war. Auch wenn ich auf diesen Aspekt nicht ausdrücklich eingehe, glaube ich, dieses Buch ist ein Beitrag, um mehr Verständnis für die Mutter und sich selbst zu entwickeln. Wer es liest, wird kaum umhinkommen, gelassener oder sogar friedvoller auf die Beziehungsgeschichte zu schauen.
Nun sind all meine Notizen mit den Frauen verbunden, die mich inspiriert und damit bei der Entstehung des Buches geholfen haben. Mit ihren ganz persönlichen Sichtweisen und Geschichten haben sie Spannendes, Berührendes und Erhellendes beigetragen. Ihnen allen danke ich sehr. So offen über sich und die eigene Mutter zu sprechen, ist nicht selbstverständlich, denn auch wenn alle Daten völlig anonym bleiben, ist das Thema eines der intimsten, persönlichsten Angelegenheiten überhaupt. Das wurde mir im Laufe des Rechercheprozesses deutlich. Für mein erstes Buch befragte ich verschiedene Frauen zu ihrer Sexualität, die Gespräche damals waren fast unbefangener und leichter als die über die Mutter. So empfinde ich es als sehr großzügig von den Töchtern und Müttern, die in diesem Buch zu Wort kommen, dass sie ihre Empfindungen und Gedanken zur Verfügung stellen. Ihre Geschichten machen das Buch erst anschaulich und reich.
Der Prozess, durch den ich beim Schreiben gegangen bin, war nicht immer leicht, oft tauchten meine eigenen Themen als Tochter und auch als Mutter auf. Manchmal schien mir das Thema zu groß und gewisse Zweifel machten sich breit. Dass ich jede Hürde nehmen konnte, machten meine Freundinnen und Freunde möglich, von ihnen habe ich jede Form der Unterstützung bekommen. Das war wie mit den Feen. Sie kommen, wenn man sie am meisten braucht und gewähren die Erfüllung von drei Wünschen – manchmal waren es sogar noch mehr! Dafür bin ich euch sehr dankbar.
Besonders danken möchte ich meiner Lektorin Patricia Mangelsdorff. Sie war meine Sparringpartnerin und mein Coach und immer da, wenn ich meine Gedanken ordnen musste. Sie hat sofort erfasst, worum es geht und vieles zur Klarheit der Texte beigetragen. Das alles hat mich und das Buch besonders unterstützt.
Claudia Haarmann
2008
Vorwort zur überarbeiteten Auflage 2012
In dieser überarbeiteten Auflage von Mütter sind auch Menschen greife ich im letzten Kapitel ein Thema auf, mit dem ich seit dem ersten Erscheinen des Buches immer wieder beschäftigt bin. Einen großen Teil der Briefe, die mich erreichen, schreiben Mütter, die keinen Kontakt mehr zu ihren Töchtern haben. Der Kontaktabbruch ist offensichtlich ein relevantes Thema und wird zunehmend auch öffentlich diskutiert. Im September 2010 war ich beim SWR Hörfunk eingeladen, in eine Live-Sendung mit Hörerbeteiligung. Sie hieß: »Aber ich hab dich doch lieb! – Mütter und Töchter: ein schwieriges Verhältnis«. Während und nach der Sendung riefen Hunderte von Müttern an, die sich alle ähnlich äußerten: »Natürlich liebe ich meine Tochter, aber warum ist sie so abweisend? Warum ist sie so schwierig?« Oder eben auch: »Warum will sie keinen Kontakt mehr mit mir?« Alles verzweifelte Frauen, die mit einer Lebenssituation konfrontiert sind, die sie so nie wollten, die sie nicht verstehen – nicht verstehen können, nicht verstehen wollen oder sich weigern zu verstehen.
Ich erlebe Frauen, die sich selbst als verlassene Mütter bezeichnen. Sie sprechen davon, dass ihre Töchter ohne Vorwarnung, also völlig unverhofft, den Kontakt abgebrochen hätten. Meine Perspektive ist eine andere, und so lautet meine These: Der Kontaktabbruch ist der Endpunkt einer schwierigen Beziehung/Bindung. Wenn eine Tochter die Mutter aus dem eigenen Leben ausgrenzt, geschieht das nicht einfach so, dahinter steht ein langer, sehr schmerzhafter Prozess. Eine Tochter, die sich von der Mutter trennt, hat gewichtige Gründe, die meist weit zurückliegen. Denn erst als Erwachsene kann sie sich eingestehen, was für sie in der Familie problematisch war. Der Kontakt zwischen Mutter und Tochter/Eltern und Kindern wird dann problematisch, wenn über das Eigentliche, das Schmerzliche nicht geredet werden kann. Und aufgrund der Sprachlosigkeit ist das, was Eltern als normalen Kontakt empfinden, für das Kind vielleicht schon lange nur eine moralische Pflichterfüllung gewesen.
Es gibt sicher Fälle, in denen der Kontakt abrupt beendet wird, auch dahinter stecken dramatische familiäre Gründe. Nicht selten entdeckt eine Tochter etwas, was ihr Bild von der Familie erschüttert – dazu gehören Geheimnisse oder auch Lebenslügen der Eltern. Meist kommt so etwas »zufällig« ans Licht, dann untergräbt es massiv das Vertrauen zu den Eltern und sie braucht erst einmal Distanz.
Mütter sind eben Mütter ist ein Versöhnungsbuch, in dem ich versuche, für die Tochter fassbar zu machen, warum ihre Mutter so ist, wie sie ist. Nach den vielen Rückmeldungen, die ich darauf bekam, habe ich gemerkt, dass noch etwas fehlte. Wenn es eine echte Schieflage zwischen Mutter und Tochter gibt, ist eben auch die Mutter gefordert. Sie kann einen Schritt auf die Tochter zu machen, indem auch sie die Perspektive wechselt, indem auch sie sich in die Schuhe der Tochter stellt, mit der Fragestellung: Wie geht es dir mit mir? Mit dem neuen Kapitel »Wenn nichts mehr geht – der Kontaktabbruch« schließe ich eine Lücke. Und ich vermute, dass es darin für jede Mutter etwas zu entdecken gibt – auch wenn sie in einem ganz guten Kontakt mit ihrer Tochter steht.
Eine weitere Ergänzung der neuen Auflage ist ein Interview mit Kate White, Psychotherapeutin am John Bowlby Centre in London. Sie geht unter anderem der Fragestellung nach, inwieweit frühe körperliche Erfahrungen mit der Mutter (bzw. der Bezugsperson) Auswirkungen auf die Sexualität im Erwachsenenalter haben. Eine ihrer Thesen lautet: »Das eigentlich Herausfordernde in der Sexualität ist, mit der Liebe klarzukommen.« Liebe, sagt sie, sei für viele Menschen ein gefährlicheres Gefühl als Neid oder Hass. Das Gespräch mit Kate White ist eine große Bereicherung des Kapitels »Der Bindungsreigen – ein schwieriger Tanz«.
Die Mutter-Tochter-Beziehung ist ein großes zwischenmenschliches Abenteuer mit unglaublich vielen Facetten, und ich glaube, es lohnt sich, weiter und weiter darüber nachzudenken.
Claudia Haarmann
Essen, 2012
Vorwort zur Neuausgabe 2019
Für uns Frauen gibt es ein beharrliches Dauerbrennerthema: unsere Mutter. Denn sie, die uns seit der ersten Lebensstunde vertraut ist, mit der wir erlebt haben, wie vertrauensvoll oder aber angespannt und kompliziert sich Bindung und Verbindung anfühlt, die unser weibliches Vorbild in den ersten Lebensjahren war, die unsere Gefühle, Glaubenssätze und unsere Lebenskonzepte wesentlich geprägt hat, deren Gene wir tragen, deren Schicksal Einfluss auf unser Schicksal hat, diese Mutter ist immer wieder Gegenstand unserer Gedanken, Gespräche und Träume. 2008 ist die erste Ausgabe dieses Buches unter dem Titel Mütter sind auch Menschen erschienen und jetzt nachdem ich für diese Neuausgabe im Kösel-Verlag alles noch einmal gelesen, an manchen Stellen gekürzt, an anderen erweitert habe, zeigt sich: Das Buch bleibt auch heute, nachdem die Neuropsychologie und die Bindungsforschung das Thema immer weiter erforschen und durchdringen, hochaktuell.
Das Alter der Frauen, die hier von sich und ihren Müttern berichten, ist zwischenzeitlich fortgeschritten, aber das habe ich nicht korrigiert, denn das Alter ändert thematisch nichts – nur dass die Zeit uns in der Regel gelassener werden lässt und an Einsichten reicher und damit auch verständnisvoller.
Manche Leserinnen schreiben mir, dass dieses Buch von zwei oder sogar drei Generationen in der Familie gelesen wurde und dass es Anlass für sie war, endlich das Schicksal der Frauenlinie in ihrer Familie anzusprechen. Ein Grund mehr dankbar zu sein, dass dieses Buch wieder verlegt wird und seinen Beitrag zum Verständnis von Familienproblematiken leistet.
Claudia Haarmann
Essen, Juli 2019
Kapitel 1
Mütter sind auch Menschen. Wieso Menschen? Mütter sind doch Mütter!
Über eine Spezies mit enormer Anpassungsfähigkeit
Mal ehrlich: Das Leben unserer Mutter beginnt doch eigentlich erst mit unserer Geburt. Ohne uns gäbe es sie gar nicht. Wir erst machen die Mutter zur Mutter.
Gut, ich räume ein, es muss eine Zeit vor uns gegeben haben, sonst hätte sie unseren Vater nicht getroffen. Und natürlich …, sie hatte selbst Eltern! Aber das sind Oma und Opa, und in dieser Eigenschaft vertreten auch sie eine ganz besondere Spezies.
Die Mutter-Spezies – enorm vielseitig und anpassungsfähig
Die Mutter-Spezies gehört zu den vielseitigsten Geschöpfen der Gegenwart: Mal ist sie Monster, mal bemitleidenswertes Muttchen, mal Vamp. Sie kann sich so benehmen, dass einem die Haare zu Berge stehen. So eine Mutter schafft es sogar, einem die Hölle heiß zu machen. Mal ist sie so stark, dass sie die ganze Welt hält, mal so schwach, dass es zum Auswachsen ist. Sie eignet sich dazu, sie abgöttisch zu lieben und gleichzeitig zu hassen, sie zu bewundern oder sie zu umsorgen. Und sie steht bereitwillig zur Verfügung, wieder und wieder auf ihr herumzuhacken.
Wie ist es Gott gelungen, ein Geschöpf mit dieser Vielfalt zu schaffen?
Auch Charles Darwin hätte an der Mutterspezies seine helle Freude gehabt, denn die Anpassungsfähigkeit an ihren Lebensraum ist phänomenal. In Sachen Brutpflege reagiert sie immer adäquat auf aktuelle gesellschaftliche Anforderungen. Zurzeit liegt ihr die altersgerechte Intelligenzentwicklung und vor allem das psychische Wohlbefinden des Kindes besonders am Herzen. Stetig lenkt sie ihr Augenmerk sowohl auf seine motorische als auch auf seine sprachliche und soziale Entwicklung. Was auch immer gerade gefordert wird, die Mutterspezies wird ihr Möglichstes geben. Sie ist zugleich Taxiunternehmerin, Sozial- und Familientherapeutin und Expertin in Sachen Vollwerternährung.
Immer zuständig und für alles verantwortlich…
Seit einigen Generationen zeichnet sich eine Mutter zudem exklusiv durch eine besondere Fähigkeit aus: Sie ist bereit, die Folgen jeder Fehlentwicklung auf sich zu nehmen. Ohrfeigt ihr Kind ein anderes, fragt sie sich sofort: »Was habe ich falsch gemacht?« Ist das Kind zu dick oder zu dünn, liegt es an ihrer mangelhaften emotionalen oder kulinarischen Zuwendung. Zeigt es keine Ambitionen, sein feinmotorisches und musikalisches Fortschreiten an der Geige weiterzuerproben, hat sie nicht genug motiviert. Kommt es in der Schule nicht mit, muss sie noch mehr fördern. Ist die Wäsche nicht gebügelt, kümmert sie sich nicht genug. Steht der falsche Joghurt im Kühlschrank – ihr Fehler.
Aber das wirklich Besondere an dieser Spezies: Sie ist und bleibt für ihre Nachkommen zuständig – in guten und vor allem in schlechten Zeiten und oft ihr Leben lang. Sie trägt die Verantwortung für unser Wohlbefinden und das unserer Geschwister. Sie ist schuld an all dem Schweren in unserem Leben. Wir sind und bleiben abhängig von ihrer Zuwendung. Wenn sie nur einmal von Herzen sagen würde: »Ja, ich liebe dich – du bist ganz und gar in Ordnung, so wie du bist«, wäre das für uns der Himmel auf Erden. All unsere Probleme wären gelöst, ganz gleich, wie viele graue Haare wir selbst schon haben.
… nie gut genug
Gehört man der Mutterspezies an, sind bestimmte Nebenwirkungen unausweichlich: Nie war und ist es genug oder das Richtige, was die Mutter tut, selbst wenn sie alles gab und gibt! Es ist, als habe trotz all ihres Umsorgens, trotz all ihres Tuns immer etwas gefehlt, und dieses »Etwas« steht unaussprechlich zwischen Müttern und ihren Kindern. Mütter und Töchter scheinen besonders massiv betroffen zu sein. Das »Zuwenig« …‚ »nicht richtig« … oder »Zuviel vom Falschen«, gehört in ungezählte Mutter-Tochter-Beziehungen wie die Butter aufs Brot.
Der ganz normale Generationen-Wahnsinn
Und uns Töchtern, wie geht es uns dabei? Wir Töchter scheinen, mit der Geburt verschiedene Anrechtscheine auf ein nicht klar spezifiziertes Mutterverhalten erworben zu haben. Denn ausgesprochen wird von uns der Vorwurf, die Beschwerde. Irgendetwas fehlt: Warum hat sie nicht …, sie sollte doch …, kann sie nicht einmal …! Das Klagen liefert den Zündstoff für die Beziehung zwischen beiden und garantiert dauerhaften nervenaufreibenden Unfrieden.
Aber rollen wir das Klagelied von oben auf. Da gibt es einerseits die Frauen, denen die Mutter zu umsorgend, zu sehr Muttchen, eben zu mütterlich ist. Das ständige Kümmern empfinden sie wie einen zähen Kaugummi: »Ja, der Kuchen ist lecker … nein, ich brauche nichts … ja, ich melde mich, sobald ich zu Hause bin …« Dabei möchten sie am liebsten sagen: »Lass mich doch endlich mal in Ruhe!« Diese Töchter wünschen sich nichts mehr als eine Mutter, die mehr Frau ist. Die sich für andere Dinge interessiert. Zum Beispiel Arbeit, Kultur oder Mode. Sie könnte einfach mehr aus ihrem Leben machen. Dann gibt es die Töchter, denen genau dieses Mütterliche fehlt. In ihren Augen interessiert sich ihre Mutter nur für ihre Arbeit und Mode, ist nur mit Fragen der zu verbessernden Schönheit beschäftigt oder mit ihrer Wirkung auf Männer. Sie wünschen sich nichts mehr, als dass die Mutter sich mehr kümmert und mütterlicher ist: »Mama, back doch mal …, nie rufst du an …, ich interessiere dich doch gar nicht!«
Es gibt aber auch die Tochter, die sich verantwortlich für ihre Mutter fühlt und eigentlich die bessere Mutter ist. Sie lebt in ständiger Sorge um ihre »schwache« Mutter. Und wir kennen manch eine Tochter, die sagt: »Meine Mutter interessiert mich nicht!« Sie wähnt sich unabhängig, meidet den Kontakt oder lehnt jedes Zusammentreffen ab. Zwischen den Polen von Distanz und Nähe, zwischen dem »Alles-Geben« und »Nichts-Nehmen« finden sich unzählige Varianten: Da gibt es ein Dauer-Abonnement auf das Drama »Du machst mir den Stress«; manche Töchter reden so überheblich und verachtend über ihre Mutter, wie sie es mit keinem anderen Menschen jemals tun würden; da schwelt Wut und Ablehnung: »Sie hasst mich …, ich hasse sie … meine Mutter ist ein Monster …« Manche Töchter erleben ihre Mutter als fremd und distanziert. Nicht wenige bleiben in ausreichender Entfernung zu ihrer Mutter, sie sind nicht in der Lage, sie körperlich zu berühren. Der Gegenpol hierzu ist engstes Beieinandersein: »Wir sind wie Freundinnen … wir telefonieren jeden Tag und erzählen uns alles.« Diese große Nähe kann wiederum in das Gefühl umschlagen: »Sie krallt mich und ich komme nicht los.« Es gibt aber auch den ganz normalen Wahnsinn. Knapp ausgedrückt heißt er: »Sie nervt!« Die Mutter-Tochter-Beziehung ist selten neutral, sie ist bewegt von heftigen Emotionen, sehnsüchtigen Erwartungen und Hoffnungen auf Besserung.
Und die Mütter? Auch sie spüren, dass etwas nicht stimmt, sie kennen das Gefühl von Mangel und Fehlerhaftigkeit. Jede Mutter hat immer nur das Beste gewollt, ist stets bemüht, es gutzumachen. Sie liebt ihr Kind und möchte nichts anderes, als dass es ihm gut geht. Aber es gab und gibt »Etwas« in ihr, das dieses Beste unmöglich macht, etwas, was sie daran hindert.
In diesem inneren Widerspruch von »Ich will doch nur das Beste, aber krieg es nicht hin«, fühlt sich die Mutter oft hilflos und unverstanden. Sie möchte die Tochter erreichen, weiß jedoch nicht wie. Manchmal versucht sie ihre vermeintliche Schuld wieder gutzumachen – mit Kochen, Backen, kleinen (Geld-)Geschenken oder freundlichen Angeboten, wie: »Soll ich nicht mal deine Gardinen waschen?« Sie opfert sich auf, sucht den Kontakt durch ständiges »Wie kann ich dir was Gutes tun?«. Vielleicht ist auch das Gegenteil der Fall und sie reagiert auf ihr inneres Unbehagen mit Vorwürfen und Du-Botschaften: »Du könntest dich ruhig mal wieder melden!« »Hast du auch an den Geburtstag von Tante Lisbeth gedacht?« Sie nörgelt und klagt ein. Oder sie zieht sich schmollend zurück und hält sich in Wartestellung.
Die verwundbarste Stelle: Du bist schuld!
Damit sind wir mitten in der folgenreichsten Dynamik zwischen Mutter und Tochter: der Schuld. Da wird vieles hin- und hergeschoben. Und die meisten Töchter spielen virtuos auf dieser Klaviatur. Laut oder leise sagen sie: »Nie warst du wirklich da. Du bist schuld, dass es mir so schlecht geht, liebe Frau Mama! Wenn du nur anders gewesen wärest, mir das gegeben hättest, was ich brauchte, dann wäre mein Leben gut. Dann gäbe es Harmonie zwischen uns. Meine Beziehungen liefen besser. Du würdest mich verstehen und akzeptieren und nicht ständig an mir rummäkeln oder immerzu wissen, was für mich gut ist. Ich müsste nicht ständig auf die Palme steigen, weil du wieder mal nicht zugehört hast. Immer geht es nur um dich! Ich müsste nicht immer wieder die Streitigkeiten zwischen dir und Papa schlichten. Mit Papa ist sowieso alles viel schöner als mit dir! Weißt du eigentlich, dass ich nach jedem Besuch bei dir total fertig bin und vor Wut fast platze? Überhaupt: wenn du anders wärest, hätte ich viel weniger Probleme. Dabei bin ich das Kind und du bist die Mutter, also liegt die Verantwortung bei dir und ich habe das Recht, einzufordern, was ich nie bekommen habe. Da steht noch was aus, die Rechnung ist noch nicht beglichen…« Besonders kommt die Botschaft an, wenn noch Zeugen – zum Beispiel der Ehemann angeführt werden: »Rudolph sieht das genauso mit dir!« Das sitzt.
Ob offen ausgesprochen oder in Blicken und Andeutungen gekonnt platziert: Es passt wie der Deckel auf den Topf. Denn Mütter wissen oder ahnen, dass sie nicht alles richtig gemacht haben. Sie spüren, dass sie nicht das geben konnten, was sie eigentlich wollten. Die Tochter erwischt sie an der verwundbarsten Stelle. Die Mutter fühlt sich schuldig, bewusst oder unbewusst, sie wollte ja nichts anderes, als es gutzumachen mit dem eigenen Kind. Vielleicht hatte sie sich sogar geschworen: »Ich mache es besser als meine eigene Mutter.«
Wenn sie es gekonnt hätte, hätte sie das Optimale, das Ideale getan. Nur: Sie konnte nicht! Wenn sie gekonnt hätte, hätte ein übervoller Korb an Liebe für uns bereitgestanden. Sie hätte uns wahrgenommen mit all dem, was uns ausmacht, hätte uns so ausgestattet, dass wir vertrauensvoll und gelassen ins Leben und in Beziehungen gehen könnten. Sie hätte Worte für das, was sie selbst bewegt. Sie würde uns all die Wärme geben, die wir brauchen.
Aber es gibt etwas, das all das verhindert hat. Um dieses »Etwas« soll es in diesem Buch gehen. Meine Grundannahme lautet: Unsere Mütter konnten und können uns nicht das geben, was wir als Töchter gebraucht hätten und heute noch brauchen. Wären sie dazu in der Lage, dann wäre es längst geschehen.
Töchter, die selber Mütter geworden sind, beginnen manchmal, die eigene Mutter zu verstehen. Denn wenn wir selber Kinder haben, spüren wir einen Konflikt in uns. Wir lieben unser Kind über alles und wir wollen nichts mehr, als dass es ihm gut geht, dass es bestmöglich gedeiht – und gleichzeitig nehmen wir unsere eigene Begrenzung wahr. Wir erleben uns gestresst, fühlen uns überfordert, rasten bei Anlässen aus, die wir nie für möglich gehalten hätten, wollen unsere Ruhe, schimpfen, verhalten uns widersprüchlich, fühlen uns eingeengt, finden keine Worte, um unsere in der Tiefe rumorenden Gefühle auszudrücken.
Wir wissen, dass vieles besser laufen könnte, aber wir bekommen es nicht hin. »Etwas« schränkt uns ein und nimmt uns die Gelassenheit. Wir wollen nur das Beste, aber es gelingt uns nicht. Und in dieser Diskrepanz entwickeln sich schnell Schuldgefühle. Die plagen viele Frauen. Wie oft hört man ältere Mütter sagen: »Mein Gott, hätte ich es doch nur anders gemacht.«
Kein Ausweg in Sicht?
So weit, so schlecht. All das und einiges mehr gehört zwischen Müttern und Töchtern zum Ist-Zustand – vorherrschend ist das Gefühl des Mangels und der Wut, der Konkurrenz, der Vorwürfe, der Distanzierung oder einer Nähe, die nicht nah, sondern eng, zu eng ist. Eine Mischung, die sich auch in den zahlreichen Gesprächen mit Frauen widerspiegelt, die ich für dieses Buch geführt habe. Gemeinsam ist allen eines: Weder Töchtern noch Müttern geht es gut dabei. Die meisten empfinden das vielsagende Augenverdrehen, die dauernden Missverständnisse und Streitereien, die Überaufmerksamkeit, das ständige Genörgel aneinander als etwas Kraftraubendes und Zehrendes. Gleichwohl erscheint uns dieser Gefühlswahnsinn als ganz normal.
Die Mutter-Tochter-Beziehung ist selten gelassen und entspannt. Wann schon begegnen sich diese zwei Frauen gleichberechtigt, akzeptierend – wie auf Augenhöhe.
Und es sieht so aus, als gäbe es wenig Hoffnung auf Klärung. Als ich einer Journalistin erzähle, dass ich über die Bindung zwischen Mutter und Tochter nachdenke – vor allem darüber, wie wir aus dem Clinch miteinander herauskommen – fasst sie kurz und bündig zusammen, was viele Frauen denken: »Gar nicht!«
Aber damit möchte ich mich nicht so ohne Weiteres abfinden.
Nur, was wollen wir eigentlich?
Verstehen und Verständnis als Schritte in die Freiheit
Die meisten Töchter können viel dazu sagen, was sie in ihrer Beziehung zur Mutter auf keinen Fall mehr wollen. Aber was wünschen wir uns? Ablösung von der Mutter? Ja. Normalität? Freiheit? Ja. Aber was heißt das? Den Kontakt zu kappen und möglichst viele Kilometer zwischen uns und die Mutter zu bringen? Das hat sich als Illusion erwiesen. Denn: Wie auch immer die Gefühle zwischen Mutter und Tochter aussehen mögen, beide Frauen sind zutiefst miteinander verbunden, wissen aber nicht, wie sie sich gegenseitig erreichen, wie sie ihrer Verbindung eine Form geben können, die beiden guttut und jeder ihre Freiheit lässt. Im Moment gleicht die Verbindung einer unbegehbaren und schwankenden Brücke. Ihr möchte ich mich mit diesem Buch nähern. Es wird um Verstehen und Verständnis gehen und damit um eine neue Perspektive.
Folgende Zeilen der 40-jährigen Mimmie geben eine Idee davon, was ich damit meine. Das Verhältnis zu ihrer Mutter war schwer belastet – sprachlos und distanziert. Mimmie suchte dringend nach einer Veränderung, denn die Mutter war bereits sehr krank. Als die Zeit fast verstrichen ist und ihre Mutter in einem Zustand zwischen Wachen und Schlafen auf den Tod wartet, schreibt mir Mimmie:
»Unterhaltungen sind nicht mehr möglich, aber ich weiß, dass ich zu ihr durchgedrungen bin. Sie hat auf jede Frage, auf jedes Wort von mir reagiert. In einzelnen Momenten waren wir in echtem Kontakt. Sie kann nur noch kurz antworten, dann versinkt sie wieder in eine unbekannte Welt. Mamas Gedächtnis funktioniert nicht mehr gut. Aber sie hat sich in jedem dieser Momente so sehr gefreut. Als ich ihr sagte, wie sehr ich sie liebe, dass sie genau die richtige Mama für mich war und ist und immer sein wird. Ich habe ihr ›Danke‹ für alles gesagt. Es waren nur wenige, kurze Sätze zwischen uns. Aber sie waren die einzig wichtigen Sätze, die ich brauchte … und sie auch.
Auf meine Frage an sie, was sie mir für mein Leben wünsche, sagte sie: ›Dass es dir gut geht, Mimmie‹ und fügte hinzu, dass im Keller noch Eingemachtes für mich steht.«
Mimmie schreibt über eine Nähe, die sich viele Frauen wünschen. Die Frage ist: Wie kommen wir dahin? Es gibt die grundlegende Bereitschaft, nur die heißt: »Ich bin ja bereit zur Versöhnung, aber nur wenn sie endlich offen zugibt, was sie alles falsch gemacht hat …, aufhört, sich in mein Leben einzumischen …, wenn sie mir einmal wirklich zuhört …«. Also: Versöhnung ja, aber nur zu unseren Bedingungen. Und die Bedingung lautet: Mama muss sich ändern.
»Wirklicher Frieden ist nur zu Füßen der Mutter zu finden«, sagt Regina König in unserem Gespräch. Und das ist das Gegenteil von: »Ja, aber …« Für meinen eigenen Weg trifft der Satz absolut zu. Erst, seit ich mit meiner Mutter in Frieden bin, seit ich sie ohne Wenn und Aber genau so nehmen kann, wie sie war, bin ich wirklich zur Ruhe gekommen. Wir finden nicht zu innerer Balance, indem wir uns krampfhaft um Entfernung bemühen – geografisch, emotional oder indem wir versuchen, anders als die Mutter zu sein. Denn damit stecken wir in einer bloßen Reaktion. Bei den Frauen, mit denen ich arbeite, ist jeder Schritt auf die Mutter zu, ein Schritt in die persönliche Freiheit.
Aber: Ist dieses unbedingte Annehmen immer möglich? Ich möchte keinesfalls verharmlosen, dass es Mutter-Tochter-Beziehungen gibt, die Versöhnlichkeit sehr schwer machen. Ich kenne Mütter, die weit davon entfernt sind, geben zu können, was ihr Kind gebraucht hätte. Sie waren versorgend, aber nicht mehr. Es gibt Mütter, die innerlich wie gefroren sind und eine Atmosphäre von Kälte und Abweisung verbreiten. Andere leiden zu sehr an ihrem eigenen Leben, machen sich klein, lassen sich in ihrer Ehe zu viel gefallen. Sie sind so schwach, dass keine Hilfe von ihnen zu erwarten ist. Besonders schwer ist es mit einer Mutter, die einen allein gelassen hat, die trank und schon mal zuschlug; die nicht hat sehen wollen, dass ihre Tochter missbraucht wurde; die wegschaute, wenn es massive Übergriffe gab – gerade im engsten Familienkreis. Mit solchen Müttern ins Reine kommen? Und wenn ja, wie? Das ist eine der Fragen, mit denen ich mich in diesem Buch beschäftige.
Nun schreibe ich hier keinen Ratgeber, der sagt: Wenn Sie A+B befolgen, dann wird alles gut. Im Grunde beschäftigt mich nur eine Frage: Warum ist die Mutter so geworden, wie sie ist? Denken wir nur an eine kühle oder kalte Mutter, das ist kein angenehmes Gefühl, auch nicht in ihr. Emotionale Kühle fühlt sich nicht wirklich wohlig an und diesen Zustand wird sie nicht freiwillig gewählt haben. Was also hat sie dazu gebracht?
Und wenn wir selber Mütter sind: Warum fühlen wir uns manchmal hilflos und tun Dinge, die wir niemals haben tun wollen?
Was ist dieses »Etwas«, das das Zusammensein zwischen Mutter und Tochter so erschwert? Ich gehe davon aus: Wenn wir anfangen zu verstehen, was sie und unsere Beziehung so hat werden lassen, dann wird aus diesem Verständnis eine Ruhe wachsen – auch wenn sich im Moment alles noch so festgefahren und kräftezehrend anfühlen mag. »Nur«, werden Sie fragen, »was, bitte schön, bedeutet das im praktischen Leben? Soll ich auf die Mutter zugehen, sie ›annehmen‹, oder gar ›zu ihren Füßen liegen?‹ Alles unter den Teppich kehren, was mich kränkt? Schmerz und Wut herunterschlucken? Nur nichts Heikles aussprechen? Immer lieb lächeln?«
Wie immer, wenn ich schreibe, erreichen mich Gedanken, die so trefflich sind: »Es ist die Sehnsucht nach der Wahrheit, die uns weiterbringt«, schreibt mir eine Freundin. Dieser Satz drückt aus, was mein Anliegen ist. Und zur Wahrheit gehört, dass zwischen den meisten Müttern und Töchtern eben nicht alles wunderbar ist. Im Gegenteil: Beide haben in der Regel sehr Schwieriges miteinander erlebt, da gibt es nichts schönzureden. Ich glaube allerdings, unsere gewohnten Verhaltensweisen im Umgang mit unseren Müttern, wie Klagen und Vorwürfe, dienen eher der Schmerzvermeidung und eben nicht der Wahrheitsfindung – auch, wenn diese Aussage zunächst befremdlich klingen mag.
Verstehen und Versöhnlichkeit erfordern keine Anstrengung, schon gar nicht, dass wir uns verbiegen. Eigentlich brauchen wir »nur« ein offenes Herz – auch wenn genau das schon viel sein kann. Wenn es gelingt, Licht in die Zusammenhänge zu bringen, dann wird alleine das seine Wirkung zeigen. Es ist, so möchte ich klar sagen, kein »Muss«. Jede Frau wird für sich entscheiden.
Doch dazu später mehr. Zunächst zu einer anderen Wahrheit, die uns weiterbringen kann.
Von anderen Kulturen lernen: Erst Mensch, dann Frau, dann Mutter
Mütter sind auch (nur) Menschen. Das klingt selbstverständlich und banal. Und doch ist es eine Kernüberlegung dieses Buches. So, wie wir die Mutter-Kind-Beziehung in unserer Kultur leben, gibt es immer einen Blick von oben nach unten oder unten nach oben, von klein nach groß oder groß nach klein. Eine Hierarchie. Ein »du gibst … ich nehme …«, ein »du musst … und ich habe das Recht auf …«
Diese kulturelle Festlegung determiniert und begründet Wünsche und Ansprüche. Natürlich ist und bleibt die Mutter immer die biologische Mutter, das liegt in der Natur der Dinge. Aber in unserem Kulturkreis bestimmt dieses Denken ein lebenslanges soziales Rollenverständnis und -verhalten. Unsere Rollendefinition von Mütterlichkeit rechtfertigt Erwartungen, die nie ein Ende finden. Sie verhindert, dass wir es mit unseren Ansprüchen und Wünschen irgendwann gut sein lassen. Aus eben diesen Erwartungen speist sich das Unverzeihliche der Töchter. Unsere Kultur hegt eine Idee von Mutterschaft, die beide, Tochter und Mutter, nie aus ihrer Rolle entlässt. So verhindert sie eine bereichernde Begegnung von Frau zu Frau.
Nun ist die Welt groß und rund und lässt den Blick auf andere Kulturen zu. So haben verschiedene indigene Völker in Amerika eine ganz andere Haltung, was die Rolle der Mutter betrifft. Dort gilt: Du bist Mutter, solange dein Kind dich braucht. Ist das Kind erwachsen, wirst du aus dieser Zuständigkeit entlassen. Die Aufzucht der Nachkommen und deren Ansprüche haben ein Ende. Das erwachsene Kind kann für sich selbst sorgen und übernimmt alleine die Verantwortung für sich. Die Beziehung ist jetzt eine andere. Kindsein und Muttersein haben einen End-Punkt.
Die grundlegende Idee dahinter heißt: Erst bist du Mensch, dann Frau, dann Mutter. Ist die Zeit gekommen, in der das Kind für sich selber sorgen kann, kehrt die Mutter wieder zu ihren anderen Bestimmungen zurück. Sie ist wieder ganz Frau, was sie vorher natürlich auch war, gemeint ist aber, sie wendet sich ganz ihrem Leben, ihrem Mann und der Gemeinschaft zu. Sie ist ganz Mensch – mit allem, was Menschsein von der ersten Stunde bis zum Tod eben ausmacht: Freude, Schmerz, Unzulänglichkeiten, Fähigkeiten, Begabungen, eigene Wünsche und Ziele. Einfach Mensch. Die Rolle der Mutter ist zeitlich begrenzt. Mit ihrem Ende beginnt auch für die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ein neuer Abschnitt: Einer Begegnung zwischen Frau und Frau, zwischen Mensch und Mensch, wird hier die Tür geöffnet.
Keine Bindung prägt uns mehr
Zweifellos gibt es eine Ebene, die nicht kulturabhängig, sondern universell ist. Sie macht die Beziehung zwischen Mutter und Kind zu etwas Einzigartigem.
Fangen wir am Ursprung an. Dass wir auf so magische Weise denken, unsere Mutter sei schon immer erwachsen gewesen, hat natürlich mit dem existenziellsten aller Gründe zu tun. In ihr hat unser Leben begonnen. Unser Start ins Leben ist auf engste Weise mit ihr verknüpft. Mit niemandem waren wir so zutiefst verbunden, wie mit ihr – und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt Teil unseres Alltags ist oder wir sie Jahre nicht gesehen haben. Selbst wenn die Konflikte unüberwindbar erscheinen, hat diese Verbindung eine Dimension, die der Verstand kaum fassen kann. Aus den Lebensgeschichten vieler Adoptivkinder ist bekannt, wie existenziell das Wissen um die eigene Herkunft, wie tief die Verbundenheit ist. Folgende kleine Geschichte macht deutlich, wie die Fäden zusammengehören, selbst wenn der Bruch noch so schwerwiegend war:
Es geht um eine junge Frau, sie wurde als Säugling von ihrer Mutter zur Adoption gegeben. Bei ihren neuen Eltern hat sie es wirklich gut. Diese junge Frau entwickelt eine Leidenschaft – und die heißt Schweden. Seit Jahren sammelt sie alle Informationen über das Land, es ist fast wie eine fixe Idee. Sie plant sogar, nach Schweden überzusiedeln und dort zu leben, obwohl es ihr in Deutschland an nichts fehlt. Man könnte auch sagen, sie muss nichts missen – aber sie vermisst. Sie vermisst nichts mehr als die Wahrheit über ihre Herkunft. Es kommt der Tag, an dem jedes Kind, das adoptiert wurde, das Recht hat, zu erfahren, wer die Mutter ist. Sie geht also aufs Amt, bittet um Einsicht in die Akten und kann es kaum glauben – ihre Mutter, damals selbst fast noch ein Kind, hat Deutschland unmittelbar nach ihrer Geburt verlassen. Es zog sie nach Schweden, wo sie bis heute lebt.
Die Bindungsforschung, die sich mit der frühen Beziehung von Mutter und Kind – Jungen wie Mädchen – beschäftigt, gibt uns Aufschlüsse über die weitreichende Bedeutung dieser Verbindung: Allan N. Schore, Professor für Psychologie und Bioverhaltenswissenschaft, schreibt: »Eines der grundlegenden Probleme – nicht nur der Psychoanalyse, sondern der gesamten Wissenschaft – offenbart sich in der Frage, warum frühe Lebensereignisse einen solch übermäßigen Einfluss auf wirklich alles haben, was danach folgt.«
Das früheste Lebensereignis liegt jenseits unserer Erinnerung. Und dennoch: Die Biographie beginnt im Bauch unserer Mutter. Damals waren wir nicht nur physisch, sondern auch psychisch mit ihr verbunden. Was die Mutter in der Zeit der Schwangerschaft berührt, beeinflusst das Kind. Ist die Mutter beunruhigt, reagiert das Ungeborene mit Beunruhigung. Ist sie ruhig und ausgeglichen, ist auch das Kind in Balance. Sind wir dann auf der Welt, ist sie unser Spiegel, in dem wir »sehen«, wie das Leben, das Kommunizieren und vor allem das Fühlen funktioniert. Als Kind sind wir fortwährend in Resonanz mit ihr, schwingen uns auf ihren Gemütszustand ein. Dabei haben wir keine Wahl, denn unser Bedürfnis nach der Verbindung mit ihr ist sehr, sehr stark. Ganz gleich, was die Mutter uns anbietet, wir werden auf ihre Befindlichkeit reagieren. Und von ihr lernen, wie Bindung und damit Beziehung funktioniert. Als Tochter werden wir bereits in frühen Jahren erleben und sehen, wie sie sich auf den Vater und auf Männer überhaupt bezieht – auch das prägt.
Die innere Blaupause – unsere Beziehungsbrille
Ich werde noch ausführlich darauf eingehen, wie bedeutsam die frühe Verbindung für unser ganzes Leben ist. Wichtig ist mir an dieser Stelle, dass wir mit und über die Mutter lernen, wie wir uns auf andere Menschen beziehen. Die Bindungsforschung nennt es das innere Arbeitsmuster oder die Blaupause, die im ersten Lebensjahr geprägt wird. Es ist das Muster, das bestimmt, wie wir den Kontakt zu anderen herstellen und wie wir uns dabei fühlen. Das Wort Blaupause erinnert mich an die Zeiten des Flugblätterschreibens. Damals tippten wir radikale Worte auf eine Wachsmatrize, die dann die Folie für unzählige Abzüge des immer gleichen Textes waren. Blaupause meint also den inneren Text mit dem wir in die Beziehungswelt ziehen und entsprechend wieder und wieder handeln. Es ist die Färbung der Brille durch die wir unsere Umwelt sehen.
Die gute Nachricht
Dieser erste kleine Ausflug in die Bindungsforschung gibt uns eine Idee davon, wie hochwirksam die Verbindung zur Mutter ist und wie nachhaltig sie sich auswirkt. Einer Tochter, deren Kontakt mit der Mutter schwierig ist und die immer wieder mit Beziehungsproblemen kämpft, kann das schon mal Schluckbeschwerden bereiten. Deshalb gleich im Anschluss die gute Nachricht. Dazu zitiere ich noch einmal Allan N. Schore, er gehört zu den führenden Wissenschaftlern, die die Wechselwirkung zwischen den neurobiologischen Vorgängen im Gehirn und menschlicher Begegnung erforschen. »Verändere dein Bewusstsein und du veränderst dein Gehirn.« Sagt er, und meint damit, dass wir Zeit unseres Lebens in der Lage sind, unser Gehirn und unser Nervensystem in Bezug auf Bindung und Beziehung zu verändern. Korrekturen an diesem inneren Arbeitsmodell sind in jedem Alter möglich. Jede Partnerschaft, auf die wir uns so, wie wir sind, wirklich einlassen, jede intensive Freundschaft, aber auch jedes gute Gespann von Klient und Therapeut fördert die Veränderung der erlernten Muster. In meinen Worten klingt das so: Heilung ist möglich.
Wie die Schneeflocken
Je tiefer ich in die Thematik eintauche, desto häufiger stelle ich mir die Frage: Wie ist es möglich, all das, was sich zwischen Müttern und ihren Töchtern abspielt, in nur ein Buch zu bringen? All die Erfahrungen sind so individuell, haben ihre ganz eigene Stimmung, ihre eigene Dynamik. Die Geschichten von Freundinnen klingen erstaunlich bekannt und gleichzeitig fremd. Wenn unsere Mutter über ihre Mutter erzählt, ist es, als sei die eigene Großmutter ein unbekanntes Wesen und die Sichtweise von Schwestern auf ihre Mutter kann so verschieden sein, dass man den Eindruck gewinnt, es handle sich dabei um zwei verschiedene Frauen. Jede Mutter-Tochter-Beziehung ist ein Unikat!
Lässt sich bei all der Vielschichtigkeit überhaupt etwas Gemeinsames finden? Gibt es eine allgemeingültige Struktur? Ich glaube ja. Sie lässt sich mit dem vergleichen, was wir über die Schneeflocken wissen: Keine Schneeflocke wird jemals exakt einer anderen gleichen. Sie bilden die unterschiedlichsten Kristallstrukturen – und trotz dieser endlosen Formenvielfalt haben sie in ihrem Grundmuster und in ihrer Substanz Wesentliches gemeinsam: Jede Schneeflocke bildet eine sechseckige Grundform und sie besteht aus Wasser.
Das Gemeinsame, das Wasser, das Mütter und Töchter verbindet, hat immer – und manch eine Leserin wird jetzt zurückschrecken – es hat immer mit Liebe zu tun. Im Zentrum steht nur eine Frage: Kann sich die Liebe zwischen beiden ausdrücken? Kann sie frei fließen oder kann sie es nicht? Ist die Beziehung warm, offen, freilassend und akzeptierend? Oder fließt diese Wärme, das Wasser nur spärlich – vielleicht sogar überhaupt nicht? Ist dieser Fluss gehemmt, dann bildet sich ein Stau, ein Damm, hinter dem sich Wut auftürmt, Vorbehalte, Anklagen, Unoffenheit, Konkurrenz, Ohnmacht und Sehnsüchte.
Nicht selten haben Töchter das Gefühl, ihre Aufgabe sei die der »Wasserträgerin«, der Teil, der die Beziehung trägt. Sie sind besorgt, kümmern sich aufopferungsvoll und fühlen sich verantwortlich. Sie halten die Mutter aufrecht und manchmal sogar im Leben.
Die zweite Gemeinsamkeit ist die Grundform, die Struktur beider ist die gleiche. Es klingt banal und ist doch folgenreich. Wie immer die Tochter zu ihrer Mutter steht, beide sind Frauen! Beide stecken in einem weiblichen Körper, sie leben mit dem Zyklus, den Hormonen, ihren weiblichen Emotionen. Sie wissen um ihre Position in der Gesellschaft. Sie sind beschäftigt mit Körper, Wirkung, Aussehen. Sie sind Frauen!
In den Grundthemen sind Mutter und Tochter sich so nah und so verwandt. Und gerade dieses Verbindende macht es besonders schwierig. Es geht dabei um die Frage: Wie kann die Tochter trotz der gemeinsamen »Grundform« zu ihrer eigenen Form, ihrem persönlichen Lebensausdruck, ihrer ureigenen Weiblichkeit kommen? Wie kann sie in der Auseinandersetzung mit dem Gleichen, dem so Vertrauten, das Eigene finden?
Nur nicht so werden wie meine Mutter
Das Ringen um das Eigene, um die Abgrenzung von der Mutter, scheint nie zu enden, auch nicht für die 60-jährige Tochter. Sie klagt im Familienkreis mal wieder über die furchtbaren Macken ihrer 86 Jahre alten Mutter: »Kinder«, sagt sie, »wenn ich mal so werd wie Oma, dann sagt mir aber Bescheid!« Die Familie schaut sich an und lacht: Es ist ja schon lange so! Der Apfel ist bereits vom Stamm gefallen – und gar nicht weit.
»Manchmal erschreckt es mich, wenn ich merke, ich bin wie sie«, sagt Dagmar, 50 Jahre. »Es fühlt sich mit meiner Mutter so an, als habe ich nur äußerlich Zuwendung bekommen. Dieses Versorgtwerden, Putzen, Kochen, immer propper und gut ernährt. Aber es hat sich innerlich nicht wie Zuwendung angefühlt. Es war nicht warm zwischen uns. Und obwohl ich das weiß, mache ich es auch. Ich kümmere mich auch ums Äußere. Wenn Freunde kommen, fange ich auch an, sauber zu machen, schau, dass alles in Ordnung ist, anstatt mich zu entspannen und zu realisieren: Die mögen mich und nicht mein geputztes Badezimmer.«
Wenn ein guter Start gelingt
Kommen wir zurück auf das »Etwas«, darauf, was die Mutter trotz ihres Wunsches nicht geben und die Tochter trotz all ihres Sehnens nicht bekommen kann. Um zu verdeutlichen, was ich damit meine, scheint es mir an dieser Stelle richtig, von der gelungenen Mutter-Tochter-Beziehung zu sprechen. Der Tochter, die in ihren ersten Lebensjahren mit allem, was sie brauchte gut ausgestattet wurde: Dazu gehören Nähe, Zuwendung, Zärtlichkeit und Schutz, Wertschätzung, Grenzen und Freiheit. Mutter und Vater konnten ihre Ehekonflikte bei sich belassen und mussten das Kind nicht in ihre Angelegenheiten hineinziehen. Und wahrscheinlich konnte die Mutter gut die Kämpfe der Pubertät aushalten, in der die Tochter ihr eigenes Frausein entdeckte.
Ich selber kenne nur sehr wenige Frauen, die das so erlebt, ein wirklich ausgeglichenes Verhältnis zu ihrer Mutter haben. Meine Wahrnehmung von ihnen ist so: Sie sind unprätentiös und warm, geben sich nicht den Anschein von Wichtigkeit, müssen nicht blenden, wirken eher bescheiden und sind sich fraglos ihrer Weiblichkeit bewusst. Sie haben bemerkenswert wenige Reibereien mit ihrer Mutter. Weder idealisieren, noch verurteilen sie sie, sondern schauen realistisch auf Mutters menschliche Unzulänglichkeiten und Macken. Sie sind mit ihr im Reinen. Vielleicht der wesentlichste Punkt: Sie sind mit ihrer Mutter liebevoll verbunden und nicht an sie gebunden.
Ihr inneres Arbeitsmodell beinhaltet ein grundsätzliches »Ja«. Ein Ja zum Nehmen und ein Ja zum Geben, und gibt es mal nichts, ist das kein Drama. Sie schauen wohlwollend auf andere und auch auf sich selbst. Psychologen würden es vielleicht so beschreiben: Diese Frauen hatten eine verlässliche Bindung, einen sicheren Hafen, an dem sie immer wieder andocken konnten – auch, wenn es brenzlig wurde. Sie waren in ihrer Kindheit gut aufgehoben, bekamen Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit. Sie sind einfach satt. Ihr Selbstwert ist gestärkt. Ganz entscheidend ist: Sie sind autonom. Vor allem in ihren Beziehungen sind sie unabhängig von Zuwendung und Liebesbeweisen. Diese Frauen fragen sich nicht fortwährend: »Liebt er/sie mich?« Sie haben die innere Gewissheit, dass sie liebenswert, also der Liebe wert sind. Sie ruhen in sich. Ihr »Gefäß«, das heißt, ihr Körper ist mit Liebe angefüllt und sie geben sie bereitwillig weiter, ohne sich dabei auszulaugen.
Klingt gut, oder? Denn: Eine »sättigende« Beziehung zur Mutter bewahrt weitgehend vor einem Mangelgefühl. Die Frauen, die das bekommen haben, fühlen sich »rund« mit sich selbst. Ihr inneres Gefäß ist gefüllt und sie erwarten vom Partner nicht ständig, dass er es auffüllen möge.
Mit Mama ist alles super … oder?
Neulich hörte ich im Radio eine Therapeutin sagen: »Es geht immer um die Liebe. Alle Menschen, die zu mir kommen, haben im Kern eine Frage: Hat meine Mutter mich wirklich geliebt?«
Das ist absolut richtig, ich sehe jedoch, dass vor dieser Frage bei den meisten Menschen noch etwas anderes steht. Denn stellen wir die Frage nach der Mutterliebe, dann ist uns ja schon klar, dass wir daran einen Zweifel haben. Sich das einzugestehen, ist nicht so leicht. Davor kommt eben meist eine Vorstufe, die ich die »Gloriastufe« nenne. Sie klingt ungefähr so: »Ich komme mal wieder mit meinem Partner nicht klar. Nie gibt er mir, was ich brauche. Er versteht mich einfach nicht! … Meine Mutter …? Ich verstehe die Frage nicht? Was soll mit ihr sein? Mit Mama ist alles super!« »Gloria, Mama!« sagen wir, nichtsahnend, dass die Bedürftigkeit nach Zuspruch, Zuwendung und Anerkennung etwas Altes ist und bereits lange da war, bevor er, der Partner, überhaupt auf der Bildfläche erschien.
Wir verschieben sozusagen das Empfinden, dass uns etwas fehlt, schmerzt oder kränkt auf unsere Partner, Freundinnen, Kollegen oder gar auf unsere Kinder. Wenn also Frauen sagen: »Meine Beziehungen sind schwierig, aber mit meiner Mutter oder meinen Eltern ist alles super«, ist das mehr als verständlich, denn es ist nicht leicht zu sehen oder sich einzugestehen, dass es da ein Leck mit der Mutter gab und gibt. Das ist ein sehr schmerzhaftes Erkennen, weil die Basis ins Schwanken gerät. Man will es gar nicht wahrhaben. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen ich wie ein Rohrspatz auf meine Eltern geschimpft habe, ich konnte mich wirklich ereifern, aber sobald ein anderer dem zustimmte und mir bestätigte, wie furchtbar meine Eltern seien, war ich ganz fassungslos, fand es ungerecht und empörend so über meine Eltern zu reden. Irgendwie war ich dem Schmerzlichen treu.
Steigt dann doch eine Ahnung davon auf, dass es etwas gibt, was man vermisst, folgt der ersten Fassungslosigkeit die Wut. Es gibt unglaublich viel Wut auf die Mütter. Mal wird sie offen ausgetragen, meist aber wird sie versteckt. Hier eine Variante:
»Meine Mutter metzelt mich nieder«, erklärt die 42-jährige Karin,»ich kann nicht mit ihr zusammen sein. Manchmal spüre ich so eine Wut auf sie und hab dann Angst, dass es mich zerreißt. Aber ich will diese Wut nicht. Wenn dieser Ärger aufsteigt, bin ich meiner nicht mehr mächtig. Diese Ohnmacht ängstigt mich und ich will da auf keinen Fall hin.«
Karin ist gewohnt die Wut »wegzupacken«. Nur – wohin? Wegpacken heißt in so einem Fall ja nicht: »Ab in den Kleiderschrank!« Das wird nicht funktionieren. Natürlich bleibt die Wut als Ladung, als Hochspannung im Körper stecken. Wie eine Tigerin im Käfig hockt sie da. Und diese Tigerin wird sich zeigen, getarnt wie ein Chamäleon – zum Beispiel als »Schaffen und Schaffen bis zum Umfallen«. Oder sie bricht von Zeit zu Zeit als Wutanfall aus ihrem Käfig aus. Mag sein, sie zeigt sich als Symptom: als Schmerz im Kopf, im Rücken, in Galle oder Magen. Karin beschreibt, dass es für sie ungefährlicher ist, die Tigerin in Bann zu halten, als an die Wurzel der Wut zu gehen, denn dort könnte es etwas geben, das noch bedrohlicher zu sein scheint. Also tigert sie weiter herum.
Zeigen Töchter ihre Wut und schicken sie an die »richtige« Adresse, so wird die Mutter nur schwerlich in der Lage sein, das anzunehmen – sie wird eher selber wütend und weist alles zurück: »Willst du etwa …« Sie versteht gar nicht worum es geht und steht fassungslos vor den geballten Vorwürfen. Aus ihrer Sicht will und wollte sie der Tochter niemals etwas antun, was diese Wut begründen könnte. So gerät die Beziehung zwischen den beiden ins Stocken, nichts geht mehr. Ich kenne einige Töchter, die über Jahre in Wut feststecken. Und ich kenne Töchter, die einfach nur traurig, verzweifelt oder resigniert sind, weil sie nicht mit ihrer Mutter reden und sie nicht erreichen können.
Wut und Trauer sind verwandt, sind Schwestern, mal zeigt sich die eine, dann wieder die andere. Beide kommen aus dem brodelnden Topf der Gefühle, nicht richtig geliebt, nicht richtig erkannt und folglich für die Mutter nicht richtig zu sein.
Klagen mildert den Schmerz
»A good complaint will take away the pain«, sagt Carola Castillo, eine systemische Familien-Therapeutin aus Venezuela. Frei übersetzt bedeutet das: Klagen nimmt den Schmerz. Dieser erstaunliche Satz beschreibt, aus welcher Substanz die Vorwürfe sind. Zunächst einmal ist das Meckern ein ganz menschliches Phänomen. Über unerträgliche Mitmenschen zu schimpfen und zu stänkern, entlastet und gehört zu einer notwendigen sozialen Regulation. Auch das Zetern und Meckern gegen die Mutter hat eine entlastende Funktion. Aber es ist eine andere Baustelle, denn dabei geht es um unser eigenes Fundament. Unsere Basisstation zu verleugnen, hieße, einen wesentlichen Teil von uns selbst zu verleugnen. Das Klagen scheint ein guter Ausweg zu sein. Hinter den versteckten, den offenen, den leisen oder bitteren Vorwürfen liegt der Schmerz des Mangels versteckt. Und es ist wirklich bitter zu spüren, was unter der Wut und den Beschwerden vergraben liegt. Wenn wir dorthin fühlen, dann wird es ernst. Dann kommen wir genau an den Schmerzpunkt, den wir immer vermieden haben, egal, ob das Mittel unserer Wahl die Glorifizierung, das Verstecken der Gefühle, vor sich hinbrodelnde Wut oder eine nie endende Kaskade von Vorwürfen ist.