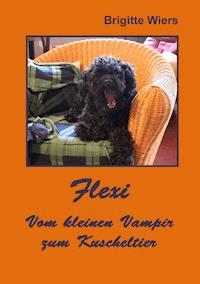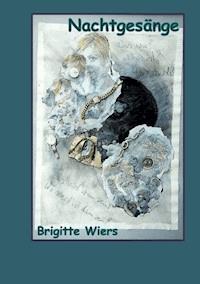Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Episoden der Kriegsjahre aus dem Roman "Wer wohnt schon in der Ziethenstraße?" Wie war das noch während des Krieges und den folgenden Nachkriegsjahren? Brigitte Wiers kam 1930 in Gelsenkirchen als jüngstes von sechs Kindern zur Welt. Sie hat in diesen schwierigen Zeiten ihre Kindheit und Jugend erlebt. In ihren Erinnerungen haben sich die Bombennächte - vor allem im Ruhrgebiet - mit ihren Schrecken eingegraben. Auch die Einberufung der Brüder und ihrer Freunde an die Front erlebte sie als einen Albtraum mit. Doch das Leben ging weiter mit all seinen Wünschen, Träumen und Hoffnungen, aber auch mit Entbehrungen und Ängsten, mit Trauer, Verzweiflung und Wut. Und dann die Nachkriegszeit: Vieles war zerstört, vieles musste neu aufgebaut werden. Nur langsam kehrten die ehemaligen Soldaten aus der Gefangenschaft zurück, so manche aber sollten nie wiederkehren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Das Ende der Beschaulichkeit
Mutter, was ist Krieg?
Die braune Saat
Lavinia - das Zigeunermädchen
Wie Braunchen im Löschwasser ertrank
Abschied von Papa
Der den gelben Stern trug
Von großen und von kleinen Tieren
Bomben, Zweifel und Parolen
Eine Schule zieht nach Bayern
Dieses Lagerleben
Die Stille des Waldes
Post von Daheim
Tadle nie die Briefe der Soldaten
Bombennächte im Revier
Graf Luckner, der „Seeteufel“
Morsen für Deutschland
Die Amis kommen.
Rückkehr ins Revier
Krempeln wir die Ärmel hoch
Wie viele Taschen braucht das Land?
Die Rückkehr der Brüder
Hühner, Gänse und Gemälde
Das Paradies des Malers
Die lieben Verwandten
Meine Schule und ich
Wenn der weiße Flieder wieder blüht
Mein erstes Meeting
Schule ade – was nun
Die verflixten Milchmarken
Tante Luise und die Stadt
Milena und das Tor zum Westen.
Als Gastarbeiterin nach England
In Zeiten des Krieges
ich sah, ich kam, ich hörte
und wusste doch von nichts
zu gut waren die Lügen verpackt
und die Wahrheit eingesackt
Das Ende der Beschaulichkeit
Dieser Sommer war anders als jeder andere, auf den ich mich besinnen konnte. Ich spürte, dass eine Veränderung vor sich ging und kam aus der Aufregung nicht heraus. Doch was hinter dieser Aufregung stand, konnte ich zunächst nicht ergründen. Der Sommer des Jahres 1939 war ein heißer Sommer, und es herrschte eine trügerische Idylle – die Ruhe vor dem Sturm.
Papa hatte als Malermeister einen größeren Auftrag erwischt, der endlich mehr Geld in unsere letztlich recht magere Haushaltskasse brachte. Nun könnte er es sich endlich leisten, wenigstens einen Teil der Familie in Urlaub zu schicken. Ja, der Mama merkte man schon an, dass sie als Geschäftsfrau und als Mutter von sechs Kindern mal ein wenig Ruhe nötig hatte, und den Papa plagte seine alte Krankheit mehr denn je. Was lag da näher, als wenigstens einige seiner Kindern während der Schulferien aufs Land zu schicken, damit er und Mama sich mal drei Wochen lang zu Hause erholen konnten, denn den Malerbetrieb einfach zu schließen und einen gemeinsamen Familienurlaub zu starten, das lag doch nicht drin.
Um Miriam, meine ältere Schwester, brauchten die Eltern sich keine Gedanken machen – sie absolvierte gerade ihr hauswirtschaftliches Jahr in einem Kinderheim in Bielefeld, und mein Bruder Hans, der seit einiger Zeit eine Klosterschule für Behinderte in Assmannshausen besuchte, hatte seine Schulferien, die dort früher begonnen hatten, bereits zu Hause verbracht. Inzwischen war er wieder ins Internat zurückgekehrt. Es ging also nun darum, zu überlegen, wo meine Brüder Konni und Georg und meine Schwester Anna und ich, ihre kleine Schwester Eva, die Ferien verbringen konnten.
Papa studierte eifrig die Zeitschrift „Wald und Feld“, in der zur Sommerzeit häufig Ferienplätze für Kinder angeboten wurden. Die Schulferien auf dem Lande zu verbringen, müsste doch herrlich sein für seine Trabanten, die hier in Gelsenkirchen – der Stadt der tausend Feuer – kaum grüne Flächen mit lebendiger Natur kannten. Und siehe da, Papa wurde fündig. Da bot ein Förster im Sauerland gleich zwei Ferienplätze an. War das nicht was für seine großen Jungen? „Toll“, meinten die, „da dürfen wir sicher mal mit auf die Jagd gehen und vielleicht sogar einen echten Bock schießen.“
Ja, und nicht weit vom Forsthaus entfernt, gab es einen Bauernhof, auf dem Anna Ferien machen konnte, denn dort suchte man ein schon etwas größeres Ferienkind. So weit, so gut! Doch was blieb für mich übrig? Wie gerne hätte ich zusammen mit meiner Schwester den Urlaub verbracht, aber für ein neunjähriges Mädchen wie mich gab es dort kein Angebot. Dabei fand die Mama, dass gerade ich Ferien auf dem Lande besonders nötig hätte„ denn ich sähe in letzter Zeit doch sehr blass aus.
„Keine Sorge“, meinte Papa, für dich werden wir auch noch einen guten Urlaubsplatz finden. Ach, ich glaube, hier ist was für dich. Also, wie findest du das?“
„Bauernhof im Bergischen Land,
wo es noch glückliche Tiere gibt,
bietet Ferienplatz zu günstigem Preis.“
Das hörte sich doch recht verheißungsvoll an, und so fieberte auch ich meiner Traumreise entgegen. Endlich raus aus der Stadt und hinein ins Landleben mit vielen schnuckeligen Tieren, Stallgeruch und Strohlager!
Nun, jener Sommer 1939 war ein richtiger Schön-Wetter-Sommer, und als Anfang August die Schulferien in Westfalen begannen, schien die Welt trotz leichten Rumorens noch in Ordnung zu sein. Mama hatte für meine Brüder, meine Schwester und mich je ein Köfferchen gepackt, und gemeinsam fuhren wir mit dem Zug zunächst ins Sauerland. Unser erstes Ziel war das Forsthaus bei Berleburg. Das Tal - in dem die Försterei lag - war eingebettet zwischen Hügeln und Bergen. Die Wälder rundum waren dunkel und dicht. Hier könnte Rotkäppchen dem bösen Wolf begegnet sein. Unvermittelt tauchte das idyllische
Forsthaus vor uns auf. Über dem Eingang hing majestätisch ein riesiges Hirschgeweih. Und während wir noch unsicher durch den Vorgarten auf das Haus zugingen, öffnete der Hausherr bereits die Tür, um uns zu begrüßen. Freundlich bat er uns ins Haus. Das Stübchen mit seiner niedrigen Holzdecke und den schlichten Holzmöbeln heimelte mich an. Wir nahmen auf dem Sofa Platz und tranken frischen Kräutertee. „In stillen Nächten, wenn der Mond hell scheint“, erzählte der Förster, „kommt das Wild auch schon mal auf die Wiese vors Haus. Wir haben sogar ein zahmes Reh hier, das Gretchen. Es hatte seine Mutter verloren. Da mussten wir es mit der Flasche aufziehen.“
Meine Brüder starrten den Förster voll Bewunderung an. Unter seinem Blick wurden sie zahm wie Lämmer. Oder sollte ich besser sagen, zahm wie Rehe? Dabei ahnte ich schon, dass es nicht lange dauern würde, bis sie sich wieder in wilde Böcke verwandelten. Ach, wie beneidete ich meine Brüder darum, dass sie in diesem Paradies ihre Ferien verbringen durften.
Meine Reise jedoch ging vom Forsthaus aus mit Mama und meiner Schwester zunächst weiter zu dem kleinen Bauernhof in der Nähe von Berleburg, wo Ulla bereits von einem freundlichen Ehepaar erwartet wurde. Der Hof machte einen guten Eindruck. Durch die geöffneten Stalltüren sah man starke Ackergäule mit glänzendem Fell in frischem Heu staksen. Neben dem Hof breitete sich ein wogendes Kornfeld aus, dessen Gold-Gelb nur unterbrochen wurde vom leuchtenden Rot des Klatschmohns an seinen Rändern.
Ja, genau so hatte ich mir einen Bauernhof vorgestellt. Würde mein Ferien-Domizil ebenso idyllisch sein? Anna jedenfalls hatte Glück! Sie wurde mit großer Herzlichkeit von ihren Gasteltern empfangen und erhielt gleich die Erlaubnis, sich überall auf dem Bauernhof frei bewegen zu dürfen. „Wenn du möchtest, nehmen wir dich gern mal mit zum großen Teich, um dort Forellen zu fangen“, boten ihr die Söhne des Bauern an.
Die Aussicht auf solche Abenteuer machte Anneken glücklich und mich ein wenig neidisch. Zu gerne wäre auch ich auf diesem Hof geblieben, doch davon wollte Mama nichts wissen.
„Das geht nicht“, sagte sie, „schließlich haben wir der Familie im Westerwald zugesagt, dass du während der Ferien zu ihnen kommst. Und was man verspricht, das muss man halten.“ Ich war enttäuscht und zog ein langes Gesicht. Doch schließlich tröstete mich der Gedanke, dass es ja auch auf meinem Bauernhof Pferde und Kühe geben würde. „Also lass uns weiterfahren, Mama“, sagte ich, und so fuhren wir los.
Diesmal saß ich mit Mama allein im Abteil. Der Zug ratterte gleichförmig dahin, während draußen die Landschaft sich zusehends veränderte. Hatte mich zuvor im Sauerland der Wechsel von Bergen und Tälern, Wäldern und Feldern mit dazwischen gestreuten malerischen Dörfern entzückt, so sorgte jetzt eine trostlose Eintönigkeit bei mir für eine gedrückte Stimmung. Das Land wurde flacher, die einzelnen Gehöfte lagen weit auseinander, Feld reihte sich an Feld. Es fehlten die grünen Wälder, die bunten Hecken, die malerischen Hügel. Ich entdeckte kaum etwas, das mein enttäuschtes Gemüt streichelte. Endlos zog die Ebene an uns vorbei, ratterte der Zug weiter. Wann waren wir am Ziel? Wo war die Endstation? Der Zug hielt so oft an irgendwelchen unbedeutenden Orten mit unbekannten Namen. Irgendwann hieß es dann endlich: „Wir sind da, hier müssen wir aussteigen.“
Mama und ich waren die einzigen Passagiere, die nun den Zug verließen. Rund um den kleinen Bahnhof breitete sich Ödnis aus. Von der viel besungenen Schönheit des Westerwaldes entdeckte ich in diesem Randgebiet keine Spur. Neben dem ungesicherten Bahngleis stand regungslos eine Frau mit seltsam abgehärmten Gesichtszügen. Trotz der Hitze des Tages trug sie ein knöchellanges graues Baumwollkleid und derbe Schnürschuhe. Um die Haare hatte sie ein dunkles Kopftuch gebunden, das fast ihre Augen verhüllte. Als wir uns suchend umschauten, kam sie langsam auf uns zu. Ihr Mund war schmal wie ein Strich. Bei ihrem Anblick stockte mir fast der Atem.
„Das ist sicher unser Ferienkind“, brummelte sie mit rauer Stimme. Dabei klapperten ihre falschen Zähne geräuschvoll aufeinander. „Na, denn kommen Se man“, forderte sie uns auf und führte uns zu einem Leiterwagen. „Klettern Se man da hoch, ich fahr Sie dann zum Hof meiner Schwester.“
Mühsam krabbelten Mama und ich mit unserem Gepäck auf den grob zusammen geschusterten Karren, die Frau knallte mit der Peitsche, das Pferd wieherte und der Wagen holperte beschwerlich den ungepflasterten Feldweg entlang. Wir hielten vor einem wenig einladenden alten Backsteinbau an einer staubigen Straße. Hier also sollte ich während der nächsten drei Wochen meine Ferien verbringen? Der Rasen vor dem Haus war ungepflegt und von der Sonne verbrannt. Zu beiden Seiten der Steinstufen, die zur Eingangstür hinauf führten, standen zwei jämmerliche Rosensträucher. Unsere Gastgeberin, Frau Wunderlich, die ähnlich hart wirkte wie ihre Schwester, öffnete die Tür und führte uns zu einem altmodischen Sofa, auf dessen Armlehnen zwei ehemals weiße Spitzendecken prangten. Sie selbst setzte sich uns gegenüber auf einen der harten Holzstühle, den Rücken gerade gestreckt und starrte uns herausfordernd an. In allen vier Ecken des Raumes standen kleine Tischchen, auf denen es von Nippesfiguren wimmelte. Nicht ein Fenster war geöffnet. „Von wegen der Fliegen“, sagte die Frau. Was sollte das heißen: „von wegen der Fliegen“? In diesem Raum surrte es ja nur so von diesen kleinen Viechern. Sollten die etwa nicht raus? Die Luft roch nach Staub und frisch gekochten Bohnen. Ein fetter, alter Kater kam durch die Tür geschlichen, beäugte uns und schlich miauend wieder raus. Ob er draußen Mäuse fängt? dachte ich. Besser wäre es ja, er würde hier drinnen Fliegen fangen.
„Wollen Se sich mal mit ihrer Tochter draußen umsehen?“ fragte die Frau. Mama und ich folgten nur allzu gern dieser Aufforderung, schon um der trostlosen Stimmung des Hauses zu entgehen. Am Himmel standen vereinzelte Lämmerwölkchen; eine hing direkt über dem Kirchturm neben dem Friedhof, wo sich die Eidechsen zwischen den Gräbern in der Sonne wärmten. Die Mittagshitze schien jeden Laut zu unterdrücken. Die Hähne schwiegen. Die Schweine dösten. Die Pferde standen mit gesengtem Kopf im spärlichen Schatten. Lautlos strich eine Katze aus der Tür und streckte sich mit hochgezogenem Buckel. Alles war leise, nicht einmal die Hühner gackerten. Nur in den Ästen der Weide gurrten einige Wildtauben. Aus der aufgesperrten Küchentür kroch muffige Wärme und auf dem Herd klapperte der Kochtopfdeckel über brodelnden Blasen.
„Das Essen ist fertig“, rief die Hausfrau, und gehorsam betraten wir wieder die Stube. Ein großer Schatten schlich mit uns ins Haus. Es war der Hofhund. Sein Äußeres war ruppig, das Fell struppig und zerfetzt. Ein Ohr war sozusagen futsch. Wohin? Das weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, wann und wo ihm sein rechtes Auge abhanden gekommen ist. Den Namen aber, den hatte er weg – „Einaug“ hieß er und das zu Recht. In was für ein Horrorhaus war ich nur geraten? Wie sollte ich es hier drei Wochen lang aushalten? Ich war drauf und dran, der Mama zu sagen, mich gleich wieder mit nach Hause zu nehmen, da erschien im Türrahmen ein junges Paar – er, der Sohn der Bäuerin, ein Mann mit freundlichem Gesicht, sie, eine junge Frau mit lachenden Augen und lustigen Grübchen in den Wangen. „Hallo“, riefen die beiden fröhlich, „endlich kommt frisches Leben in dieses Haus. Du bist sicher das Ferienkind, nicht wahr? Also, dann herzlich willkommen.“
Bei dieser freundlichen Begrüßung wurde mir richtig warm ums Herz. Und als Mama sich wenig später von mir verabschiedete, da glaubte ich, dank des jungen Paares doch noch schöne Ferien auf diesem Hof erleben zu können. Zu meiner Enttäuschung aber fuhren der Sohn und die Schwiegertochter gegen Abend wieder fort. Von da an war ich die ganzen Tage allein mit der stets mürrisch dreinblickenden Bäuerin. Den Bauern - einen alten, schweigsamen Mann - bekam ich kaum zu Gesicht. Nachbarkinder ließen sich auf diesem Hof nicht blicken, das nächste Gehöft lag allzu weit entfernt. Ich langweilte mich schrecklich. Damit ich jedoch nicht auf dumme Gedanken kommen sollte, wurde ich von der Bäuerin dazu verdonnert, jeden Tag bei anhaltender Sonnenglut draußen vor dem Haus Bohnen zu pflücken, Bohnen, Bohnen, nichts als Bohnen! Sie waren wohl das einzige essbare Grünzeug, das der verwilderte Garten hergab. Und nach dem Abrupfen musste ich die Bohnen schnibbeln - Bohnen, Bohnen - nichts als Bohnen! Bohnen fürs Mittagessen, Bohnen zum Einkochen, Bohnen für den Schweinetopf.
Wären wenigstens Tiere da gewesen, mit denen ich mich hätte anfreunden können. Doch der Kater war ein Einzelgänger, die Katze ließ sich nicht streicheln, der Hund wich jeder Berührung aus, das einzige Pferd dort musste ständig den Pflug ziehen, und die Kühe blieben Tag und Nacht weit draußen auf ihrer Weide. Statt der erhofften Kuscheltiere fanden sich nur die lästigen Fliegen ein. Zu jeder Mahlzeit kam eine Unzahl dieser kleinen Ungeheuer und speiste uneingeladen mit. Und eine nicht weg zu scheuchende Heerschar dieser aufdringlichen Biester war offensichtlich darauf aus, mich bei lebendigem Leibe zu verzehren. Sie begnügten sich nicht damit, über die Tischkrümel herzufallen, nein, sie setzten sich auch überall auf meine Haut. Es war, als hätten sie mir den Krieg erklärt. Ich schien ihr bevorzugtes Opfer zu sein. Je mehr ich um mich schlug, desto hartnäckiger wurden ihre Angriffe.
„Verdammt noch mal! Kannst du nicht mal beim Essen stillsitzen?“ schnauzte mich die Bäuerin an. Ja, wie denn? Die verhassten Fliegen ließen mir doch keine Ruhe. Selbst im Schlaf verfolgten sie mich, selbst unter der Bettdecke war ich vor ihnen nicht sicher, mindestens eine von ihnen wählte immer das kleine Stückchen Haut, das von mir als Landeplatz hervorschaute. Ich wurde immer unruhiger, immer zappeliger, hatte keine Spielkameraden, mit denen ich hätte spielen können, keine Tiere, mit denen ich hätte schmusen können. Es gab nur Fliegen, immer und überall Fliegen. Zu allem Überfluss hinterließen sie auf meinem weißen Leinenhütchen - das seit meiner Ankunft einsam an der Garderobe hing - ihre unzählbaren schwarzen Punkte als sichtbare Zeichen: „Seht her, wir waren hier, wir sind die wahren Beherrscher dieses Hauses“. Ja, selbst das Bild der Muttergottes war übersät mit Fliegendreck. „Dat soll die Madonna mal nicht so übel nehmen“, meinte die Bäuerin, „da haben die Fliegen nur ein bissken drauf geschietet.“
Wie sollte ich dieses Haus lieben mit seinen mürrischen Bewohnern und seinen Scheiß-Fliegen? Drei Wochen, Herrgottnochmal, drei solcher Wochen waren einfach zu viel für mich. Als Mama dann unerwartet bereits in der zweiten Woche auftauchte, um mich abzuholen, wurde ich fast närrisch vor Freude. Hatte sie geahnt, wie sehr ich mich nach Hause sehnte? Nein, das hatte die Mama nicht gewusst. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie verwahrlost der Bauernhof wirkte, wie trostlos der Aufenthalt für mich hier gewesen sein muss. Mein ehemals weißes - jetzt schwarz gesprenkeltes Leinenhütchen - ließ sie angeekelt an der Garderobe hängen. Doch warum sie bereits am Tag zuvor meine Geschwister aus ihren Ferienquartieren abgeholt hat und nun auch mit mir vorzeitig nach Hause fuhr, das hat sie erst auf der Heimreise erzählt.
„Weißt du“, sagte sie, und die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus, „der Abt des Franziskaner-Klosters in Assmannshausen, in dem unser Hansel zur Schule geht, hat angerufen und gesagt, wir müssten ihn sofort dort abholen, das Klosterpensionat solle nämlich in ein Lazarett umgewandelt werden. Da wurde mir klar, dass es bald Krieg geben wird, und da wollte ich, dass unsere Familie nun zusammen ist.“
Bei diesen Worten durchlief mich ein Zittern, und im Nachhinein kam mir die entsetzliche Fliegeninvasion in meinem Ferienquartier vor, wie die Ankündigung der Schrecken des kommenden Krieges.
Mutter, was ist Krieg?
Das Ende des Sommers 1939 werde ich nie vergessen! Die drohende Kriegsgefahr wurde immer greifbarer, darum hatte Mama mich ja vorzeitig aus meinem Feriendomizil vom Lande abgeholt. „Mama“, fragte ich sie später, „Mama, was heißt das, es gibt Krieg?“ Darauf hatte die Mama zunächst nicht geantwortet – allzu schrecklich waren wohl die Erinnerungen an den ersten Weltkrieg, die ihr in diesem Moment im Kopf herum wirbelten. Erst später, als der Krieg tatsächlich begonnen hatte, brach es aus ihr heraus: „Der Mensch, der soll gut sein, tolerant, hilfsbereit. Der Krieg aber ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er weckt das Böse in den Menschen! Er bringt Tod und Verderben und zerstört alles, was gut und was schön ist - unsere Träume, unsere Hoffnungen, ja, vielleicht auch unser Leben.
„Aber Mama“, warf ich ein, „es heißt doch, der Krieg würde nicht lange dauern. Bald soll es wieder Frieden geben.“
„Ach Gott“, sagte die Mama, „ich fürchte, auch diesmal wird die Dummheit wieder über die Vernunft siegen. Genauso wie damals,1914! Da hieß es auch, der Krieg würde sicher in wenigen Wochen beendet sein. Doch dann dauerte er vier lange Jahre. Müssen wir nicht fürchten, dass die Menschen auch diesmal wieder den Kopf so lange in den Sand stecken, bis es eines Tages ein fürchterliches Erwachen gibt?“
Wer konnte diese Frage schon beantworten? Vielleicht hätte der Papa einiges dazu sagen können. Er hat den ersten Weltkrieg als Sanitätsgefreiter miterlebt. Es gibt viele Fotos von ihm aus dieser Zeit, die er als Feldpostkarten an seine Familie geschickt hat. Darauf steht er vor irgendwelchen Zelten in Serbien oder sonst wo auf dem Balkan - umringt von einigen schon halb genesenen Lazarettinsassen - und blickt zuversichtlich in die Kamera. Doch von dem Leiden der Verwundeten und den von Granaten zerfetzten Leichen, die das Schlachtfeld säumten, davon hat Papa nie gesprochen, und dazu sagen auch die Fotos nichts. Er selbst hat durch einen Granatsplitter eine Narbe davon getragen, eine Narbe an der rechten Wange, ein glatter, sauberer Schnitt. „Sie waren wohl in einer schlagenden Verbindung?“ wurde er schon mal von Akademikern gefragt. Darauf gab Papa keine Antwort, er setzte nur ein geheimnisvolles Lächeln auf und behielt die Wahrheit über diesen angeblichen Schmiss ebenso für sich, wie sein Wissen um das Grauen des Krieges.
Die Mama aber quälten Visionen von Not und Elend im Land, von Tod und Verderben an der Front. Was sie jedoch nicht voraussah, das waren die Bombennächte, die brennenden Städte -einen Krieg, der sich nicht nur auf dem Schlachtfeld austoben, sondern ebenso die Zivilbevölkerung in der Heimat treffen würde. Nein, soweit gingen ihre Visionen nicht. Dieses Ausmaß des Krieges sollte sich ja erst allmählich entfalten, sich dann immer weiter ausdehnen und wie eine Apokalypse nicht nur unser Land, sondern den halben Kontinent überfallen. Wer aber wollte schon im Voraus die ganze schreckliche Wahrheit wissen? Wir arrangierten uns einfach mit den Situationen, so wie sie kamen, spielten unseren Part mit und wurden unschuldig schuldig. Zwar spürte jeder bewusst oder unbewusst, dass etwas Grauenvolles auf uns zukam, aber wir nahmen es zunächst einmal hin. So ist es eben! Wir haben Krieg, daran können wir nichts ändern! Nur sollten wir jetzt zusammenhalten. Wer weiß, wie sich die Dinge noch entwickeln? Auch ich machte mir als Kind wenige Gedanken über den Krieg und fragte nicht mehr nach dem Wie und dem Warum. Wenn man jung ist, denkt man weder an die Vergangenheit, noch an die Zukunft, man lebt nur der Stunde.
Im Anfang trottete die Zeit des Krieges ja noch in sanfter Trägheit dahin. Die Propagandawelle aber lief bereits auf Hochtouren. Das Feindbild wurde immer hasserfüllter. Meist hörten wir nicht hin, doch das schleichende Gift drang unbewusst in unsere Hirne. Nur wenige waren dagegen gefeit. In der Heimat lichteten sich allmählich die Reihen unter den Freunden meiner Brüder, diesen jungen Burschen, die gerade erst die Schule beendet hatten und nun ihr Wissen dafür einsetzen mussten, wie man ein Gewehr zusammensetzt, eine Kanone in Stellung bringt. Viele packte gar kriegerischer Überschwang, viele meldeten sich freiwillig zur Wehrmacht. Auch mein Bruder Toni konnte es kaum erwarten, Soldat zu werden. Doch noch war er zu jung, noch wurde er nicht genommen. So tobte er sich weiter beim Jungvolk aus und sog dort begeistert die pseudo-romantische Burschenherrlichkeit ein mit Lagerfeuern, Kräftemessen und dem Schmettern zackiger Lieder. Zunächst schien alles noch Spiel zu sein, das Abenteuer stand im Vordergrund. Die Hitlerjugend fühlte sich als Hoffnungsträger für eine neue Zukunft. Individualität galt ihnen nichts, stattdessen waren Ehre, Treue und Kameradschaft gefragt. Und die Fahne, ja, die flatterte ihnen stets voran, denn: „die Fahne ist mehr als der Tod!“.
Für viele wurde die „Hitlerjugend“ eine Art Ersatz-Wehrmacht, bis sie wirklich Soldat werden mussten und aus ihrem Spiel bitterer Ernst wurde. Mein Bruder Georg aber - nur ein Jahr älter als Toni - war gegen solche Verführungen gefeit. So - wie er sich schon dem Jungvolk verweigert hatte - dachte er auch nicht daran, freiwillig zum Barras zu gehen. „Warum soll ich meine Knochen für etwas hinhalten, hinter dem ich nicht stehe? Wenn sie mich haben wollen, müssen sie mich schon holen.“
Nach dem Blitzkrieg in Polen befand sich das ganze Land im Siegesrausch. Viele Deutsche fühlten sich nun als Herrenmenschen. Wie sollten denn unbedarfte Zivilisten den schrecklichen Hintergrund des Überfalls auf andere Länder durchschauen, wenn selbst erfahrene Generäle machtbesessen mitspielten? Wir hingen vor den Radiogeräten und begeisterten uns an den Siegesmeldungen. Die Helden und ihre Geschichten waren die Würze der Kriegspropaganda. Ihr Glanz ließ etwaige Zweifel am Sinn des Krieges verblassen. Und wenn es Menschen gab, die das bittere Ende des Weges ahnten, auf den der Führer uns führte, so wagten sie nicht, sich anderen mitzuteilen. „Vorsicht, der Feind hört mit“ warnten allenthalben riesige Plakate. Doch der allgegenwärtige Feind, das waren weniger die fremden Spione, die mithören konnten, sondern eher die Denunzianten im eigenen Volk, die bereit waren, diejenigen anzuzeigen, die eine andere, eine kritischere Meinung vertraten.
Ich selbst war damals - ebenso wie viele andere - weit davon entfernt, dies zu durchschauen. Fast sorglos lebte ich weiter in den Tag hinein. Für mich war der Krieg bisher kaum spürbar geworden. Zwar gab es schon Lebensmittelmarken, doch noch musste niemand wirklich hungern. Zwar kannte ich einige von den jungen Männern, die man bereits eingezogen hatte, doch meine Brüder waren bisher nicht darunter. Auch der Kanonendonner von den Fronten hallte noch nicht bis in unser Land hinein. Das Jahr – es hatte 365 Tage – und noch haben wir nicht jeden Tag gelitten.
Die braune Saat
Es kam das Jahr 1941. Das Klima in Deutschland veränderte sich, auch wenn es mir zunächst kaum bewusst wurde. Die Kriegs- und Nazi-Propaganda erfasste allmählich jeden Winkel des Landes, jeden Bereich des Lebens. Presse, Rundfunk, Film und Werbung waren alle gleich geschaltet und verkündeten direkt oder unterschwellig die nationalsozialistische Ideologie. Überall in den Straßen, an Mauern, Bahnhöfen, Litfasssäulen, hingen großflächige Plakate, die uns ihre Parolen entgegenschmetterten. Einhämmernde Wiederholungen, inhaltliche Vereinfachungen und gezieltes Ansprechen der Gefühle sorgten dafür, dass sich nur wenige Menschen deren Wirkung entziehen konnten. So schlich sich das Gift dieser Propaganda fast unbemerkt in die Köpfe der Menschen ein. Besonders intensiv wurde mit Bildern lachender Kinder für die Jugendorganisationen der Nazis geworben. Und viele, allzu viele folgten diesem Ruf, wurden erwartungsfrohe Pimpfe, gutgläubige Jungmädel. Den verführerischen Ritualen, Liedern, Fahnen war nur schwer zu widerstehen; Lagerfeuerromantik und Fackeln bei abendlichen Umzügen wirkten oftmals überwältigend auf empfängliche junge Gemüter.
Ja, auch Toni - mein so romantisch angehauchter Bruder - ging diesen Rattenfängern ins Netz. Wäre er früher zur Welt gekommen - so um die Jahrhundertwende - hätte er sich wohl den „Wandervögeln“ angeschlossen und wäre mit Mandoline und Gitarre, Zeltplane und Rucksack durch die Lande gezogen, um sich den frischen Wind um die Ohren wehen zu lassen und den Mief einer verkrusteten Gesellschaft abzuschütteln. Nun aber zog er mit seinem „Fähnlein“ durch die Straßen und sang mit ihm voll naiver Gläubigkeit:
„Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.“
Georg aber - mein ältester Bruder - ist nie der Hitlerjugend beigetreten. Erstaunlicherweise wurde er deshalb aber keinen Repressalien ausgesetzt. Vielleicht lag es daran, dass viele Arbeiter unseres Stadtteils früher Kommunisten waren und sich noch zu Beginn der Dreißiger Jahre mit den faschistischen Schwarzhemden so manche Straßenschlacht geliefert hatten. Möglich, dass deshalb die Nazis hier weniger rigoros auftraten als anderswo. Oder ist es mir als Kind nur so erschienen? War ich vielleicht auf einem Auge blind? Sicher, unüberhörbar war inzwischen die allgegenwärtige Hetze gegen die Juden. Da aber in unserem Viertel kaum Juden wohnten und es hier meines Wissens keine jüdischen Geschäfte gab, bekamen wir von Ausschreitungen gegen diese Bevölkerungsgruppe nur wenig mit. Daher nahmen wir die Hetztiraden auch nicht so ernst. Wir Kinder erfassten eh nicht, was es für die Juden bedeutete, beschimpft und gedemütigt zu werden. Aber auch die Erwachsenen schienen kaum darüber nachgedacht zu haben, jedenfalls haben sie mit uns nie darüber gesprochen. Wäre sonst die Sache mit unserem Herrn Stern passiert, die mir heute noch die Schamröte ins Gesicht treibt?
Dieser Herr Stern war Vertreter einer bekannten Bürstenfabrik. Er war ein etwa fünfzig Jahre alter Mann mit einem leicht melancholischen Blick. Wenn aber ein Lächeln über sein Gesicht huschte, hatte er eine liebenswerte Ausstrahlung. Ungefähr einmal im Monat besuchte er uns - ein freundlicher Mensch, der irgendwie zu unserem Leben gehörte. Er verkaufte Pinsel und Bürsten – große, kleine, dicke, dünne - alle von guter Qualität. Er war jedoch nicht nur ein Vertreter seiner Firma, sondern auch ein Vermittler von freundschaftlichen Gefühlen, eine Brücke zwischen Geschäftsleben und Privatleben. In unserer Beziehung zu ihm ließ sich das eine vom andern nicht trennen. Wenn Herr Stern kam, wurde bei uns der Kaffeetisch besonders sorgfältig gedeckt, waren die Gespräche zwischen den Männern besonders lebhaft, holte Papa hinterher schon mal dazu eine Flasche Wein aus dem Keller. Man merkte – Papa, der Malermeister und Herr Stern, der Bürstenvertreter - mochten sich. Daran änderte sich auch nichts, als Papa im Sommer 1938 nach seiner Rückkehr aus der Schweiz das Parteiabzeichen der NSDAP am Jackenaufschlag trug. In Davos, wo Papa wegen seiner angegriffenen Lunge zu einer längeren Kur weilte, hatte er sich von einer dortigen Studentengruppe zum Nationalsozialismus überreden lassen. Seitdem gab es in unserem Haus die Nationalzeitung.
Als Herr Stern auf seiner Geschäftsreise wieder einmal an unsere Tür klopfte, war ich allein in der Wohnung. „Kommen Sie doch herein“, bat ich Herrn Stern und führte ihn ins Wohnzimmer. „Mein Papa ist auf einer Arbeitsstelle und die Mama ist einkaufen, sie wird aber bald zurück sein.“ Freundlich lächelnd war Herr Stern eingetreten. Plötzlich aber schien er zu erstarren. Warum nur? dachte ich. Dann fiel mein Blick auf den Wohnzimmertisch, wo deutlich sichtbar der Völkische Beobachter lag, dessen Titelblatt in riesigen Lettern die Leser aufforderte: „Deutsche, kauft nicht bei Juden“. Nach einigem Zögern setzte Herr Stern sich an den Tisch und wartete geduldig auf Mamas Rückkehr. Bevor sie jedoch eintraf, stürmte mein Bruder Toni herein. Als er unseren Besucher erkannte, zog er mich aufgeregt ins angrenzende Kinderzimmer und zischte mir zu: „Weißt du nicht, dass dieser Mensch ein Jude ist? Na, dem werden wir jetzt mal kräftig einheizen!“ Und schon fing er an, lauthals durch die halboffene Tür zu krähen: „Töff, töff, töff, es kam ein Jud gefahren...“ Ja, bis zum bösen Ende schmetterte er dieses Pamphlet: „Schmeißt sie raus, die ganze Judenbande, schmeißt sie raus aus unserm Vaterlande...“
Und ich? - Ich stand klein und geduckt neben meinem Bruder und habe mich weiß Gott nicht wohl gefühlt dabei, trotzdem jedoch habe ich mitgesungen! Und erst, als ich durch den Türspalt beobachtete, wie Herr Stern immer blasser wurde und dann eilig unsere Wohnung verließ, da wurde mir bewusst, was wir diesem Mann mit unserem kindisch-bösem Hassgesang angetan haben. Und doch hab ich nicht gewagt, meinem schlechten Gewissen auf den Grund zu gehen, hab nicht versucht, ihn zurückzuhalten, hab nicht daran gedacht, mich für unser Gegröle bei ihm zu entschuldigen. Auch später nicht, als er uns noch einmal aufsuchte. Er wirkte da besonders blass, seine Augen sahen kummervoller aus als sonst; und unsere Eltern, die konnte einfach nicht verstehen, warum dieser nette Herr Stern sich plötzlich so schweigsam gab. Weder Toni noch ich hatten ja den Mut aufgebracht, ihnen zu beichten, mit welch rüden Methoden wir Herrn Stern bei seinem letzten Besuch vergrault hatten.
Als Herr Stern danach nicht mehr bei uns auftauchte, fühlte ich mich fast erleichtert. Ich dachte, nun könnte ich den beschämenden Vorfall einfach vergessen. Eigentlich jedoch hätte mein schlechtes Gewissen mich zum Nachdenken darüber bringen müssen, warum um Gotteswillen man die Juden in unserem Land dermaßen beschimpfte. Im kindlichen Alter aber nimmt man die Dinge eher wie sie sind, wie sie einem begegnen, ohne sie allzu gründlich zu hinterfragen. Man denkt weder an die Vergangenheit, noch an die Zukunft, man lebt nur der Stunde. Mit Hitlers Tiraden über das Weltjudentum konnte ich eh’ nichts anfangen. Auch habe ich nie darüber nachgedacht, warum gerade Christen die Juden jahrhundertelang geschmäht haben. Ist Jesus denn nicht auch Jude gewesen, und stand er nicht selber in der jüdischen Tradition? Nachgefragt aber habe ich nicht. Wahrscheinlich hätte es mir eh niemand erklären können oder wollen. Und die Kirche selbst schwieg zu dieser Frage.