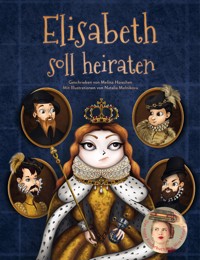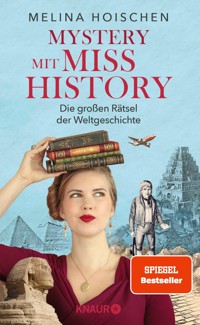
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unheimliche historische Begebenheiten, für die wir bis heute keine Erklärung haben Die Geschichte der Menschheit kennt zahlreiche rätselhafte Orte, ungeklärte Mordfälle oder sonderbare Personen. Bis heute suchen Fachleute und Historiker*innen für viele dieser Mysterien zufriedenstellende Erklärungen. Melina Hoischen alias @Miss History_ ist Geschichtsspezialistin auf Social Media. In ihrem Buch untersucht sie die spannendsten und bedeutendsten Rätsel der Weltgeschichte und ist dem scheinbar Unerklärlichen auf der Spur. Von mysteriösen wahren Geschichten über archäologische Rätsel bis zu historischem True Crime beantwortet sie Fragen wie: Welches Geheimnis hütet die Mona Lisa? Was geschah mit Flug MH370 wirklich? Existierte die Päpstin Johanna oder ist sie nur eine Legende? Und was verraten uns die Moai-Statuen über die vergessene Zivilisation auf der Osterinsel? Miss History weiß, warum uns diese rätselhaften Ereignisse bis heute in ihren Bann ziehen und wieso eindeutige Antworten nur schwer zu finden sind. Unterhaltsam und mitreißend nimmt sie uns mit in die Welt des alten Ägypten, in die geheimen Gänge des Vatikans oder an den Grund des Meeres, wo aberhunderte Mysterien noch auf ihre Entdeckung warten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Melina Hoischen
Mystery mit Miss History
Die großen Rätsel der Weltgeschichte
Illustriert von Stefanie Jung
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Unheimliche historische Begebenheiten, für die wir bis heute keine Erklärung haben
Die Geschichte der Menschheit kennt zahlreiche rätselhafte Orte, ungeklärte Mordfälle oder sonderbare Personen. Bis heute suchen Fachleute und Historiker*innen für viele dieser Mysterien zufriedenstellende Erklärungen. Melina Hoischen alias @Miss History_ ist Geschichtsspezialistin auf Social Media. In ihrem Buch untersucht sie die spannendsten und bedeutendsten Rätsel der Weltgeschichte und ist dem scheinbar Unerklärlichen auf der Spur. Von mysteriösen wahren Geschichten über archäologische Rätsel bis zu historischem True Crime beantwortet sie Fragen wie:
Welches Geheimnis hütet die Mona Lisa? Was geschah mit Flug MH370 wirklich? Existierte die Päpstin Johanna oder ist sie nur eine Legende? Und was verraten uns die Moai-Statuen über die vergessene Zivilisation auf der Osterinsel?
Miss History weiß, warum uns diese rätselhaften Ereignisse bis heute in ihren Bann ziehen und wieso eindeutige Antworten nur schwer zu finden sind. Unterhaltsam und mitreißend nimmt sie uns mit in die Welt des alten Ägypten, in die geheimen Gänge des Vatikans oder an den Grund des Meeres, wo aberhunderte Mysterien noch auf ihre Entdeckung warten.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Was ist das, und müssen wir das verstehen? – Eine Einleitung
Dorothy Eady – Das Mädchen, das aus der Zeit der Pharaonen zurückkehrte
Warum uns das Phänomen bis heute fasziniert: Gibt es die Wiedergeburt wirklich?
Ein ganzes Land voller Schätze und Gold – Gibt es El Dorado wirklich?
Warum uns das Phänomen bis heute fasziniert: Wie kann die Legende um El Dorado so stark sein, wenn es den Goldschatz gar nicht gibt?
Das geheimnisvolle Lächeln einer rätselhaften Frau – Welches Geheimnis hütet die »Mona Lisa«?
Warum uns das Phänomen bis heute fasziniert: Das berühmteste Bild der Welt hinterlässt noch immer mehr Fragen als Antworten
War Kaspar Hauser ein königliches Geheimnis, oder war er ein Schwindler?
Warum uns das Phänomen bis heute fasziniert: Wer war das »Kind Europas« wirklich?
Rätselhafte Osterinsel – Die steinernen Moai-Statuen, die über das Land wandeln
Warum uns das Phänomen bis heute fasziniert: Sind die Rapa Nui eine verfluchte Zivilisation, und was haben die Steinriesen damit zu tun?
Die »verloren gegangenen« Atombomben – Reale Bedrohung oder übertriebene Verschwörungstheorie?
Warum uns das Phänomen bis heute fasziniert: Was bedeuten die vermissten Nuklearwaffen für unsere (Un-)Sicherheit?
War König Ludwig II. von Bayern Opfer eines Komplotts, oder war sein Tod ein tragischer Unfall?
Warum uns das Phänomen bis heute fasziniert: Hat sich der König von Bayern umgebracht, oder wurde Ludwig II. Opfer eines Komplotts?
Geheimnisvolle Pyramiden – Hinterlassenschaften einer außerirdischen Lebensform oder irrwitziges Mammutprojekt gottgleicher Pharaonen?
Warum uns das Phänomen bis heute fasziniert: Wie sollen die alten Ägypter das denn bitte geschafft haben?
Was geschah mit Flug MH370?
Warum uns das Phänomen bis heute fasziniert: Wie ist es möglich, dass ein ganzes Flugzeug spurlos verschwindet?
Tragödie eines zu gut versteckten Schatzes oder verzweifeltes Täuschungsmanöver – Wo ist das Bernsteinzimmer?
Warum uns das Phänomen bis heute fasziniert: Wie kann ein ganzer Raum »einfach so« unwiederbringlich verschwinden?
Der Mörder, der in Rätseln spricht – Wer ist der »Zodiac-Killer«?
Warum uns das Phänomen bis heute fasziniert: Weshalb interessieren wir uns eigentlich so brennend für grausame Verbrechen?
Existierte die Päpstin Johanna wirklich, oder ist sie nur eine Legende?
Warum uns das Phänomen bis heute fasziniert: Wenn für eine Frau alles möglich scheint
Danksagung
Was ist das, und müssen wir das verstehen? – Eine Einleitung
Ich sage: Ja! Und unbedingt. Aber lasst mich anders anfangen …
Einer der schönsten Orte, an denen ich bisher eines meiner Videos zu historischen Themen und Persönlichkeiten drehen durfte, ist das Liebieghaus in Frankfurt am Main. Ich habe dort in Kooperation mit dem ZDF für das Format »Geheimnisse der Kunstgeschichte« die Abteilung Restaurierung besucht und die Restauratoren in ihrer Werkstatt kennengelernt. Darunter Harald. Harald Theiss. Er erzählte mir en détail etwas zu einer ganz bestimmten Restaurierung einer Statue.
Normalerweise interessiere ich mich nicht sonderlich für diese Tiefe bei fachfremden Themen. Aber … Harald liebt, was er tut. Während er mit mir sprach, leuchteten seine Augen vor Begeisterung, seine Stimme steckte so voller Leidenschaft für seine Arbeit, seine gesamte Körpersprache sagte aus: Das ist meine Bestimmung!
Und diese Bestimmung führt ihn auf die Spuren kunsthistorischer Rätsel. Mithilfe kunsttechnologischer Erforschung alter Materialien und Maltechniken, durch Experimente und Rekonstruktion ermöglicht er auf seine Weise die Wiederentdeckung verloren geglaubten Wissens.
Einen normalen Arbeitstag gebe es bei ihm nicht, sagt Harald. Weil jedes Objekt, an dem er arbeite, stets anders und einzigartig sei.1
Und diese Begeisterung und Leidenschaft hat auf mich abgefärbt. Ich wollte immer mehr wissen, weil es einfach Riesenspaß gemacht hat, Harald zuzuhören – und es hat auch meinen eigenen Entdeckerinnendrang geweckt, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Was im Bereich der Skulpturen und Statuen, Figurinen und Plastiken wohl noch an Mysteriösem, Ungeklärtem zu entdecken ist …?
Genau so jemand wie Harald für mich an jenem Tag möchte ich für euch sein. Ich will euch für Themen begeistern, von denen ihr noch nie etwas gehört habt, und eure Leidenschaft für rätselhafte Geschichten entfachen, die aus diesem einen besonderen Blickwinkel noch nicht gelesen und erzählt worden sind. Ich möchte eure Entdecker(innen)lust herauskitzeln und euch ermutigen, die Dinge auch mal in einem anderen Licht, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Denn sehr oft trügt der Schein, und es ist um die Dinge ganz anders bestellt als anfänglich vermutet …
Mein Besuch im Liebieghaus und meine besondere Begegnung mit Harald haben mich immens dankbar darüber zurückgelassen, dass ich die Möglichkeit habe, für so viele von euch ein Harald sein zu dürfen. Schön, dass ihr alle da seid!
Dieses Buch ist mein Geschenk an euch: Willkommen zu den Geheimnissen der Weltgeschichte!
Gehabt euch wohl, Edeldamen und Edelherren, eure Melina Hoischen, besser bekannt als »Miss History«
Dorothy Eady – Das Mädchen, das aus der Zeit der Pharaonen zurückkehrte
Dorothy Eady – als Kind überlebte sie einen schweren Treppensturz, doch was sie danach behauptete, versetzt die Welt bis heute in Staunen: Sie sei eine wiedergeborene Priesterin des alten Ägyptens. Viele verurteilten sie als verrückt, doch wie lässt sich erklären, dass Dorothy auf mysteriöse Weise von bis dahin unentdeckten Tempelstrukturen und geheimen Gärten wusste, die Jahrtausende lang im Sand verborgen lagen?
Glaubt ihr an Wiedergeburt? Nein? Dann haltet euch lieber fest. Nach dieser Geschichte bin ich auf eure Erklärungen gespannt. 🙂
Dorothy Louise Eady war das Kind von Reuben Eady und Caroline May Frost Eady. Das Licht der Welt erblickte sie am 16. Januar 1904 im Londoner Vorort Blackheath. Bis dahin klingt alles noch ganz normal. Doch dann stürzte sie mit etwa drei Jahren die Treppe in ihrem Wohnhaus hinunter. Weil von einem Arzt weder Atmung noch Puls festgestellt werden konnte, wurde sie für klinisch tot erklärt. War sie aber gar nicht.
»Als er mit dem Totenschein zurückkam, saß die Leiche auf dem Bett und spielte«, erinnerte Dorothy Eady sich in einem Interview mit der New York Times aus dem Jahr 1979. »Sie fragten mich, warum ich weinte, und ich sagte: ›Ich will nach Hause.‹ Sie versicherten mir, dass ich zu Hause sei.«2
Dorothy schien tatsächlich körperlich ganz gesund zu sein und erholte sich rasch ohne sichtbare bleibende Schäden. Jedoch: Die immer drängender werdende Frage nach ihrem »anderen Zuhause« ließ dem kleinen Mädchen keine Ruhe. Als sie eines Tages in The Children’s Encyclopædia von Arthur Mee blätterte, schrie sie entzückt auf: Sie war auf ein Foto des prächtigen Totentempels des Sethos I. in Abydos gestoßen und hatte darin doch tatsächlich ihre frühere Heimat erkannt! Gesagt haben soll sie den kryptischen Satz: »Hier ist mein Zuhause, aber warum ist es eine Ruine, und wo sind die Gärten?«3, woraufhin es ihren Eltern eiskalt den Rücken herunterlief.
Besonders wohl fühlte sich die kleine Dorothy im British Museum, nachdem sie dort die Abteilung mit Fundstücken, Artefakten und Nachbildungen des alten Ägyptens entdeckt hatte. Sie verbrachte viel Zeit bei »ihren Leuten«1, wie sie sagte, lief zwischen den Statuen hin und her und küsste ihnen die Füße. Der Arzt diagnostizierte Wahnvorstellungen.
Mit zehn Jahren begegnete Dorothy in ihrem »behelfsmäßigen Zuhause« dem britischen Archäologen und Orientalisten Sir Ernest Alfred Thompson Wallis Budge (1857–1934), der für das British Museum arbeitete. Er hatte bereits viele Bücher über das alte Ägypten geschrieben und war somit ein echter Kenner auf dem Gebiet. Angetan von Dorothys Leidenschaft für Ägypten, erklärte er sich bereit, ihr höchstpersönlich das Lesen und Schreiben von Hieroglyphen beizubringen, und war im Folgenden beeindruckt von der Schnelligkeit und Mühelosigkeit, mit der das dem Mädchen gelang.
Mit 15 Jahren berichtete Dorothy auf einmal von »Besuchen« des Pharaos Sethos I. (auf Englisch: Sety I), Sohn von Ramses I. und Satre, der um 1323 bis 1279 vor Christus gelebt hatte. In Albträumen, beim Schlafwandeln und während außerkörperlicher Erfahrungen fühlte sie sich immer wieder in ihr »früheres Leben« in Ägypten versetzt und erinnerte sich im Anschluss an Dinge, die ihren Alltag dort ausgemacht und begleitet hatten. So sei sie dort als Mädchen mit dem Namen Bentreshyt geboren worden. Nachdem sie von ihren Eltern verlassen worden war, sei sie im Tempel von Sethos I. in Abydos aufgewachsen und dort Priesterin geworden – und habe später eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zum Pharao gehabt.4 Als sie von ihm schwanger geworden sei, habe sie sich das Leben genommen, da ihre Beziehung ein Verbrechen darstellte und sie den Pharao nicht hatte verraten wollen (womit sie selbst immerhin der öffentlichen Hinrichtung entging).5
Mehrmals wurde ihr Geisteszustand wegen Aussagen dieser Art in psychiatrischen Anstalten begutachtet.6 Trotz intensiver Untersuchungen und der Überzeugung der Ärzte, sie litte unter Wahnvorstellungen und Halluzinationen, ließen sich jedoch keinerlei Anzeichen für eine psychische Störung finden, die ihre Erlebnisse und Schilderungen eindeutig hätte erklären können. Die Ärzte beschrieben ihren Zustand darum als eine Form von Pseudologia fantastica, von pathologischem Lügen, wobei Betroffene Geschichten erzählen, die übermäßig fantasievoll oder komplett erfunden sind.
Trotz dieser enormen Herausforderungen im Leben eines jungen Mädchens schaffte es Dorothy Eady, sich ihre Leidenschaft und das immense Interesse für das altägyptische Leben zu bewahren – oder gerade deshalb …? Vielleicht war es ihre einzige Zufluchtsstätte in einer Umgebung, die ihr keinen Glauben schenkte, mehr noch: sie für verrückt erklärte.
Sie vergrub sich in allen Büchern über das alte Ägypten, die sie finden konnte, und sammelte wertvolle ägyptische Antiquitäten. Auch beruflich ließ sie sich von ihrer Leidenschaft leiten und begann mit 27 Jahren, für ein ägyptisches Magazin zu schreiben.
By the way und interessant: Ägypten stand mehrere Jahrzehnte unter britischer Herrschaft. Seine Unabhängigkeit erhielt das Land formell am 28. Februar 1922, als das Sultanat Ägypten in das Königreich Ägypten umgewandelt wurde, allerdings war Großbritannien auch in den folgenden 30 Jahren im Land noch sehr präsent, nicht zuletzt durch die Kontrolle des Suezkanals als strategisch enorm wichtiger Wasserstraße. So richtig endete die britische Einflussnahme erst mit der Revolution 1952, die zur Abschaffung der Monarchie und Errichtung der Republik Ägypten führte.7
Dorothy stellte sich übrigens – wen überrascht’s? – uneingeschränkt auf die Seite Ägyptens, was den Wunsch nach Unabhängigkeit betraf.
Dann lernte sie den damaligen Studenten Eman Abdel Meguid kennen – ihren zukünftigen Ehemann. Er kam aus Ägypten. Natürlich. Mit 29 heiratete Dorothy ihn, gegen den Willen ihrer Eltern – und konnte endlich, endlich mit ihm zusammen »nach Hause« zurückkehren, um für immer dort zu bleiben. So zumindest erklärte sie es glückselig und wie von einer großen Bürde befreit, nachdem sie mit dem Schiff in Kairo angekommen war und den Boden unter ihren Füßen geküsst hatte. Durch die Heirat erhielt sie den Namen Bulbul (Nachtigall) Abdel Meguid. Aber noch einen zweiten Namen gab sie sich mit der Überfahrt nach Ägypten: Omm Sety (auch Om Seti), was »Mutter Setys« bedeutet. Damit huldigte sie einmal ihrer besonders engen Verbindung aus ihrem früheren Leben zu Pharao Sethos I., gleichzeitig war sie buchstäblich die Mutter von Sety, ihrem Sohn, den sie nach dem Pharao benannt hatte. Ihr Mann trennte sich im Übrigen wieder von ihr und erstritt auch das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. Die Gründe dafür? Dorothy, oder ab jetzt Omm Sety selbst erklärte lapidar: »Wir blieben zwei Jahre lang verheiratet, dann konnte er mich nicht mehr ertragen, der arme Kerl, und er ließ sich von mir scheiden und heiratete seine Cousine.«8
Dafür übernahm sie eine andere große Verantwortung: Ab 1936 arbeitete Omm Sety als Wärterin für den Totentempel des Sethos I. in Abydos. In diese alte heilige Stadt zog sie mit 52 Jahren auch für den Rest ihres Lebens, nachdem sie lange Zeit in Kairo gelebt hatte. Von Glück beseelt, stelle ich mir vor. Denn das sei der Ort gewesen, wo sie in ihrem früheren Leben geboren worden und aufgewachsen sei. Ab dieser Zeit begann sie, bei den Ausgrabungen und der Restaurierung von Abydos zu helfen und den Totentempel des Sethos I. weiter zu erforschen.
In ihrer »alten Heimat« arbeitete sie mit vielen Ägyptologen zusammen und lernte weiter von ihnen, vertiefte ihr enormes Wissen über das alte Ägypten. So stellte der bekannte Ägyptologe Dr. Ahmed Fakhry sie 1951 ein, damit sie mit ihm gemeinsam das Pyramidenfeld von Dahschur erforschte, Ausgrabungen katalogisierte und Gräber restaurierte. Trotz ihrer fehlenden akademischen Ausbildung veröffentlichte Omm Sety zahlreiche Artikel und Bücher über das alte Ägypten, die breite Anerkennung in der Fachwelt fanden. Sie wurde letztlich technische Zeichnerin für den Supreme Council of Antiquities, damals die oberste Denkmalschutzbehörde Ägyptens.
Einige Wissenschaftler, Professoren und Forscher, mit denen sie gearbeitet hatte und die ihre Arbeit und ihr enormes Wissen über das alte Ägypten sehr zu schätzen wussten, beschrieben sie fast liebe-, aber auf jeden Fall respektvoll als »lebhaft, temperamentvoll und exzentrisch« sowie als »große, kräftige Frau, die vor Begeisterung übersprudelte«9. Nichtsdestotrotz erwähnten sie auch ihren »unheimlichen sechsten Sinn in Bezug auf das Terrain, auf dem sie sich bewegte«,10 und wie sie Menschen erstaunte mit ihrem sehr tiefgehenden Wissen über den Tempel von Abydos und seine Umgebung. Omm Sety erzählte es folgendermaßen: »Im Stockdunkeln ging ich zu jeder Stelle, die sie mir nannten. (…) Jedes Mal lag ich richtig.«11
Die Ärzte und viele andere blieben dabei: Verrückt träfe es besser.
Doch selbst jene, die an der Geschichte ihrer Wiedergeburt zweifeln, können Folgendes nicht erklären: woher Dorothy Eady ihr außergewöhnlich präzises Wissen über den Tempel von Sethos I. hatte. Denn sie hat zum Beispiel so genau bestimmt, wo sich die Ruinen der verschollenen Gärten des Tempels befinden müssen, dass diese daraufhin bei Ausgrabungen entdeckt werden konnten. Ebenjene Gärten, nach denen sie bereits als Kind gefragt hatte … Gänsehaut, oder?!
Ebenso spürte sie alte Tunnel und Gräber auf und kannte die genaue Position von Tempelbildern, lange bevor sie der Öffentlichkeit bekannt waren.12 Sie schätzte die Höhe der beschädigten Säulen richtig ein, auf denen das Tempeldach fehlte, und übersetzte einige der rätselhaften Hieroglyphen.13 Dr. Klaus Baer, über 20 Jahre Professor am Oriental Institut an der University of Chicago, der eng mit Dr. Ahmed Fakhry zusammengearbeitet hatte, bestätigte: »Sie verstand die Methoden und Standards der Wissenschaft, was bei ›Verrückten‹ normalerweise nicht der Fall ist.«14
Als Omm Sety – deren englischer Name Dorothy Eady in Abydos, wo sie bis zu ihrem Tod mit 77 Jahren lebte, schon lange vergessen war – im Alter einmal gefragt wurde, was sie selbst glaube, antwortete sie: »Ich weiß nicht, was passiert ist. Manche Leute sagen, ich sei zum Zeitpunkt des Unfalls wirklich tot gewesen. Andere sagen, dass sich beim Treppensturz einfach eine Schraube gelöst hat.«15
Warum uns das Phänomen bis heute fasziniert: Gibt es die Wiedergeburt wirklich?
Der Fall »Dorothy Eady« sei eine »faszinierende und überzeugende moderne Fallgeschichte des Reinkarnationsglaubens«, war 1987 in der New York Times zu lesen.16 Reinkarnation – Wiedergeburt … Whaaaat?! Darüber möchte ich unbedingt mehr wissen!
Der Mythos der Wiedergeburt übt offenbar einen ungeheuren Reiz auf uns »moderne« Menschen in dieser durchdigitalisierten und von wissenschaftlichen Erkenntnissen durchzogenen Welt aus. Obwohl, ehrlich gesagt ist es ein ewiger Dauerbrenner, denn eigentlich beschäftigt die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, die Gelehrten schon seit Jahrhunderten …
Die wissenschaftliche Erforschung paranormaler Phänomene, wie auch der Frage nach einem Leben nach dem Tod, mündete übrigens ganz professionell in der Gründung der Society for Psychical Research in London im Jahr 1882. Untersucht werden dort zum Beispiel Erscheinungen von Verstorbenen, Kommunikation mit den Toten, das Phänomen der Medien und Séancen, Nahtod- und außerkörperliche Erfahrungen.17
Immer wieder berichten Sterbende von ähnlichen Erfahrungen, und auch Menschen mit Nahtoderfahrungen wiederholen diese: das Schweben über dem eigenen Körper, die Rückschau auf ihr Leben, die Reise durch einen Tunnel, an dessen Ende ein helles Licht leuchtet, der Film des eigenen Lebens, der vor einem abläuft, Begegnungen mit Verstorbenen, der Eintritt in paradiesische Landschaften … Fast schon »Standarderfahrungen«, ohne zynisch klingen zu wollen. Tatsächlich sind Nahtoderfahrungen keine subjektive Wunscherfüllung, sondern gelten als »die häufigsten mystisch-religiösen Erfahrungen«, die wir Menschen machen können.18 Das bestätigt auch der Heidelberger Psychiater und Vorsitzende der deutschen Sektion der International Association for Near-Death Studies, Michael Schröter-Kunhardt. Immerhin hätten vier bis fünf Prozent von 2000 befragten Deutschen diese erlebt.19
Körpereigene Drogen scheinen die Nahtoderfahrungen positiv zu beeinflussen, sie sind aber nicht der Grund für die Bilder und Erlebnisse: So berichten viele Sterbende über ein unglaubliches Glücksgefühl. Danke an unser Gehirn: Es sendet offenbar nicht selten pünktlich zu unseren letzten Atemzügen Glückshormone aus, die den Sterbenden dabei helfen, die bedrohliche Situation besser zu überstehen.20 Die archaischste Abwehr unseres Körpers und Gehirns im Angesicht des Todes ist jedoch, uns in eine Bewusstlosigkeit zu versetzen. Denn die schützt uns davor, allzu negative Gefühle angesichts des Sterbens zu empfinden. In der Bewusstlosigkeit geschehen dann die Nahtoderfahrungen.21
Vielleicht hat ja die kleine Dorothy Eady angesichts ihres schlimmen Sturzes und der Todesängste oder extremen Schmerzen eine solche Nahtoderfahrung gemacht …?
Wie es zu den sehr besonderen Erlebnissen und Erfahrungen kommt, ist jedoch umstritten. Frühere, genauer gesagt im Jahr 1994 im Virchow-Klinikum – heute Teil der Charité mit dem Namen Rudolf-Virchow-Krankenhaus – durchgeführte und etwas illegale, weil hoch-experimentelle und gefährliche Studien brachten eine falsche Sauerstoff- und Kohlendioxid-Konzentration im Gehirn damit in Verbindung: Gesunde Versuchspersonen sollten schnell ein- und ausatmen und wurden dann in Ohnmacht versetzt. Ihre Erlebnisse glichen denen Sterbender: Sie verließen ihren Körper oder sahen ihr Leben wie im Film.
Der Erklärung ärgerlicherweise im Weg: Bei Herzstillstand-Patienten ist Sauerstoffmangel nicht die Ursache für Nahtoderfahrungen. Bei ihnen ist sogar eine höhere Sauerstoffkonzentration festzustellen als bei Patienten und Patientinnen ohne ein solches Erlebnis. Das zumindest wies das Team um Dr. Sam Parnia, Professor für Intensivmedizin und Direktor der Wiederbelebungsforschung an der New York University und Hauptautor der Studie AWARE (AWAreness during REsuscitation), nach. AWARE untersuchte im Jahr 20082060 Patienten und Patientinnen aus 15 Krankenhäusern Großbritanniens, den USA und Österreich mit dem Fokus auf der Erforschung von Herzstillständen, Wiederbelebung und damit verbundenen Bewusstseinsphänomenen.22
Ebenso wenig lässt sich das Phänomen mit Halluzinationen erklären (hätten das doch die Ärzte in Dorothy Eadys Kindheit bereits gewusst!), denn die Patienten und Patientinnen könnten sich genau und sehr detailliert an das Erlebte erinnern, was untypisch für Halluzinationen ist. Außerdem sind Halluzinationen immer individuell.
Eines aber ist klar: Menschen mit Nahtoderfahrungen sind nicht psychisch krank, denn es fehlt an formalen Denkstörungen oder schnellem Stimmungswechsel mit Angst- und Glücksgefühlen, die dafürsprechen würden. Außerdem führt die Änderung des Bewusstseins nicht zu bleibenden Schäden.23
Eine, wie ich finde, etwas erfrischendere Sicht auf die Dinge: Menschen mit hinduistischem Glauben sind einfach davon überzeugt, dass wir nicht nur einmal leben. Dabei gilt der Körper als eine Art Gewand, das wir mit dem Tod ablegen, woraufhin sich die Seele einen neuen Körper sucht, man nennt das »inkarnieren«.
Aber Stopp an alle, die jetzt aufatmen, weil es nach diesem Glauben keine ewige Verdammnis und kein Jüngstes Gericht gibt! Denn ob du dein nächstes Leben als Königin oder Sklavin, Filmschauspielerin oder Facility Manager fristen darfst oder musst, hängt davon ab, wie du deine Aufgabe im vorigen Leben erfüllt hast. Hier geht’s dann um Karma: Durch schlechte Taten sammelst du Minuspunkte für dein nächstes Leben und umgekehrt. Das klingt nicht nur anstrengend, das kann es durchaus sein. Darum ist auch das höchste Ziel hinduistischer Gläubiger, aus diesem Kreislauf auszusteigen. Das gelingt, wenn man es geschafft hat, das »perfekte« Leben zu leben.24 Aber liegt »perfekt« nicht immer im Auge des Betrachtenden? Und wer betrachtet denn hier und urteilt damit über meine ewige Wiedergeburt oder mein Seelenheil? Mich erinnert das jedenfalls stark an »Und täglich grüßt das Murmeltier« …
Bei uns »im Westen« hingegen, vor allem im Buch aller Bücher, der Bibel, herrscht ein lineares Zeitverständnis vor: Es gibt einen Anfang und ein Ende. Bums, aus. Nichts wiederholt sich, alles ist einmalig. Und wir alle sind dadurch sehr, sehr individuell (fühlt ihr es auch? 🙂). Der Mensch hat ein Leben lang Zeit, für das er am Ende Rechenschaft ablegen muss. Au Backe.
Ob Wissenschaft oder Religiosität, Einheits-Paradieserlebnis oder individuelles Leiden: Deuten die Erlebnisse und Erfahrungen Sterbender nun auf ein Leben nach dem Tod hin? Die Wissenschaft sagt: vielleicht. Auf jeden Fall sind noch weitere Forschungen nötig, um das zu beweisen. Möglicherweise werden wir es auch nie erfahren (beziehungsweise mit Sicherheit, aber erst nach unserem eigenen Tod … *zitter*).
Was ganz klar und unbestreitbar festgestellt werden konnte: Nahtoderfahrungen bewirken massive Veränderungen der Persönlichkeit. Und diese Veränderungen bieten durchaus Anlass für Konflikte: Scheidungen, Jobwechsel, andere Veränderungen im sozialen Umfeld können die Folge sein. Wie zum Beispiel der Glaube, in einem früheren Leben die Geliebte eines Pharaos gewesen zu sein und sein Leben fortan allumfänglich der altägyptischen Forschung zu verschreiben.
Möglicherweise hatte sich die kleine Dorothy Eady nach einer extremen Nahtoderfahrung entschlossen, ihr Leben etwas Größerem zu widmen …
Oder aber die Verbindung aus kindlicher Neugier, Begeisterungsfähigkeit und rascher Auffassungsgabe hat dazu geführt, dass ein kleiner Funke in jungen Jahren zu einem lodernden Feuer geworden ist. Dieser kleine Funke kann über eine unbewusste Informationsaufnahme, die sogenannte Kryptomnesie, entfacht worden sein. Ein Phänomen, bei dem sich die betroffene Person an Informationen oder auch Erfahrungen erinnert, ohne sich bewusst zu sein, diese bereits erlernt oder erlebt zu haben. Das kann dazu führen, dass dieser Mensch meint, Informationen auf mystische Weise erworben zu haben, obwohl sie eigentlich durch Lesen, Sehen oder Hören aufgenommen wurden.
Stand beispielsweise die Children’s Encyclopædia in der Wohnung der Eadys, und kann sie der kleinen Dorothy so bereits früher in die Hände gefallen sein? Haben ihr Vater oder ihre Mutter ihr darin womöglich Bilder gezeigt und Erstaunliches vom alten Ägypten vorgelesen? Die Begeisterung für und das Verbundenheitsgefühl mit allem Altägyptischen könnten so einen unbewussten Anfang genommen haben.
Ihr großes Interesse für Ägypten führte dann von einem zum anderen, sodass Dorothy Eady und später Omm Sety auch ohne Studium derart bewandert war auf dem Gebiet, dass sie als Expertin galt und ihre wissenschaftlichen Veröffentlichungen anerkannt wurden.
Und wie steht es um die Eventualität, dass der Treppensturz in ihrer Kindheit zu Veränderungen im Gehirn geführt haben könnte, mit denen sich ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und Erinnerungen durch verstärkte emotionale Wahrnehmung erklären ließen? Doch auch eine möglicherweise »gelöste Schraube«, wie Omm Sety es selbst einmal in die Waagschale warf, kann nicht erklären, was unerklärlich und mystisch bleibt: Wie konnte sie so genau beschreiben, wo sich die Ruinen der verschollenen Gärten befanden?
Und wenn sich das Ergebnis von Intuition und logischen Schlussfolgerungen zufällig als richtig herausgestellt haben sollte? Omm Sety hätte aufgrund des enormen vorhandenen Fachwissens, des tiefen Verständnisses der altägyptischen Geschichte und Archäologie (immerhin war sie von Kindesbeinen an eine leidenschaftliche Ägyptenforscherin) und der Aufmerksamkeit für die richtigen Hinweise den wahrscheinlichen Standort der damaligen Gärten rekonstruieren können, der sich dann als tatsächlich korrekt herausstellen sollte. Immerhin lebte sie viele Jahre mit den Einheimischen in Abydos, sprach mit ihnen und hat vielleicht Überlieferungen mitbekommen über die Gärten, die nicht in den schriftlichen Aufzeichnungen der Ägyptologie dokumentiert waren …
Davon jedoch hat die alte Dame in keinem ihrer Interviews je etwas verlauten lassen. Und ich für meinen Teil möchte auch viel lieber daran glauben, dass Dorothy Eady eine wiedergeborene altägyptische Priesterin war, deren unglaubliche Einsichten und Entdeckungen die Grenzen unserer Vorstellungskraft sprengen, als sie lediglich als außergewöhnlich gut informierte Frau mit ungewöhnlichen Eigenheiten zu betrachten.
Ein ganzes Land voller Schätze und Gold – Gibt es El Dorado wirklich?
Goldene Schätze auf dem Grund eines Sees, eine goldene Stadt im Dschungel oder gar ein ganzes Land aus Gold – gibt es das sagenumwobene El Dorado wirklich? Nicht, dass nicht versucht worden ist, diesen Ort zu finden. Jedoch: bisher erfolglos.
Weil Gold seit jeher eine ungeheure Anziehungskraft auf uns Menschen ausübt, haben wir die Hoffnung jedoch noch immer nicht aufgegeben.
El Dorado – lasst euch den Namen mal auf der Zunge zergehen … Das klingt doch schon so mystisch und riecht regelrecht nach Abenteuer! Gut, vielleicht auch, weil die Legende um das »Goldland« über die Jahrhunderte so hochgeschaukelt wurde, dass sie bis heute der Hauch des Rätselhaften umweht. Oder auch des Verderbens … Aber lest selbst.
El Dorado gilt als einer der größten Mythen der Weltgeschichte. Und tatsächlich ist es bis heute nicht gefunden worden. Wobei es auch schwierig ist, etwas zu finden, von dem gar nicht ganz klar ist, welche Form und welches Ausmaß es hat. Geschweige denn, wo genau es sich befindet.
Erst mal bedeutet »El Dorado« im Spanischen nur »Der Goldene«, und man meinte damit einen Menschen, genauer einen Mann, genauer einen Häuptling oder König oder ganz grundsätzlich einen Herrscher. Mit der Zeit machte der Begriff – und was damit gemeint war – jedoch eine wundersame Wandlung durch und wurde erst zum Namen einer Stadt, bis er später für ein ganzes verborgenes Land aus Gold stand.25
Aber kehren wir zu den Anfängen und damit zum »Goldenen« zurück. Das war nämlich der jeweils neue Häuptling der Muisca, eines indigenen Volkes der Chibcha in den Anden Kolumbiens (das damals natürlich noch nicht so hieß, denn es war noch nicht entdeckt – Kolumbien heißt es erst seit 1819, aber das ist eine andere Geschichte).
Die Legende besagt nun, dass jeder neue Herrscher bei seinem Amtsantritt dem Sonnengott ein Opfer darbringen musste. Und zwar eines aus Gold. Der Herrscher selbst wurde auch in Form einer Paste mit Gold eingerieben (daher »Der Goldene«). »Er ging einher, über und über mit Goldstaub bedeckt, so selbstverständlich, als sei es Salz«26, formulierte es beispielsweise der bedeutendste Chronist der Eroberung Südamerikas durch die spanischen Konquistadoren, Gonzalo Fernández de Oviedo (1478–1557). Alsdann wurde der Herrscher auf einem Floß in die Mitte des Bergsees Guatavita gerudert, des meistverehrten der fünf heiligen Seen der Muisca, dorthin, wo dieser am tiefsten war. Dort wusch er sich die »Goldhaut« vom Leib – oder sprang, je nach Quelle, selbst ins Wasser – und warf die Opfergabe in die dunkelblaue Tiefe.27
Wie schade! Was für eine Verschwendung!, denken wir heute. Und auch die Menschen im 16. Jahrhundert mögen das gedacht haben. Außerdem aber auch: Wie viele Jahre lang haben die das wohl gemacht, und wie viel Gold mag da auf dem Grund des Sees herumliegen? Und darum machten sich eine Menge sogenannter Konquistadoren auf, genau dieses Gold zu bergen.
Vom Brauch der Muisca hatten die ersten spanischen Entdecker bei ihren Forschungsreisen Anfang des 16. Jahrhunderts erfahren, als sie in den Anden auf das indigene Volk trafen. Nein, hier muss ich genauer sein: nachdem sie die Muisca gefangen genommen hatten. Die haben den Eroberern die Geschichte also vielleicht nicht ganz freiwillig erzählt. Und möglicherweise haben sie in ihren Berichten auch etwas übertrieben, um ihre Peiniger hinters Licht zu führen …? Ich würde sagen: Zumindest das hat bestens funktioniert. Auch wenn sie damit sich selbst nicht retten konnten. Denn sie blieben unterworfen, und ihr Reich wurde von den Eroberern einfach in »Neu-Granada« umbenannt.28
Auch wenn der Muisca-Brauch schon damals seit vielen Jahrzehnten nicht mehr ausgeübt wurde, weckten die Erzählungen vom Gold auf dem Grund des Guatavita-Sees die Gier der Abenteuerreisenden nach diesem vermeintlich gigantischen Schatz. Einen Goldschatz hatte es in der nicht lange zurückliegenden Eroberungsgeschichte immerhin schon zweimal gegeben. Und zwar einmal das sogenannte Aztekengold, das sich Hernán Cortés im Jahr 1521 unter den Nagel gerissen hatte, nachdem er nach langer Belagerung und Kampf das aztekische Reich zerschlagen hatte. Und dann noch mal im Jahr 1533 bei der Eroberung des Inkareiches durch Francisco Pizarro González (zusammen mit seinen drei Halbbrüdern und seinem Verbündeten Diego de Almagro). Das Gold war im Übrigen als Lösegeld in Form von wertvollen Gegenständen für den von Pizarro gefangen genommenen Inka-Herrscher Atahualpa gezahlt worden. Pizarro ließ alles einschmelzen. Hingerichtet wurde Atahualpa trotzdem, obwohl die vollständige Summe Lösegelds gezahlt worden war.
Da bekommt der »sagenhafte Goldschatz der Inka« einen ganz schalen Nachgeschmack … Nicht so für die Konquistadoren des 16. Jahrhunderts! Die spornte das eher an: War es nicht wahrscheinlich – indigenes Volk war in ihren Augen schließlich indigenes Volk –, dass auch die Muisca einen enormen Goldschatz versteckt hielten?
Und sie fanden im See tatsächlich filigrane Goldschmiedearbeiten wie menschliche und tierische Figuren, zeremonielle Masken und güldenen Schmuck. Nur leider lange nicht in dem Ausmaß, in dem sie sich das ausgemalt hatten. Darum waren sich die gewitzten Konquistadoren schnell sicher: Das konnte nicht alles gewesen sein! Bestimmt hatten ihnen die Einheimischen nur einen Knochen hingeworfen … Und so musste, folgerichtig, der Ort, an dem das ganze Gold zu finden war, woanders sein.
Daraufhin entwickelte die Legende um El Dorado ein gewisses Eigenleben: Der Goldschatz und damit auch der Ort, an dem dieser zu finden sein musste, wurde größer und größer, wanderte vom Grund des geografisch lokalisierbaren Bergsees Guatavita auf den Grund des mystischen Parime-Sees in Guayana (heute Kooperative Republik Guyana) – und damit etwa 2000 Kilometer Luftlinie weiter. In diesem Zusammenhang tauchte auch erstmals der Name Manóa auf – angeblich eine unglaublich goldreiche und prachtvolle Stadt voller Schätze am Ufer des Parime-Sees. Mancher Entdecker betrachtete die Stadt Manóa als Zentrum, sozusagen Hauptstadt des El-Dorado-Reiches (nun war El Dorado also schon zu einem ganzen Reich mutiert!).
Der Parime-See ist tatsächlich auf Karten des flämischen Kartografen Jodocus Hondius von 1587 zu finden. Die Form des Sees änderte sich jedoch im Laufe der Jahre und bis ins 18. Jahrhundert hinein auf den Karten aus der Alten Welt (unter der »Alten Welt« wurden vor der Entdeckung Amerikas Europa, Afrika und Asien verstanden, zum Teil auch nur Europa), ebenso wie der Ort, an dem er zu finden sein sollte. Fakt scheint jedoch: Den Parime-See gibt es gar nicht und hat es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch nie gegeben – er ist eine reine Legende!29 Sodass – Spoiler, wir kommen noch dazu! – auch die Suche nach dem großen Schatz von El Dorado eine ganze lange Weile in die falsche Richtung ging.
Die Legende vom sagenhaften Goldland wurde immer weiter befeuert, zum Beispiel durch vermeintlich überlieferte Schilderungen ehemaliger Herrscher der Region um Guatavita sowie Berichte und Texte von Forschenden, aber auch Dichtern und Chronisten der Alten Welt – deren Handwerk jedoch, es sei mir gestattet, das kritisch anzumerken, von künstlerischer Freiheit (und Übertreibung?) lebt, oder nicht? Und so wanderte El Dorado nicht nur von einem Gewässer zum anderen, es ging auch an Land und wurde dabei in seinen Ausmaßen immer größer. Es galt mal als riesiger Tempel, mal als goldener Berg, mal als eine im Urwald »versunkene« Stadt, mal als ein ganzes Land aus Gold.
Der spanische Kartograf portugiesischer Abstammung Diogo Ribeiro erstellte im Auftrag der spanischen Krone schon im Jahr 1529 eine Weltkarte, auf der der gesamte Norden Südamerikas einfach als Castilla de Oro, als »Gold-Kastilien«, benannt war. Damit war gesetzt: sowohl der Herrschaftsanspruch Spaniens auf dieses Gebiet der »Neuen Welt« als auch der Anreiz für offenbar lohnenswerte Goldfunde im bis dahin noch unerforschten (und extrem unzugänglichen, sprich: gefährlichen) Landesinneren.30 Laut dem Credo »Wenn der Schatz nicht hier ist, ist er bestimmt dort«, ersann der berühmte US-amerikanische Dichter und Schriftsteller Edgar Allan Poe im Jahr 1849 die Spottballade »Eldorado«, in der die Abenteurer das Gold sogar auf dem Mond suchen: »Over the mountains of the moon, down the valley of the shadow, ride, boldly ride, the shape replied – if you seek for Eldorado!«31
So ungenau die Ortsbeschreibung und Beschaffenheit von El Dorado auch war, so klar ist doch, dass die Legende und die enorme Gier nach dem Gold, die diese in den Konquistadoren entfachte, als wichtigste Motivatoren für die Erkundung und Eroberung Südamerikas durch die Spanier angesehen werden können.
Fun Fact: Konquistador war übrigens damals eine echte Berufsbezeichnung. Das konnte jeder werden, der ausreichend Kapital hatte oder zur Verfügung gestellt bekam. Letzteres war nicht selten der Fall, weil die Entdeckung und Erschließung neuer Gebiete auch immer mit deren Eroberung zusammenfiel (ungeachtet der Tatsache, dass dort in den allermeisten Fällen seit Jahrhunderten bereits Menschen lebten). Und an der Eroberung neuer Landstriche mit Bodenschätzen und Co. hatten nicht wenige Herrscher der Alten Welt großes Interesse …
Tatsächlich bedeutet conquistador auf Spanisch und Portugiesisch nämlich »Eroberer« und nicht »Erforscher«, »Entdecker« oder noch romantischer »Abenteurer« oder gar »Glücksritter«, und genau darum ging es eben auch: um die Eroberung und Inbesitznahme neuer Länder und ihrer (Boden-)Schätze und Menschen.32 Und so gilt »Konquistador« auch als Sammelbegriff für all jene, die im 16. und 17. Jahrhundert große Teile Nord-, Mittel- und Südamerikas, der Philippinen und anderer Inseln als Kolonien besetzten. Und das waren eine ganze Menge: Über hundert Jahre zog sich diese blutige Zeit der »Erschließung«, besser: Eroberung, auch Conquista genannt, hin.
Als »Rechtfertigung« für die in der Regel brutalen Raubzüge und Unterwerfungsarien bemühten die Konquistadoren, meist Spanier, die im Jahr 1492 abgeschlossene Reconquista, die »Rückeroberung« der Iberischen Halbinsel, die sich die Mauren »unter den Nagel gerissen« hatten.
Moment … Tatsächlich waren die damaligen Bewohner der Iberischen Halbinsel zur Zeit der islamischen Expansion 711 gar keine »Spanier« im heutigen Sinne gewesen. Sie gehörten verschiedenen Kulturen, Reichen und auch Religionen an, darunter Westgoten, romanisierte Iberer, Mozaraber und Muslime. Der Begriff »Rückeroberung« entspringt einer sehr christlichen Sichtweise und Geschichtsschreibung, die darauf beruht, dass die christlichen Königreiche Land zurückgewinnen wollten, das irgendwann angeblich rein christlich gewesen sei (was schon mal nicht stimmte, siehe oben), auch wenn es zwischenzeitlich jahrhundertelang muslimisch regiert worden war. Und auch nach der Reconquista blieb die Iberische Halbinsel politisch und kulturell in verschiedene Bevölkerungsgruppen mit ganz eigenen Identitäten zersplittert. Die Idee des »geeinten Spaniens« entstand erst sehr viel später, und zwar im 15. Jahrhundert.33
Genau diese angebliche »Rückeroberung« war einer der Gründe, warum es vor allem Spanier und Portugiesen waren, die sich – wo sie gerade so schön dabei waren – dann ab dem 16. Jahrhundert als Konquistadoren auf den abenteuerlichen Weg über den Ozean und durch die »grüne Hölle« machten – und damit einen jahrhundertelangen Prozess der christlichen Eroberung einläuteten (beziehungsweise weiterführten). Dabei konnte man als gefühltes »Werkzeug Gottes« praktischerweise auch gleich sehr gut den christlichen Glauben unter den »Heiden« der »Neuen Welt« verbreiten.
Andere Gründe für die arg spanisch und portugiesisch geprägte Konquistadorenschaft war eine geografisch besonders günstige Lage im äußersten Westen Europas mit Zugang zum Atlantischen Ozean. Außerdem waren Spanier und Portugiesen Vorreiter in der Schifffahrt und Navigation.
Verzeiht den Exkurs zur Geschichtsschreibung, ich bleibe bloß manchmal an gewissen Ungereimtheiten derselben hängen, deren Auf-den-Grund-Gehen doch immer wieder erstaunliches Faktenwissen zutage fördert, das ich euch nicht vorenthalten möchte.
Nun aber zurück zu den größten und wichtigsten Konquistadoren, die sich aufgemacht haben, das sagenumwobene El Dorado zu finden. Los geht es mit: dem deutschen Statthalter Georg Hohermuth von Speyer (1500–1540) und Philipp von Hutten (1505–1546). Ja, ihr lest richtig! Auch wenn es größtenteils spanische und portugiesische Konquistadoren waren, haben auch deutsche Abenteurer nach dem Gold gesucht, und zwar sehr früh. Wie eben von Speyer und von Hutten in einer Expedition von 1535 bis 1538. Von Speyer startete geografisch günstig, war er doch ein Jahr zuvor gerade Gouverneur in der deutschen Kolonie Klein-Venedig (heute Venezuela) geworden. Bekannt war er darum auch als Jorge de Espira – so kommt man also zu einem wohlklingenden Namen …
Im Zuge der bereits erwähnten Vermutung, im Landesinneren von Südamerika müsse es ein großes verstecktes Reich aus Gold geben, machten er, von Hutten und 400 Expeditionsteilnehmer sich darum auf, den Bereich zwischen dem Río Japurá und dem Oberlauf des Río Meta zu erforschen. Ganze 500 bis 600 Kilometer Luftlinie vom Guatavita-See und damit dem Ursprung der Legende entfernt, übrigens. Nach einem Jahr erfolgloser, auszehrender Suche, bei der schon einige der Weggefährten den Tod gefunden hatten, traf der Tross auf auskunftsfreudige Einheimische – endlich! Sie berichteten von Menschen, die von Gold- und Silbergeschirr äßen und ihren Göttern in »großen Häusern« huldigten. Der Ort, um den es gehe, sei nur zwei Monde weit entfernt, der Weg führe über die Berge zu einer Hochebene.34 Der beschriebene Pfad war ganz schön unwegsam und führte tief durch die Wildnis … Von den Expeditionsteilnehmern blieben letztendlich nur 200 übrig. Die Suche nach dem Reich aus Gold blieb erfolglos.
Von 1536 bis 1539 versuchten sowohl der spanische Konquistador Sebastián de Belalcázar als auch Gonzalo Jiménez de Quesada (später der Gründer von Bogotá) unabhängig voneinander ihr Glück – und fanden es nicht. Wohl aber fanden zwei Drittel ihrer Männer und ein Großteil ihrer indigenen Träger den Tod,35 obwohl sie sich wieder näher am Gebiet der Muisca aufgehalten hatten. Immerhin brachte Quesada knapp 1800 Smaragde mit, von denen er seine wichtigsten Leute (die, die halt überlebt hatten) bezahlen konnte.
Gonzalo Pizarro, einer der Halbbrüder des erfolgreichen Inkaschatz-Entdeckers Francisco Pizarro, probierte es dann zwischen 1540 und 1542 noch mal in Zentralkolumbien und im Norden Brasiliens (man weiß ja nie …), zusammen mit Francisco de Orellana. Ihr Weg führte sie vom Westen her über die Anden an den Oberlauf des Río Napo – und das war kein Spaziergang. So überlebten von 350 Spaniern und 4000 (in Worten: viertausend!) indigenen Trägern auch nur 130 Spanier und 1000 Träger. Und diese menschliche Katastrophe konnte nicht mal durch die Entdeckung des gesuchten Goldlandes aufgewogen werden: El Dorado blieb weiterhin verborgen.
Zeitgleich machte sich Hernán Pérez de Quesada, der Bruder von Gonzalo Jiménez de Quesada (von oben) mit 270 Mann auf, noch mal genauer südlich zu schauen, sie drangen bis nach Putumayo, Caquetá und sogar bis ins heutige Ecuador vor. Jedoch: Auch diese Expedition blieb ohne Erfolg.
Doch Francisco de Orellana wollte einfach nicht glauben, dass nichts zu finden sein sollte: Und so machte er sich 1545 noch einmal auf den Weg und die Suche. Diesmal nahm er die große Wasserstraße, bekannt unter dem Namen Amazonas. Und zwar von dessen Mündung aus ins Landesinnere des heutigen Brasiliens. 2000 bis 2200 Kilometer Luftlinie vom Guatavita-See entfernt … Ihr ahnt es schon: erfolglos. Von 300 Expeditionsteilnehmern starben an die 260. Darunter Orellana selbst.36
Doch obwohl es jetzt tatsächlich mal einen von ihnen persönlich getroffen hatte, hatten die Konquistadoren noch immer nicht genug. So brach Gonzalo Quesada 1559 – und damit 20 Jahre nach seiner ersten Suche – ein weiteres Mal zu einer Expedition auf, und zwar hoffnungsvoll unter dem Namen »Gouverneur von Dorado« (möglicherweise hat sich der Mann ein klein wenig selbst überschätzt). Das Ende: kein Gold, sondern ein komplettes Desaster. Von 1300 Spaniern überlebten nur 64. Vielleicht war das dem Umstand geschuldet, dass der »Gouverneur von Dorado« seine Männer von Bogotá aus Richtung Oberlauf des Río Orinoco geleitet hatte, was immerhin 500 bis 700 Kilometer Luftlinie sind. Zu Fuß galt es dazu aber noch die folgenden Gebirgsketten und Höhenzüge zu überwinden, und zwar über Bergpässe mit eher, ich möchte sagen, schwierigen Straßenverhältnissen und möglicherweise noch nicht besonders gut ausgebauten Wegen: die Anden-Kordilleren, die Serranía de la Macarena sowie den Guayana-Schild.
Der kann das ja nicht richtig gemacht haben, dachten sich wohl Pedro de Ursúa und Lope de Aguirre ein Jahr später. Und machten es genauso falsch: Immerhin überlebten von 300 Teilnehmenden ganze 180, als sie (wieder einmal) das Gebiet um den Amazonas unter die Lupe nahmen, diesmal vom Unterlauf des Río Marañón aus, einem der Hauptquellflüsse des Amazonas.
1562 hatte dann jemand, namentlich der Kaufmann Antonio de Sepúlveda, mal eine wirklich gute Idee, wie ich finde, wobei er offenbar das Motto »Back to the roots« verfolgte: Nachdem so viele Forschungsreisen vorher in einer Sackgasse geendet waren, initiierte er die Entwässerung des Guatavita-Sees mithilfe eines Abflussgrabens. Sein Ziel: die auf dem Grund liegenden Schätze allesamt zu bergen. Dann die große Enttäuschung: Wegen Hangrutschungen musste die Unternehmung frühzeitig abgebrochen werden. All das verlief allerdings nicht ohne den Tod von einigen Hundert Indigenen, die zur Entwässerungsarbeit gezwungen worden waren. Immerhin konnte Sepúlveda reines Gold im Wert von zehn Gramm und anteilig goldene Schätze im Wert von 232pieces of eight