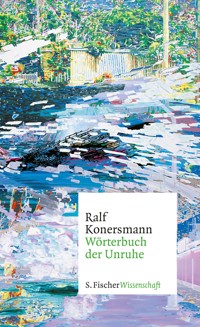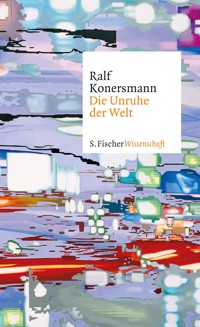16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: onomato
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Spiritualität und Mystik können den Menschen in Zeiten der Krisen, Notlagen, Herausforderungen und Unruhen die benötigte Lebenskraft, Mut und Sinn verleihen, indem sie unserem Sein und Handeln eine substanzielle Umwertung und Reorientierung geben. Doch wie genau verhält sich Mystik zum Problem der Unruhe des Menschen? Kann Mystik im Sinne einer gelebten Spiritualität und einer persönlichen Erfahrung der Transzendenz als ein nachhaltiges Mittel für die Überwindung der Unruhe dienen? Inwiefern können mystisch-spirituelle Lehren, Praktiken und Läuterungsmethoden für die Kultivierung der Seelenruhe nützlich werden? Was können wir heute im 21. Jahrhundert von den großen Mystikerinnen und Mystikern der Vergangenheit lernen und für die Bewältigung – oder vielleicht Erzeugung – unserer eigenen (positiven) Unruhen (über)nehmen? Diesen und vielen anderen Fragen widmet sich der vorliegende Sammelband, in dem sieben renommierte ExpertInnen die Frage nach der Beziehung der Mystik und Spiritualität zur Unruhe aus ihren jeweiligen Forschungsperspektiven kritisch darstellen und exemplarisch veranschaulichen. Das Verhältnis zwischen Mystik und Unruhe wird somit hier zum ersten Mal multiperspektivisch, interdisziplinär und systematisch beleuchtet. Dieses Buch stellt schließlich auch einen Versuch dar, mystische Traditionen und traditionelle Spiritualität stärker in den akademisch-wissenschaftlichen Diskurs zu rücken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
deíxis – Mystik in Sprache und Schrift, 1
Herausgegeben von Marco A. Sorace
Gefördert durch:
Die Ringvorlesung wurde veranstaltet durch:
ISBN 978-3-949899-05-8
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© onomato Verlag Düsseldorf 2025
Alle Rechte vorbehalten
onomato.de
Raid Al-Daghistani (Hg.)
Mystik und Unruhe
Inquietät als Grundbegriffeiner mystikbezogenenSpiritualität der Gegenwart
„Das Wort ‚Mystik‘ wird unterschiedlich verwendet. Manche denken an besondere, intuitive Illuminationen, aber diese Bedeutung ist eher marginal. Relevanter ist die verbreitete Auffassung, Mystik bestehe in einem Gefühl der Subjekt-Objekt-Einheit: der Mystiker sehe sich irgendwie ‚in eins‘ – mit Gott, mit dem Sein, mit allen Dingen. Damit ist ein wesentlicher Aspekt der meisten mystischen Konzepte in Ost und West bezeichnet, aber er ist meiner Meinung nach nicht der zentrale. Ich glaube, dass alle Mystik von einem bestimmten Motiv her zu verstehen ist: das mystische Gefühl der All-Einheit überkommt einen nicht einfach, sondern es wird gesucht. Warum? Eine Antwort auf diese Frage ist: Menschen haben ein Bedürfnis nach Seelenfrieden. Diese Antwort führt natürlich zu weiteren Fragen. Wieso kann beim Menschen, im deutlichen Unterschied zu anderen Tieren, das Bedürfnis nach Seelenfrieden aufkommen? Nicht weil sie, wie Buddha sagte, leiden, denn das tun auch die anderen Tiere, sondern weil sich ihre Seele in einer Unruhe befindet, die andere Tiere nicht kennen. Diese Unruhe hängt mit dem spezifischen menschlichen Selbstbezug zusammen. Vielleicht läßt sich sagen: alle Mystik hat zu ihrem Motiv, von der Sorge um sich loszukommen oder diese Sorge zu dämpfen.“
Ernst Tugendhat
VorwortMystik zwischen Unruhe und Ruhe
Raid Al-Daghistani (Münster)
Alles, was wir bisher sahen, zeigt uns aber auch, daß […] die Unruhe nicht umgegangen, sondern nur überwunden werden kann.(Gabriel Marcel)
… im Gedenken Gottes ruhen die Herzen(Koran 13:28)
Wir leben in unruhigen Zeiten. Die gegenwärtigen Weltereignisse sind in vielfacher Hinsicht beunruhigend und verunsichern unsere schon an sich fragile Existenz. Dazu hat jeder von uns auf persönlich-individueller Ebene mit ganz eigenen Herausforderungen und Krisen zu kämpfen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Unruhe als der wesentliche Bestandteil des menschlichen Daseins, ja als ein Existenzial bzw. als eine Art conditio humana des Menschen selbst: Der Mensch ist ein wesentlich unruhiges Lebewesen.1 Doch gerade diese innere, existenzielle Unruhe fungiert oft als Grund und Ursache für die Suche nach radikal neuen Wegen für die Gestaltung oder Umgestaltung des eigenen Lebens. Einer dieser Inspirationswege stellt für die Menschen eben die Spiritualität bzw. die Mystik2 dar. Sie können den Menschen in Zeiten der Krisen, Notlagen und Unruhen die benötigte Lebenskraft, Mut, Stütze und Sinn verleihen, indem sie – weit weg von zynischer Gleichgültigkeit oder bloßer Esoterik – unserem Sein und Handeln eine grundlegende Umwertung und Reorientierung geben.
Doch wie genau verhält sich Mystik zum Problem der Unruhe des Menschen? Kann Mystik im Sinne einer gelebten Spiritualität und einer persönlichen Tiefenerfahrung der Transzendenz als ein nachhaltiges Mittel für die Bewältigung und Überwindung der als negativ empfundenen Unruhe dienen? Inwiefern können traditionelle mystisch-spirituelle Lehren, Praktiken und Läuterungsmethoden der Kultivierung der Seelenruhe, der Ataraxie und der Harmonie nützlich sein? Oder ist ein mystisch-spiritueller Weg mit dem Anspruch auf die geistige Vervollkommnung des Menschen, die grundsätzlich mit der strengen Selbstdisziplin und dem Aufgeben der eigenen Komfortzone verbunden ist, vielmehr ein Weg der permanenten Herausforderungen, Konfrontationen, Anstrengungen und existenziellen Beunruhigungen?
Im Sufismus, der purgativ-mystischen Tradition des Islams, finden sich zahlreiche Positionen zugunsten beider Tendenzen bzw. Auffassungen. So lehrte beispielsweise einer der größten muslimischen Mystiker und Dichter, Ǧalāl ad-Dīn Rūmī (gest. 1273), dass das Ziel des Sufismus letztlich darin besteht, im Herzen Freude – und man könnte auch hinzufügen: Ruhe – zu finden, wenn die Zeit des Kummers kommt.3 Andererseits hebt der große Sufi-Meister aus Bagdad, Abū l-Qāsim al-Ǧuneid (gest. 910), hervor, dass der Sufismus eine „Gewaltsamkeit“ ist, in der es keine Ruhe bzw. keinen Frieden gibt.4 Doch schließen sich die beiden Positionen wirklich aus? Ist nicht ein Weg der Mystik, der oft – und zu Recht – mit einer inneren Reise assoziiert wird ein permanentes Balancieren zwischen Ruhe und Unruhe, das unter anderem auch und gerade zur stärkeren Resilienz des Menschen führt?5 Ferner: Was können wir heute von den großen spirituellen Mystikerinnen und Mystikern der Vergangenheit lernen und für die Bewältigung – oder vielleicht Erzeugung – unserer eigenen (positiven) Unruhen (über-)nehmen? Wie werden Unruhe und Ruhe in verschiedenen spirituell-mystischen Tradition aufgefasst, formuliert und verhandelt? Welcher Platz wird der Unruhe im Kontext des Glaubens, genauer, in Beziehung zwischen der gläubigen Seele und Gott, eingeräumt?6 So erklärt bereits Augustinus, dass das immanent und permanent unruhige Menschenherz schließlich nur in Gott Ruhe finden kann,7 während der muslimische Mystiker und der Verfasser des ersten systematischen Werkes zum Sufismus, Abū Naṣr as-Sarrāǧ (gest. 988), die Ansicht vertrat, dass die Wandelbarkeit das „Kennzeichen der Wirklichkeit“ selbst ist, weshalb der Mensch sich in jedem Augenblick im Wandel – ja, in Unruhe – seiner inneren Zustände befindet,8 womit die ontologische Unruhe sogar als eine anthropologische Konstante aufgefasst wird.
Und so sind wir wieder zur Ausgangsüberlegung zurückgekehrt, wonach die Unruhe als eine Art conditio humana aufzufassen ist. Doch inwiefern ist das genau der Fall? Von welcher Unruhe ist hier genau die Rede? Könnte man nicht der negativen Unruhe eine positive Unruhe, „die an sich einen Wert“ und „ein Prinzip des Übersteigens“ darstellt,9 gegenüberstellen? Und wie hängt die Unruhe mit anderen existenziellen Gefühlen und inneren Zuständen des Menschen – wie etwas Angst, Frieden, Hoffnung, Liebe, Sehnsucht und Getriebenheit – zusammen? Welche existenzielle Folge und Bedeutung hat die Unruhe für das menschliche Dasein und für seinen Glauben? In welchem Verhältnis steht die Unruhe zur Religiosität, Spiritualität und Mystik, nicht nur im Sinne der unitiven Wirklichkeitserfahrung, sondern auch im Sinne eines inneren Weges der Harmonie und der Glückseligkeit?10
Diesen und vielen anderen Fragen widmet sich der vorliegende Sammelband,11 in dem sieben renommierte Stimmen der diesbezüglichen Forschung der Frage nach der Beziehung der Mystik und Spiritualität zur Unruhe aus ihren jeweiligen Perspektiven kritisch nachgehen. Das Verhältnis zwischen Mystik und Unruhe wird somit hier zum ersten Mal multiperspektivisch, interdisziplinär, systematisch und exemplarisch beleuchtet. Damit soll auch die Bedeutung und Rolle von Mystik und Spiritualität in Kultur und Gesellschaft aufgezeigt und ihr, sowohl akademisch als auch in der breiten Öffentlichkeit (immer noch) dominierendes Image, eines rein kontemplativen und weltabgewandten Existenzmodus gründlich hinterfragt und neu bewertet werden. Dabei geht es also nicht um eine weltfremde „Mystik der verschlossenen Augen“, sondern ganz umgekehrt – im Sinne von Johann Baptist Metz – um eine„Mystik der offenen Augen“12, ja um eine für das Leid, die Not, die Unruhe und die Krisen der Welt sensibilisierte Mystik, die sich auch und gerade in der säkularen Zeit und in einer säkularisierten Welt bewusst behaupten kann.
Entsprechend zu unserem Vorhaben haben wir es versucht, die Beiträge unserer Ringvorlesung in eine systematische Reihenfolge zu bringen. Den Auftakt macht demnach Ralf Konersmann, der als namhafter Kulturphilosoph das Thema der existenziellen Unruhe in zwei vielbeachteten Bänden „Unruhe der Welt“13 und „Wörterbuch der Unruhe“14 in die philosophisch-wissenschaftliche Aufmerksamkeit gerückt hat. In seinem einleitenden Aufsatz mit dem Titel „Mystik, Gelassenheit, Spiritualität: Eine Untersuchung des Verhältnisses zwischen Ruhe und Unruhe“ nimmt er aus der Perspektive des Kulturanthropologen Bezug zur Gelassenheit bei Meister Eckhart. In diesem Zusammenhang begreift Konersmann die Mystik in ihrem doppelten Sinne sowohl als die Sühne einer im Sündenfall angenommenen Unruhe mit der Unruhe als auch als Bruch mit der Herrschaft der Unruhe, insofern sie einen Versuch darstellt, angesichts der Faktizität der Unruhe deren Potentiale zu nutzen, um aus ihr, der Unruhe, wieder herauszukommen.
Dem Beitrag von Konersmann folgt der Aufsatz der Theologin Christine Büchner, in dem sie aufzuzeigen versucht, dass Mystikerinnen und Mystiker – anders als sich bei oberflächlicher Betrachtung vermuten lässt – nicht einfach ein regungsloses und ruhevolles „Bei-Gott-Angekommensein“, ja ein in verlässlicher Einswerdung gegründetes „Ruhen in Gott“ kennzeichnet, sondern vielmehr eine bleibende Bewegung, insofern es keinen festen und allgemein verbindlichen „Ort“ für Gott gibt und wir uns daher immer neu auf die Suche nach Gott (und nach uns selbst) machen müssen, um „Ruhe zu finden inmitten der Unruhe“. Die Autorin bezieht sich dabei auf den französischen Mystik-Forscher Michel de Certeau, der in diesem Zusammenhang von Mystikern und Mystikerinnen als „Wandernden“ sprach, insofern sie an jedem statischen Ort vorüberziehen mit der Gewissheit „das ist es nicht“.
Meister Eckhart, vor allem sein Leitgedanke zu Abgeschiedenheit und Gelassenheit, nimmt dann wieder eine zentrale Stelle im anschließenden Aufsatz von Reiner Manstetten ein, in dem insbesondere die „Gebetspraxis der Stille“ thematisiert wird. Manstetten ist dabei – ähnlich wie Büchner – bemüht zu zeigen, dass die wahre Seelenruhe nicht im Gegensatz zur Bewegung steht, sondern dass sie aus einer inneren Freiheit und Gesammeltheit entspringt, die sich gerade in der Unrast des tätigen Lebens bewährt. Der Verfasser geht dabei der Frage nach, welche Wege zu innerer Ruhe und Seelenfrieden Meister Eckhart lehrt und was seine Lehren für heutige Menschen bedeuten.
Von Bekenntnissen des Augustinus ausgehend untersucht im folgenden Marco A. Sorace in seinem Artikel die Verbindung zwischen Mystik und Unruhe, welche er ebenso in Anlehnung an die Deutung Michel de Certeaus als eine Folge des Verlusts einer unitiven Ursprungserfahrung – also einer mystischen Einheitserfahrung – begreift. In diesem Sinne versteht er Mystikerinnen und Mystiker als jene, die in der Gewissheit dessen leben, was fehlt, was aber nach Sorace genau eine gewisse „Ruhe in der Unruhe“ ermöglicht. In seiner Untersuchung der Spannung von Unruhe und Ruhe in der christlichen Mystik fragt sich Sorace abschließend, welche religionsphänomenologische (und somit das Christentum übergreifende) Bedeutung eine so verstandene Mystik haben kann.
Doch während sich die ersten vier Beiträge des vorliegenden Bandes überwiegend auf die christliche Mystik beziehen, widmet sich Fabian Völker in seinem sehr ausführlichen Aufsatz überwiegend der mystischen Tradition des Buddhismus. Zunächst greift der Autor in seiner Einleitung aus der Sicht einer „interreligiösen Thanatologie“ kurz die Tradition des „mystischen Todes“ (mors mystica) im Christentum von Ambrosius von Mailand (gest. 397) bis Miguel de Molinos (gest. 1696) auf, bevor er anschließend zu den frühkanonischen Texten des Buddhismus übergeht. In diesem Zusammenhang diskutiert er dann das Verhältnis des Buddhismus zum Tod und geht auf die Frage ein, inwiefern der Buddhismus in einigen seiner Ausprägungen in eminenter Weise überhaupt als Mystik adressiert werden kann. Völker argumentiert, dass es dabei vor allem um die sogenannte nirodhasamapatti („Erlöschungszustand“ bzw. „mystische Versenkung“) geht, in der die Wahrnehmungen und Empfindungen mittels gewisser spiritueller Methoden unterdrückt werden. Das behandelte Phänomen perspektiviert der Verfasser abschließend noch aus religionsphilosophischer Sicht und argumentiert auf der Grundlage neukantianischer Positionen für eine dreifache Vernichtung (kognitiv, affektiv, volitional), womit er den eigentlichen Kern der Mystik letztendlich mit einem todesgleichen Trancezustand zu identifizieren versucht. Vor diesem Hintergrund geht der Aufsatz auch auf das Verhältnis zwischen Mystik und (Un-)Ruhe ein, wobei gerade die Mystik des Buddhismus als ein „Weg zur absoluten Ruhe“ ausgelegt wird.
Im darauffolgenden Beitrag, in dem das Wesen der mystischen Grundbegriffe bezüglich der Achtsamkeit im Sufismus analysiert werden, führt Reza Hajatpour in die purgativ-mystische Tradition des Islams ein. In diesem Zusammenhang behandelt Hajatpour die Methoden der „Kontemplation“ (taffakur), der „Invokation“ (ḏikr) und der „Introspektion“ (murāqaba) als die Grundaspekte eines ganzheitlichen und transformativen Achtsamkeitstrainings im Sufismus, den er wiederum als eine didaktisch-spirituelle Bildung des Menschen interpretiert. Doch untersucht werden hier nicht nur die gegenseitigen Relationen zwischen diesen sufischen Praktiken, sondern auch und vor allem deren Bezug zu einem Zustand der spirituellen Ruhe und Unruhe.
Eine gewisse Sonderstellung hat der Beitrag des Berliner Literaturwissenschaftlers und Kafka-Experten Hans Dieter Zimmermann. Dieser vor fast vierzig Jahren (1985) erstmals veröffentlichte, vom Autor leicht auf das Thema der Unruhe hin erweiterte Text springt an dieser Stelle ein für den Ringvorlesungsbeitrag des Judaisten Frederek Musall, der diesen aus persönlichen Gründen für den Tagungsband nicht fertigstellen konnte. Zimmermann versucht in seinem Aufsatz zu beleuchten, inwiefern Kafka seiner Erfahrung von existenzieller Unruhe auf der Grundlage seiner jüdischen Religion und Mystik begegnet, was von den Kafka-Forschern und Experten in der Regel aber – zum Teil sogar bewußt – übersehen wurde. So wird das angestrebte Religionsgespräch zum Thema „Mystik und Unruhe“ in seiner Breite aufrechterhalten. Ein herzlicher Dank geht an Hans Dieter Zimmermann für die Druckerlaubnis.
Ich danke zudem als Herausgeber vor allem der Unterstützung des Instituts für Islamische Theologie der Universität Münster, ohne welche die zugrundeliegende Ringvorlesung nicht hätte stattfinden können. Dann sei dem onomato-Verlag und dem Verlagsleiter Axel Grube gedankt für die engagierte Aufnahme dieses Bandes in sein Verlagsprogramm. Ein besonderer Dank gilt auch der Georges-Anawati-Stiftung für die wichtige Unterstützung bei den Druckkosten. Schließlich will ich auch meinem Kollegen Günter Müller danken für die kritische Durchsicht einiger Textmaterialien.
Am 30. März 2024,dem in jüdisch-christlicher Perspektiveruhig-unruhigen Tag des Karsamstags,Der Herausgeber
1Im religiösen Kontext lässt sich nach Gabriel Marcel der Grund dieser ursprünglichen, ja primordialen Unruhe im radikalen Ungenügen, „in dem wesentlichen Mangel, unter dem der Mensch als aus dem Nichts gezogenes Geschöpf leidet,“ erklären. (Marcel, G., Der Mensch als Problem. Knecht, Frankfurt a.M. 1957, 2. Aufl., S. 118).
2Der Begriff „Mystik“ wird hier in einem allgemeinen und doppelten Sinne sowohl als ein praktischer, purgativ-kontemplativer Weg und als das innigste Streben des Menschen nach metaphysischer Vereinigung mit der letzten Wirklichkeit (Gott, das Absolute, dem Urgrund, etc.) als auch als Lehre und Rede von einem solchen Läuterungs- und Kontemplationsweg verstanden. Die „Mystik“ selbst ist ein Sammelbegriff und lässt sich systematisch und historisch wenigstens auf die folgenden Kategorien beziehen: (1) Erfahrung der Auflösung der Grenze der eigenen Individualität (Mystik als Ich-Entgrenzung und All-Einheit); (2) Erfahrung der absoluten Gedankenleere, der Ekstase oder der überwältigenden Präsenz des absolut „Anderen“ (Mystik als Erfahrung der Überwältigung und/oder Versenkung); (3) Erfahrung der Aufhebung jeglicher Dualität, Gegensätzlichkeit und Vielheit (Mystik als unmittelbare Einheitserfahrung); (4) Erfassung des Übersinnlichen, Göttlichen, Transzendenten (Mystik als Gnosis); (5) existenziell-purgativ-initiatorischer Weg zur Einheitserfahrung (Mystik als spirituelle Läuterung); (6) Lehre und Literaturgattung, die derartige „immanente Transzendenz“ oder „transzendente Immanenz“ besingen (Mystik als Theorie und Literaturgenre); und (7) Berichte und Aussagen über die Erfahrung einer göttlichen oder absoluten Wirklichkeit (Mystik als theopathische Rede). Näheres zu Konzeptionen und erkenntnistheoretischen Grundlegungen mystischer Erfahrungen siehe z. B. Almond, P. C., Mystical Experience and Religious Doctrine. An Investigation of Mysticism in World Religions. De Gruyter, Berlin u. a. 1982, S. 174; Forman, R. K. C., The Problem of Pure Consciousness. Mysticism and Philosophy. Oxford University Press, New York – Oxford 1990, S. 3–49; Jones, R. H., Philosophy of Mysticism. Raids on the Ineffable. State University of New York Press, Albany, NY 2016, S. 46; Merrell-Wolff, F., Franklin Merrell-Wolff’s Experience and Philosophy. A Personal Record of Transformation and a Discussion of Transcendental Consciousness. State University of New York Press, Albany, NY 1994, S. 309–314; Smart, N., „The Purification of Consciousness and the Negative Path“; in: Mysticism and Religious Traditions. Hrsg. v. S. T. Katz. University Press, Oxford 1983, S. 117–129; Stace, W. T., Mysticism and Philosophy. Macmillan Press, London 1960, S. 129.
3Sh. Schimmel, A., Rumi: Ich bin Wind und du bist Feuer. Diederichs, Köln 1986. Dabei spielt die meditative Invokation Gottes (ḏikr) als die zentrale Praktik der sufischen Spiritualität eine wesentliche Rolle in der Erlangung der Seelenruhe (und der damit zusammenhängenden Seligkeit). Bereits im Koran können wir lesen: „…im Gedenken Gottes ruhen die Herzen“ (Koran 13:28).
4 Al-Qušayrī, ʿA. al-K., Das Sendschreiben al-Qušayrīs über das Sufitum. Steiner, Wiesbaden 1989, S. 387; Ar-risāla al-Qušayrīya fī ʿilm at-taṣawwuf. Al-maktaba al-ʿaṣrīya, Beirut 2007, S. 281. Sh. auch Al-Daghistani, R., Epistemologie des Herzens:Erkenntnisaspekte der islamischen Mystik. Ditibverlag, Köln 2023, 2. Aufl., S. 17.
5 Die Frage der Resilienz im Sinne einer inneren Haltung und Fähigkeit, in schwierigen und herausfordernden Situationen einen Widerstand leisten und sich den belastenden Lebensumständen anzupassen zu können, spielt insbesondere im Kontext der islamischen Spiritualität und Mystik eine besonders wichtige Rolle. Doch das an sich komplexe und interpretationsbedürftige Phänomen der Resilienz wird im Sufismus durch verschiedene religiöse Tugenden, innere Haltungen und existenzielle Fähigkeiten umgeschrieben. Zu diesen gehören etwa tawakkul („Gottvertrauen“), raǧāʿ („Hoffnung“), murāqaba („Achtsamkeit“) und vor allem ṣabr, der gängig mit „Geduld“ übersetzt wird, welcher aber darüber hinaus auch Aspekte der Ausdauer, innere Festigkeit, Überwindungskraft, Selbstbemühung, Widerstandsfähigkeit, Glaubensgewissheit und der seelischen Gelassenheit umfasst. Näheres zum Begriff ṣabr im islamisch-spirituellen Kontext siehe z. B.: al-Ǧurǧānī, M., Kitāb at-Taʿrīfāt. Dār an-nafāʾis, Beirut 2012. S. 206; al-Hujwīrī, ʿA. b. ʿU., Kashf al-Maḥjūb / The Revelation of the Veiled. Gibb Memorial Trust, o. O. 2000. S. 86; al-Qāšānī, ʿA. a.-R., Iṣṭilāḥāt aṣ-ṣūfiyya. Dār al-kutub al-ʿilmiyya, Beirut 2012. S. 116; al-Qušayrī Das Sendschreiben, S. 263–270; al-Qušayrī, Die Responsensammlung über das Sufitum; al-Qušairīs ʿUyūn al-aǧwiba fī funūn al-asʾila. Harrassowitz, Wiesbaden 2017. S. 101–102; as-Sarrāǧ, A. N., Schlaglichter über das Sufitum. Steiner, Stuttgart 1990. S. 96–97.
6 In dem Sinne macht bereits Gabriel Marcel darauf aufmerksam, dass es wichtig zu erkennen ist, „welche Art von Unruhe nicht nur mit dem Glauben vereinbar, sondern sozusagen notwendig ist, damit dieser nicht in eine fast passive Hingabe entartet, bei der die Seele Gefahr läuft zu erschlaffen, statt ihre kostbarsten Wirkungsvermögen entwickeln oder verwirklichen zu können“ (Marcel, Der Mensch als Problem, a.a.O., S. 93).
7„Unruhig ist unser Herz, bis dass es ruht in Dir.“ (Augustinus, Bekenntnisse, 1,1).
8Vgl. as-Sarrāǧ, Schlaglichter, a.a.O., S. 503; Kitāb al-lumaʿ fī-t-taṣawwuf. Brill, Leiden 1914, S. 366.
9Marcel, Der Mensch als Problem, a.a.O., S. 184–185.
10Gabriel Marcel merkt richtig an, dass während die Unruhe die menschliche Seele unaufhörlich von Gegenstand zu Gegenstand treibt – wobei genau dadurch keinen „Frieden für das Denken und infolgedessen keine Seligkeit gibt“ –, stellt die wahre Seligkeit „das Wohnen einer höchsten Wahrheit in der Seele, die zugleich das einzige Gute ist, weil sie Gott ist“ (Marcel, Der Mensch als Problem, a.a.O., S. 121–122). Zugleich lässt sich aber gerade in dieser Funktion der (religiösen) Unruhe ihr immanent positiver Wert erkennen, insofern sie den Menschen überhaupt dazu anregt, nach einer transzendenten Erfüllung zu suchen, die schließlich nur in der Fülle der Transzendenz vorzufinden ist.
11Das vorliegende Buch stellt das Ergebnis der im Jahr 2023 stattgefundenen, interdisziplinär und interkulturell konzipierten Online-Ringvorlesung „Mystik und Unruhe: Die Bedeutung und Rolle einer mystikbezogenen Spiritualität für die Gegenwart“ dar.
12Vgl. Obermüller, K., „Spiritualität und Verantwortung: Mystik Der Offenen Augen.“ In: Spiritualität und Wissenschaft. Hochschulverlag ETH, Zürich 2005, S. 109–120; vgl. dazu auch: Metz, J. B., Christliche Spiritualität in dieser Zeit (2012), in: Ders., Mystik der offenen Augen (Gesammelte Schriften Bd. 7), Herder, Freiburg i. Br. 2017, S. 11–25, hier S. 11.
13Konersmann, R., Die Unruhe der Welt. Fischer, Frankfurt a.M. 2017 (5. Aufl.).
14Konersmann, R., Wörterbuch der Unruhe. Fischer, Frankfurt a.M. 2017.
Die Welt noch einmal, aber ohne UnruheÜber die mystische Idee der Gelassenheit
Ralf Konersmann (Kiel)
Vorab darf ich kurz erläutern, wie ich das Thema angehe: Im ersten Teil meiner Ausführungen möchte ich zeigen, wie die westlichen Kulturen, ihrer eigenen Erzählung folgend, in die Unruhe hineingeraten sind. Die Kulturen des Westens, das ist meine Ausgangsthese, zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Unruhe angenommen haben und sich bis heute zu ihr bekennen. Die Namen der Unruhe, die durchweg Zustimmung signalisieren, sind in der Sprache der Öffentlichkeit allgegenwärtig: Bewegung und Veränderung, Entwicklung und Fortschritt, Aufbruch und Neubeginn, Überbietung und Überschreitung, Transgression und Transformation. Was all diese Trendvokabeln miteinander verbindet, ist die grundlegende, allen weiteren Entscheidungen vorgreifende Weigerung, die Dinge auf sich beruhen zu lassen. Wie aber ist es zur Fraglosigkeit dieser elementaren Orientierung, dieser totalen Ausrichtung auf Unruhe gekommen?
Im Zusammenhang mit dem Rahmenthema dieser Ringvorlesung, mit dem Thema „Mystik und Unruhe“, ist die Vergegenwärtigung aufschlussreich, dass die klassische Erzählung vom Ursprung der Unruhe eine religiöse Erzählung ist.
Die Unruhe, so lautet in extremer Verkürzung der Tenor dieser Erzählung, ist die Konsequenz der Vertreibung des Menschen aus einer Welt, die eine Welt der Ruhe gewesen war und mit dem Ereignis der Vertreibung verlorenging.
Anschließend an diesen ersten Teil und in der Hauptsache möchte ich zeigen, wie speziell die christliche Mystik sich dieser Ausgangslage, dieser Herausforderung an die menschliche Situation, bewusst war und sich ihr gestellt hat. Die Mystik, möchte ich zeigen, macht den Versuch, schärfer noch: sie ist der Versuch, angesichts der Faktizität der Unruhe deren Potentiale zu nutzen, um aus ihr, der Unruhe, wieder herauszukommen.
Aus philosophischer Sicht und – weitere Einschränkung – mit Blick lediglich auf ein überschaubares Teilstück der christlichen Mystik springt eine weitere, gegenstandsbezogene These heraus. Sie besagt: Die Mystik ist beides – eine Form der Sühne, denn sie verleugnet die Unruhe nicht; sie ist aber auch und zugleich eine Form der Wiedergutmachung, denn sie ist entschlossen, mit der Herrschaft der Unruhe zu brechen.
Die durch die Überwindung der Unruhe wiedergefundene Ruhe heißt, in der Sprache Meister Eckharts, „Gelassenheit“. Das damit erschlossene Motiv, das Motiv der Wiedererlangung der Ruhe durch Gelassenheit, werde ich in den Mittelpunkt meiner Überlegungen stellen.
Ich werde also – dies als dritte Einschränkung –, wenn ich im Folgenden das Wort „Mystik“ verwende, lediglich diese eine und einzige Spur der christlichen Mystik verfolgen, die sich durch Eckharts sogenannte „Reden der Unterweisung“ hindurchzieht. Keineswegs will ich, der Warnung Gershom Scholems2 eingedenk, auf dieser beschränkten Grundlage so etwas wie einen allgemeinen Begriff der Mystik oder des Mystischen statuieren. Es wäre im Gegenteil interessant zu erfahren, ob sich für das, was ich im Folgenden vortragen werde, in der Mystik des Islams, in der Mystik des Judentums oder in anderen, einstweilen unberücksichtigten Teilen der christlichen Mystik Familienähnlichkeiten finden lassen.
Der erste Teil meines Vortrags basiert auf dem entsprechenden Kapitel meines Buches über Die Unruhe der Welt. Grundlage des zweiten Teils wird der Essay zum Thema Gelassenheit sein, der im Rahmen meiner Arbeit am Wörterbuch der Unruhe entstanden ist.3
1. Genese der Unruhe
Beginnen wir also, wie angekündigt, mit der Urerzählung, mit der Erzählung vom Aufkommen und vom Eindringen der Unruhe in die Erfahrungswelt des Menschen.
Ich biete diese Geschichte, die im Buch Genesis keine sechs Spalten füllt (Genesis 2,1-4,15), in nochmals geraffter Form. Dieser, der biblischen Urerzählung zufolge müssen wir uns das Paradies als Garten vorstellen. Das Paradies ist also nicht und gerade nicht die menschliche Kultur; es ist das Inbild einer menschenfreundlichen Natur, die Gottes Schöpfung ist – ein friedvoller, angenehm klimatisierter Park, in dem alle Bewohner ohne Anstrengung und Beängstigung ihr Auskommen finden.
Das Dasein im Paradies war sorgenfrei, weil es genau so geschaffen war, wie man es von einem fürsorglichen Schöpfer wohl erwarten durfte. An alles hatte dieser Vatergott gedacht und jedes Bedürfnis vorausgesehen, das die Paradiesbewohner jemals entwickeln würden. So lebten Mensch und Welt in vollkommener Entsprechung, und diese Entsprechung war sowohl das Zeichen als auch die Garantie ihrer Ruhe.
Kein Bedürfnis der Menschen blieb unbefriedigt, und umgekehrt: Bedürfnisse, die sich nicht hätten befriedigen lassen, lagen außerhalb jeder Vorstellung. Das Glück dieser Ursprungsgeschöpfe erfüllte sich als ungestörte Wunschlosigkeit, und eben dieser Zustand, der jede Form des Unbefriedigtseins oder des Unbehagens, jede Not und jeden Mangel vorgreifend ausschloss, gewährte ihnen die Ruhe. Unruhe und Stress hatten keinen Zugriff.
Im Anfang war die Ruhe. Und da diese Ruhe, die paradiesische Ruhe, direkt aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen war, verkörperte sie, zumindest im Einflussbereich des jüdisch-christlich geprägten Westens, jahrhundertelang das menschliche Daseinsideal schlechthin. Aber, so erzählt der religiöse Mythos weiter, die Ruhe des Anfangs ging verloren. Die Menschen erwiesen sich als unwürdig, als leichtfertig und vorwitzig, und zur Strafe wurde ihnen die Ruhe genommen. Die Vertreibung aus dem Paradies war die Vertreibung aus der Ruhe.
Es ist namentlich Kain, der erste von Menschen gezeugte Mensch, der die Verstoßung in die Unruhe gleichsam exemplarisch erfahren und erleiden muss. Der Mord an seinem Bruder Abel – und das heißt: ein erneuter, sündhafter Verstoß gegen das göttliche Gesetz – motiviert seine Verbannung, die Ausweisung in das Land Nod, und das heißt wörtlich übersetzt: in das Land der Unruhe. Der Fluch Jahwes, der diese Verstoßung vollzieht, offenbart die archaische Gewalt, mit der, dem Mythos zufolge, in diesem Schicksalsmoment die Unruhe das Leben der Menschen erfasst. Ich zitiere die bekannten Worte aus Genesis 4,12: „Rastlos und ruhelos wirst du auf Erden sein“.
Man muss die Szene genau betrachten, um zu ermessen, was mit diesem Bannfluch gesagt und was mit ihm entschieden war. Es handelt sich, wie der Theologe Erik Peterson richtig gesagt hat, um nichts geringeres als eine ‚Veränderung im Sein‘. Die Unruhe, von der im Genesis-Bericht die Rede ist, ist nicht lediglich eine nervöse Aufwallung, ist nicht einfach ein gelegentliches Erregtsein, und schon gar nicht ist sie eine Vorahnung dessen, was spätere Zeiten Fortschritt nennen und geschichtstheoretisch einbetten werden. Diese Unruhe, von der im Buch Genesis die Rede ist, markiert den Einbruch einer existentiellen, das Dasein insgesamt erschütternden Ungeborgenheit, die, angesichts der Vorgeschichte der paradiesischen Ruhe, bis zu diesem Augenblick ohne Beispiel war.
Das aber besagt: Die Unruhe war und, möchte ich hinzusetzen, ist ein Widerfahrnis. Sie ist unfassbar, ist eigentlich namenlos, ist der Deckname für etwas nie Gekanntes und, aus der Sicht dieses paradigmatisch Betroffenen, soeben noch Unvorstellbares. Die Namen der Unruhe – Unrast,restlessness, inquiétude, inquietudine – halten diese Implikation bis heute fest. Sie beschränken sich auf die Verneinung, so als ließe sich positiv gar nicht bestimmen und sagen, was alles mit diesem Namenwort verbunden und ausgesprochen ist.
Die Unruhe ist also nicht einfach ein hinzugetretenes Element, das, etwa in der Art einer Intervention, die vormals gewahrte Ruhe stört; die Unruhe ist das Zeichen und, überdies, das reale Ausgeliefertsein an eine ganz und gar andere und fremde Welt.
Die mit der Unruhe eingetretenen Daseinsumstände sind anders als alles, was den Menschen – in der Erzählung des Mythos: den Eltern Kains – bis dahin widerfahren und begegnet war. Die Unruhe markiert einen zweiten Ursprung, sie hat den Rang einer zweiten Geburt.
Angesichts dieser Qualität rückt sie in die Reihe der großen Menschheitsthemen ein, die, wie die Kondition des Geborenseins (Natalität) und die Bedingung der Sterblichkeit (Mortalität), dem Dasein des Menschen ihr Gesetz aufprägen. Der Mythos macht die Bedingung der Unruhe – die Inquietät – als Grund, oder genauer: als den grundlosen Grund der menschlichen Wirklichkeit fassbar, und das heißt: als etwas, das unvermittelt zu der Urschöpfung hinzugetreten ist und, als von höchster Stelle verfügt, wie Natalität und Mortalität jenseits des von Menschen Beeinflussbaren liegt.
Die Einzelheiten des göttlichen Fluchs verdeutlichen die Beispiellosigkeit der eingetretenen Situation. Jahwe unterstreicht das Gewicht seines Urteils, indem er direkt, ohne Mittler und Boten, an Kain, der seinen Bruder erschlug und Jahwe zu täuschen versuchte, herantritt und ihn anspricht. Auch die Wortwahl exponiert den Urteilsspruch im Zusammenhang dieses ohnehin dramatischen Geschehens. Der Pleonasmus „rastlos und ruhelos“, der dem künftigen Dasein Kains den Namen gibt, ist in der hebräischen Urfassung einmalig. Er findet sich nur in dieser einen Episode in Genesis 4,12 und 14. Wie das, was er mitzuteilen hat, fällt auch der Text selbst, seine Sprache, aus dem Rahmen.
Die Härte des Fluchspruchs unterstreichend, legt die gewählte Formulierung die Vorstellung nahe, dass Kain ‚verscheucht‘ wird wie ein wildes Tier, dass er blind ‚umhertaumeln‘ und man ihn ‚jagen‘ und ‚hetzen‘ werde. Schon mit dieser Wortwahl kommt die Darstellung dem in der jüngeren Rezeptionsgeschichte verbreiteten Beschwichtigungsbedürfnis zuvor, das sich das Schicksal der Zwangsemigration als Nomadentum zurechtlegt, um es dadurch akzeptabel und irgendwie sogar reizvoll erscheinen zu lassen. Die Härte der Unruhe findet ihren Ausdruck darin, dass jede Aussicht, die neue Wirklichkeit als neue Heimat zu entdecken und sie dauerhaft anzunehmen, verloren ist. Der Mensch wird das Wesen sein, das unruhig ist – das Wesen, das mit sich und seiner Welt niemals dauerhaft im Reinen ist.
So ist die Welt der Unruhe nicht nur vorübergehend, sondern endgültig unwirtlich. Kain ist unzugehörig schlechthin, ein Vagabund, ein Getriebener, und die weiteren Auskünfte der Darstellung lassen keinen Zweifel an seiner Ausgesetztheit. Er habe „ein schweres Joch“ zu tragen und müsse in der „Angst des Herzens“ leben, heißt es. „Noch auf dem Bett zur Ruhezeit“, bezeugt Ben Sira, „verwirrt der nächtliche Schlaf ihm den Sinn“ (Jesus Sirach 40,1-5).
Im Erzählrahmen des Mythos ändert auch die Stadtgründung, die Kain im Anschluss an die Vertreibung in Angriff nimmt (vgl. Genesis 4,12), an der Endgültigkeit seiner Verworfenheit nichts. Kein Geringerer als Augustinus wird ihn, in scharfem Kontrast zu dem im Genesis-Bericht schemenhaft bleibenden Abel, als Gründerfigur der civitas terrena ansprechen, die nicht „nach Gott“ (secundum Deum) gestaltet ist, sondern „nach dem Menschen“ (secundum hominem).4 Im mythischen Schema ist die Stadt, die Kain im Land Nod gründen wird, nur die nochmalige Bestätigung der Inquietät. Während Abel zur Ausnahmegestalt, zum emblematischen „Fremdling auf Erden“ (peregrinus; s.a. Hebräer 11,13) wird, beginnt nun die lange Gefangenschaft der Kinder Kains im Unruhebetrieb der Kultur, beginnt die zutiefst irritierende Normalität der Rastlosigkeit, der Hektik und ziellosen Betriebsamkeit.
2. Genese der Gelassenheit
Das also ist die Situation: Die von dem biblischen Erzählstück vor Augen gestellte Unruhe ist benannt, sie ist in der Welt und, in der Figur des Kain, exemplarisch erlebbar geworden. Sie hat einen Anfang, aber kein Ende, und sie kann auch kein Ende haben, weil sie aus der Perspektive des Jetzt und Hier betrachtet die reine Unbestimmtheit ist.
Inhalt
Vorwort Mystik zwischen Unruhe und Ruhe
Die Welt noch einmal, aber ohne Unruhe Über die mystische Idee der Gelassenheit
1. Genese der Unruhe
2. Genese der Gelassenheit
3. Spiritualität
Bibliografie:
Ruhe in der Unruhe – Nähe in der Ferne – Gegenwart im Vermissen Zentrale Aspekte christlicher Mystik im heutigen Kontext
1. Einleitung
2. Mystik: Vom Rand in die Mitte
3. Christliche Mystikerinnen und Mystiker des Spätmittelalters
3.1 Meister Eckhart (1260-1328): Ruhe in der Unruhe –Zuhause auf dem Weg
3.2 Marguerite Porete (1250/60-1310): Nähe in der Ferne
3.3 Mechthild von Magdeburg (ca. 1207-1282): Gegenwart im Vermissen
4. Fazit
Bibliografie
Ruhe und Unruhe in der Mystik Meister Eckharts
Einführung
1. Meister Eckharts Leben
2. Eckharts mystische Auslegung der Bibel
3. Mystische Erfahrung
4. Gelassenheit: Von Ich-Bindung und Besetzungen
5. Das Atemgebet
6. Innerer und äußerer Mensch
Statt eines Fazits: Meister Eckharts Lob der Unruhe
Bibliographie
„Unruhig ist unser Herz, bis dass es ruht in Dir.“ (Augustinus) Über die Spannung von Unruhe und Ruhe in der christlichen Mystik
1. Einleitung
2. Mystik und Unruhe bei Michel de Certeau
2.1. Eine „Mikro-Historie“ der Unruhe in Loudun
2.2. Gott anderswo? – Studentenunruhen
2.3. Hieronymus Bosch – Ikone der Unruhe
2.4 „De visione Dei“ – Blick, Glaube, Gewissheit
3. Mystik und Gewissheit
3.1. Über Gewissheit: Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
3.2. Die Lebensgewissheit und das „Begehren der Mystik“: Rolf Kühn (* 1944)
Fazit
Bibliographie
Buddhistische Todesmystik: Zur religionsphilosophischen Deutung der todesgleichen Trance der nirodhasamāpatti
1. Interreligiöse Thanatologie: Zur christlichen Vergleichsgrundlage
2. Buddhistische Mystik?
3. Die mystische Antizipation des Todes und des nirvāṇa in der nirodhasamāpatti
4. Zwischen Gnosis und Mystik: Frühbuddhistische Zeugnisse zur nirodhasamāpatti
5 . Zur religionsphilosophischen Deutung der nirodhasamāpatti
6. Fazit: Nirvāṇische Ruhe inmitten saṃsārischer Unruhe
Bibliographie
Von der geistigen Meditation zum Gottesbewusstsein: ein Prozess der Achtsamkeit in der islamischen Mystik
1. Zikr: Eine verbale Meditation?
2. Fikr: eine geistige Vertiefung
3. Murāqaba: Achtsamkeit durch asketische Selbstbeobachtung
Fazit
Bibliografie
Franz Kafkas Judentum im Spannungsfeld von Unruhe und Ruhe
1. Kafka und die messianische Erwartung
2. Kafka und das Gesetz
3. Kafka und die mystische Sprachauffassung
4. Kafka und die Hierarchie der Welten
5. Ein kurzes Fazit
Bibliographie
Anhang Autorin und Autoren
Landmarks
Table of Contents