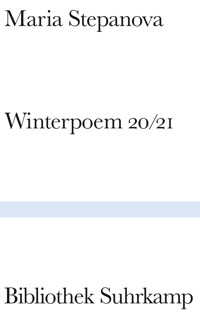14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Liebesgeschichten und Reiseberichte, Reflexionen über Fotografie, Erinnerung und Trauma: In einer dichten poetischen Sprache verwebt Maria Stepanova Fundstücke zu einem Jahrhundert ihrer jüdisch-russisch-europäischen Familiengeschichte.
Maria Stepanova erzählt von ihrer weitverzweigten Familie von Ärzten, Architekten, Bibliothekaren, Buchhaltern und Ingenieuren, die in unzivilisierten, gewaltgeprägten Zeiten ein stilles, unspektakuläres Leben führen wollten. Prädestiniert, Opfer von Verfolgung und Repressionen zu werden, ist es all ihren Verwandten gelungen, die Schrecken des 20. Jahrhunderts zu überleben. Wie war das möglich? Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln durchmisst die Autorin einen Gedächtnisraum, in dem die Linien des privaten Lebens haarscharf an den Abbruchkanten der Epochenlandschaft entlangführen. »Bei allen anderen bestand die Familie aus Teilnehmern der Geschichte, bei mir nur aus ihren Untermietern.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Maria Stepanova
Nach dem Gedächtnis
Roman
Aus dem Russischen von Olga Radetzkaja
Suhrkamp Verlag
»Und was für einen Zweck haben schließlich Bücher«, sagte sich Alice, »in denen überhaupt keine Bilder und Unterhaltungen vorkommen?«
Lewis Carroll
Großmutter sagte: Wahrscheinlich kommt er jetzt einfach in das Alter. Trink ruhig, mit den Lebenden trink so viel du willst, aber nicht mit den Toten. Ich begriff nicht. Mit den Toten trinken, wie soll das gehen. Und ob das geht, sagte Großmutter. Die meisten Leute trinken sogar vor allem mit den Toten. Davon lass die Finger. Sonst trinkst du ein Glas, und hundert Jahre sind vorbei. Noch ein Glas – wieder hundert Jahre. Und noch eines – noch mal hundert. Wenn du dann aus dem Haus gehst, sind dreihundert Jahre einfach weg. Niemand erkennt dich mehr, es ist eine andere Zeit. Sie wollen mir Angst machen, dachte ich, weil ich ein Kind bin.
Viktor Sosnora
»Wie furchtbar«, sagten die Damen, »aber was ist daran so erstaunlich?«
Alexander Puschkin
Inhalt
Teil I
1 Fremde Tagebücher
2 Anfänge
3 Einige Fotos
4 Sex unter Toten
Zwischenkapitel • 1942 oder1943
5 Das Aleph und die Folgen
6 Love Interest
7 Facetten der Ungerechtigkeit
Zwischenkapitel • 1930
8 Defekte und Diversionen
Zwischenkapitel • 1934
9 Die Frage der Wahl
Teil II
1 Das Jiddl taucht unter
Zwischenkapitel • 1905-1915
2 Goldchain addiert, Woodman subtrahiert
3 Mandelstam verwirft, Sebald verwahrt
Zwischenkapitel • 1947 (?)
4 Einerseits, andererseits
5 Charlotte oder Der Ungehorsam
Zwischenkapitel • 1980, 1982, 1983, 1985
6 Jakobs Stimme, Esaus Bild
7 Ljodik oder Das Schweigen
8 Joseph oder Der Gehorsam
9 Was ich nicht weiß
Teil III
1 Seinem Schicksal entkommt man nicht
2 Ljonja aus dem Kinderzimmer
3 Jungen und Mädchen
4 Die Tochter des Fotografen
Dank
Teil I
1
Fremde Tagebücher
Meine Tante war gestorben, die Schwester meines Vaters, mit etwas über achtzig Jahren. Wir standen uns nicht nahe, und daran hing ein langer Schweif familiärer Missverständnisse und Kränkungen. Das Verhältnis meiner Eltern zu ihr war kompliziert gewesen, und eine eigene Geschichte zwischen ihr und mir hatte sich kaum entwickelt. Ab und zu telefonierten wir, noch seltener sahen wir uns, doch mit den Jahren, in denen sie immer öfter das Telefon abstellte (»Ich will niemanden hören!«), verschwand sie zusehends hinter einer selbstgebauten Kulisse, zwischen zahllosen Sachen und Sächelchen, mit denen ihre kleine Wohnung vollgestellt war.
Tante Galja träumte ihr Leben lang von Schönheit: von jener entscheidenden Renovierung, bei der die Möbel ein für alle Mal umgestellt, die Wände gestrichen, die Gardinen gewechselt würden. Irgendwann, vor Jahren, hatte sie mit einem Hausputz begonnen, der nach und nach von der ganzen Wohnung Besitz ergriff. Fortwährend wurde das Unterste zuoberst gekehrt; das Inventar musste gesichtet und systematisiert, über jede Tasse musste nachgedacht werden, Bücher und Papiere waren nicht mehr sie selbst, sondern nur noch Usurpatoren des Raums, die in Stapeln, Bergen, Barrikaden die Wohnung besetzten. Während die Gegenstände sich des einen der beiden Zimmer bemächtigten, zog Galja mit dem Allernötigsten ins andere. Doch auch dort setzte das Sortieren und Revidieren ein; die Wohnung hatte ihr Inneres nach außen gestülpt und konnte es nicht wieder aufnehmen. Es gab nichts Wichtiges und nichts Unwichtiges mehr, alles hatte irgendeine Bedeutung, besonders die über Jahrzehnte gesammelten vergilbten Zeitungsausschnitte, die, zu hohen Säulen gestapelt, Wände und Bett stützten. Für die Hausherrin war nur noch auf einem durchgesessenen kleinen Sofa Platz; dort, inmitten eines stürmischen Meers aus Ansichtskarten und Fernsehzeitschriften, saßen wir auch bei jenem Besuch, an den ich mich vor allem erinnere. Sie tischte mir irgendwelche Zucchini auf, drängte mir mit Macht die für Gäste reservierten kostbaren Pralinen auf, ich lehnte schnöde ab. Der zuoberst liegende Ausschnitt trug die Überschrift »Welche Ikone passt zu meinem Sternzeichen?« Am Rand war ordentlich der Name der Zeitung und das Datum der Veröffentlichung vermerkt, in makelloser Handschrift, blaue Tinte auf leblosem Papier.
*
Wir trafen etwa eine Stunde nach dem Anruf der Pflegerin ein. Das Treppenhaus war von summendem Halbdunkel erfüllt: Auf den Stufen und dem Treppenabsatz standen und saßen fremde Leute, die irgendwie von dem Todesfall erfahren hatten und herbeigeeilt waren, um ihre Bestattungsdienstleistungen anzubieten, Hilfe beim Papierkram, Hinbringen-Abholen-Beglaubigen, wir kümmern uns. Wer hatte sie informiert, die Miliz, die Ärzte? Einer trat mit uns ins Zimmer und stand dort herum, noch in seiner Winterjacke.
Tante Galja war am Abend des 8. März gestorben, des sowjetischen Fests der Mimosen und Entenpostkarten, an einem der Tage also, an denen unsere Familie sich regelmäßig versammelte, an denen der breite Wohnzimmertisch ausgezogen wurde, das Sprudelwasser in die dunklen, rubinroten Gläser floss und die vier obligatorischen Salate serviert wurden: Karotten mit Nüssen, Rote Bete mit Knoblauch, Käsesalat und der große Gleichmacher »Olivier«. All das war schon dreißig Jahren her, es war zu Ende gewesen, lange bevor meine Eltern nach Deutschland emigrierten, Tante Galja wütend zurückblieb und die Zeitungen aufregende Dinge zu drucken begannen: Horoskope, Rezepte, die neuesten Naturheilmittel.
Sie wollte auf keinen Fall ins Krankenhaus. Im Krankenhaus waren ihre Eltern gestorben, meine Großeltern, und auch sie selbst hatte ihre Erfahrungen mit der staatlichen Medizin gemacht. Trotzdem schien es irgendwann unumgänglich, einen Krankenwagen zu rufen, und so wäre es auch gekommen, wären da nicht die Feiertage gewesen; man beschloss, bis zum nächsten Werktag zu warten – und das verschaffte Galja die Möglichkeit, sich auf die Seite zu drehen und im Schlaf zu sterben. Im Nebenzimmer, wo die Pflegerin wohnte, hingen schachbrettförmig über die ganze Wand verteilt die Fotos und Zeichnungen meines Vaters, neben der Tür ein Schwarz-Weiß-Bild aus den sechziger Jahren, aus meiner Lieblingsserie über eine Tierklinik: Das Foto zeigt ein Wartezimmer, in dem Schulter an Schulter Hund und Herrchen sitzen, ein grimmig dreinblickender, etwa vierzehnjähriger Junge und sein Boxer.
*
Die Wohnung wirkte perplex, geschrumpft, voller plötzlich entwerteter Dinge. In den Ecken des größeren Zimmers schwiegen dürre Fernsehergerippe. Der riesige neue Kühlschrank war vollgestopft mit eiskaltem Blumenkohl und eingefrorenem Brot (»Mischenka isst so gern Brot, kauf ruhig mehr«). In den Bücherschränken grüßten lauter alte Bekannte – Wer die Nachtigall stört, der Salinger-Band im schwarzen Umschlag mit dem Jungen darauf, die blauen Buchrücken der »Bibliothek der Dichter«, die graue Tschechow- und die grüne Dickens-Ausgabe. Auf einer Konsole vertraute Gestalten: zwei Hündchen, eines aus Holz und eines aus gelbem Plastik; ein geschnitzter Bär mit Wimpel. Alle saßen da wie vor dem Aufbruch zu einer Reise und schienen sich plötzlich überflüssig zu fühlen.
Als ich einige Tage später daran ging, Galjas Papiere zu ordnen, fand sich zwischen Fotos und Grußpostkarten fast nichts Schriftliches. Stattdessen entdeckte ich stapelweise warme Unterhemden und Offiziersunterhosen sowie neue, hübsche Blazer und Röcke, die für einen besonderen, festlichen Anlass gedacht und deshalb nie getragen waren, sie rochen immer noch nach sowjetischem Konfektionsgeschäft. Es gab ein besticktes Männerhemd aus der Vorkriegszeit und geschnitzte Elfenbeinbroschen, zierlich und mädchenhaft – eine Rose, noch eine Rose, ein Kranich; sie hatten Galjas Mutter gehört, meiner Großmutter Dora, und waren seit vierzig Jahren nicht mehr getragen worden. Zwischen diesen Dingen bestand ein fragloser Zusammenhang, sie alle hatten nur im gemeinsamen Rahmen eines unabgeschlossenen Lebens Sinn und Bedeutung gehabt und zerfielen jetzt vor meinen Augen zu Staub. Die wichtigste Voraussetzung, damit man ein menschliches Gesicht als Gesicht erkennt, sei nicht die Gesamtheit der Züge, sondern das Oval, habe ich einmal gelesen. Das Oval ist unentbehrlich: Es begrenzt unsere Geschichte, verbindet sie zu einer fasslichen Einheit. Ein solches Oval kann das Leben selbst sein oder – post mortem – die verbindende Linie einer Erzählung von dem, was war. Der treu ergebene Inhalt dieser Wohnung sah sich plötzlich zu Abfall degradiert, er war mit einem Schlag entmenschlicht und hatte jede Erinnerung und Bedeutung verloren.
Während ich mich darüber beugte und das Nötige erledigte, staunend, wie wenig in diesem viellesenden Haushalt geschrieben worden war, tippte ich behutsam, zweifelnd die wenigen Worttasten an, die ich in meiner Erinnerung fand: einzelne Sätze aus der fernen oder nicht so fernen Vergangenheit, Geschichten von Barboskas Herrchen, Fragen, was der Knirps machte (mein größer werdender Sohn), Erzählungen von einer Querfeldein-Wanderung in den dreißiger Jahren – ein rasch verfliegendes, unwiederbringlich verlorenes sprachliches Gespinst. »Ich würde nie schick sagen, höchstens prächtig!«, hatte Galja mir einst streng erklärt, und was sie mir noch erzählte, habe ich großteils längst vergessen – von ihrem »Batja« – dem Vater –, von Freundinnen und Nachbarinnen, Nachrichten aus einem sehr einsamen Leben, das sich aus sich selbst speiste.
Aber ihre Wohnung war eben doch ein Ort des Schreibens gewesen, wie ich bald erfuhr. Unter den Sachen, von denen Tante Galja sich bis zum Schluss nicht trennte, nach denen sie immer wieder fragte und tastete, waren unzählige Notizkalender, eine tägliche Chronik, die sie über Jahre fortführte, »kein Tag ohne Zeile« – die Regel war ihr so selbstverständlich wie das Aufstehen und die Morgentoilette. Die Bände lagen noch immer in einer Holzkiste am Kopfende des Bettes: Sie füllten zwei große Taschen. Ich nahm sie mit nach Hause in die Banny-Gasse und fing sofort an zu lesen, auf der Suche nach einer Erzählung, einer Erklärung, einem Oval.
*
Wer gern Tagebücher und Notizhefte liest, weiß, dass sie sich in zwei Kategorien einteilen lassen. Es gibt die, deren Rede in gewisser Weise als offizieller Kommentar angelegt und darum im Kern schon öffentlich ist. Die Kladde ist hier – etwa im Fall des Tagebuchs von Marie Bashkirtseff – ein Versuchsgelände, auf dem das äußere Selbst getestet und trainiert wird, sie enthält einen endlosen, an eine unsichtbare, aber sympathisierende äußere Instanz gerichteten Monolog.
Interessanter finde ich die zweite Kategorie: das Tagebuch als Arbeitswerkzeug, gemacht für die Hand dieses einen Handwerkers – andere Leute können damit wenig anfangen. Der Ausdruck »Werkzeug« stammt von Susan Sontag, die diese Art Schreiben über Jahrzehnte praktiziert hat. Er scheint mir nur teilweise zutreffend. Sontags Notizbücher, und nicht nur ihre, sind zum einen so etwas wie Vorratsbeutel, in denen Ideen oder rasch skizzierte Szenen gesammelt werden, auf die man später zurückkommen will. Zum andern ist das Notieren eine Gewohnheit, ohne die ein bestimmter Typ Mensch nicht leben kann: Die Hefte bilden das Gerüst, das die Bindung an die Wirklichkeit, den Glauben an ihre Kontinuität stützt. Die Texte richten sich nur an einen einzigen, dafür umso interessierteren Leser: An welcher Stelle er das Heft auch aufschlägt, es bestätigt ihm, dass sein Leben eine Geschichte und Dauer hat und dass jeder beliebige Punkt der Vergangenheit in unmittelbarer Reichweite liegt.
Die meisten dieser Indizien (die in Sontags Tagebüchern so reichlich vorhandenen Aufzählungen von Filmen und gelesenen Büchern, die Listen schöner Wörter, die wie Trockenpilze aufgereihten Resümees von Erlebtem) haben kein direktes Ergebnis, keine Folgen, sie entfalten sich nicht zu einem Buch, Aufsatz, Film, werden nicht Grundlage einer realen Arbeit. Sie sollen niemandem etwas erklären (höchstens der Autorin selbst, aber flüchtig, wie stenografiert, so dass sich manchmal schwer nachvollziehen lässt, was gemeint war). Das Notizheft ist einfach ein Eisschrank zur Aufbewahrung leicht verderblicher Erinnerungen, ein Ort, wo sich die Nachweise und Bestätigungen sammeln, oder um es mit Iwan Gontscharow zu sagen, die materiellen Zeichen immaterieller Beziehungen.
Das hat etwas vage Unangenehmes, allein schon wegen seiner Redundanz. Mir selbst, als Angehöriger derselben Spezies, kommen meine Arbeitsnotizen oft wie bloßer Ballast vor, von dem ich mich gern trennen würde, aber was bleibt dann von mir? Janet Malcolm beschreibt in ihrem Buch The Silent Woman ein Interieur, das entfernt an meine Notizhefte erinnert, und das ist ein wenig unheimlich. Es enthält ein Gemisch aus Zeitschriften und Büchern, vollen Aschenbechern, verstaubten peruanischen Souvenirs, schmutzigem Geschirr und leeren Pizzakartons, Dosen, Schachteln, Flaschenöffnern, Ausgaben von Who is Who, die für das exakte Wissen zuständig sind, und einigen anderen Gegenständen, die für gar nichts zuständig, weil längst zu nichts mehr zu gebrauchen sind. Für Malcolm ist diese Wohnung ein Borgessches Aleph, eine »monströse Allegorie der Wahrheit«, ein Sammelsurium wild wuchernder Fakten und Lesarten, fern von der reinlichen Ordnung der Geschichte.
*
Die Tagebücher meiner Tante Galja gehörten in keine der genannten Kategorien, und ihre grobmaschige Textur wurde immer rätselhafter, je länger ich darin las.
Als ich ein Kind war, fiel mir bei großen Kunstausstellungen immer eine bestimmte Sorte von Besuchern auf (meist waren es Frauen): Sie wanderten von Bild zu Bild, beugten sich zu den Informationstäfelchen und machten sich auf einem Zettel oder in einem Heft Notizen. Irgendwann wurde mir klar, dass sie einfach alle ausgestellten Arbeiten aufschrieben, also eine Art handschriftlichen Katalog anfertigten – fast so etwas wie eine körperlose Kopie des Gesehenen. Erst viel später begriff ich, dass die Aufzählung eine Illusion von Besitz erzeugte: Die Ausstellung würde vorübergehen und sich auflösen, auf dem Papier aber blieb die Ordnung der Bilder und Skulpturen erhalten, es ließ sie nicht vergehen.
Auf eine ähnliche Weise hielten Galjas Tagebücher die alltäglichen Geschehnisse fest – erstaunlich detailliert und zugleich erstaunlich verschwiegen. Sie dokumentierten ihre Aufsteh- und Schlafengehenszeiten, ihr Fernsehpensum, die Anzahl ihrer Telefonate und die Namen ihrer Gesprächspartner, was sie gegessen und was sie getan hatte. Ausgespart blieb dagegen der eigentliche Inhalt des Tages. »Gelesen«, hieß es zum Beispiel im Text, aber was sie gelesen hatte und was diese Lektüre für sie bedeutete, erwähnte Galja mit keinem Wort – und so war es mit allem, woraus ihr langes, vollständig aufgeschriebenes Leben bestand. Nichts gab einen Hinweis darauf, wie dieses Leben gewesen war – sie schrieb nichts über sich, nichts über andere, nichts als kleinteilige Einzelheiten, eine präzise Chronik des Zeitvergehens.
Ich dachte immer, irgendwo müsste dieses Leben sich doch wenigstens einmal zeigen, sich aussprechen – immerhin hatte es aus intensivem Lesen und folglich auch Denken bestanden, begleitet vom leisen Brodeln diverser Launen und Kränkungen, die meine Tante jeweils lange beschäftigten – etwas davon musste doch erhalten sein, sich irgendwo entladen haben, in irgendeiner wütenden Passage, in der Galja der Welt und uns ins Gesicht sagte, was sie von uns hielt.
Aber nichts dergleichen. Einige wenige Bedeutungsnuancen und Schattierungen, Textfalten, in denen sich Emotionen versteckten – ein Hurra! am Rand, wenn mein Vater oder ich angerufen hatten, ein paar knappe, bittere Sätze zu den Geburts- und Todestagen ihrer Eltern – das war es im Wesentlichen. Als hätte der Hauptzweck jedes Eintrags, jedes jährlich gefüllten Bandes darin bestanden, ein verlässliches Zeugnis zu hinterlassen und ihr eigentliches, inneres Leben für sich zu behalten. Alles zu zeigen. Alles zu verbergen. Unbegrenzt zu archivieren.
Was an diesen Heften lag ihr so am Herzen? Warum wollte sie sie bis zum letzten Tag in ihrer Nähe haben, warum fürchtete sie, sie könnten verlorengehen? Vielleicht war der geschriebene Text – als Erzählung von Einsamkeit und vom unmerklichen Abgleiten ins Nichtsein – ja doch eine Art Anklageschrift: Die Welt und wir sollten das alles lesen und endlich begreifen, wie schlecht wir sie behandelt hatten.
Oder – seltsame Vorstellung – enthielten diese kargen Ereignisse für sie irgendein Substrat der Freude, und sie legte Wert darauf, dieses Substrat unsterblich zu machen, es in die Kategorie der Manuskripte zu überführen, die nicht brennen und die sprechen, ohne Zeugnis ablegen zu wollen? Wenn ja, dann war ihr das gelungen.
11. Oktober 2002
Wieder von hinten angefangen: 1 h 45. Eben die Wäsche eingeweicht, Handtücher, Nachthemden usw., alle hellen Sachen. Die Bettwäsche kommt noch. Davor den Balkon leergeräumt. Draußen sind es +3 Grad, am Ende erfriert noch das Gemüse! Den Kürbis habe ich geputzt und geschnitten, ich will ihn einfrieren. Alles geht so langsam! Habe beim Kabarett im Ersten Programm drangesessen, gut zwei Stunden. Vorher Tee mit Milch.
Von 16 bis 18 h geschlafen, ich musste mich einfach hinlegen. Davor ein Anruf von T. W. wegen des Telefons in der Wojkowskaja. Er hat schon um zwölf angerufen und wollte wissen, ob mein Fernseher funktioniert. Der Fernseher ging seit dem Morgen nicht, kein einziger Sender. Aufgestanden bin ich gegen 8, als Serjosha [der Untermieter; M. S.] im Bad war, dann allmählich fertiggemacht, um 9 aus dem Haus. Lange auf den 3er Bus gewartet, bis 9h45. Ich hätte besser den 171er nehmen sollen. Danach war es überall schon voll, alles hat lange gedauert. Uralskaja, Busbahnhof, Zeitungen. Immerhin habe ich einen Kürbis gekauft, den ersten dieses Jahr, und Karotten. Zu Hause war ich gegen 12. Ich wollte Columbo sehen. In der Nacht davor Blutdruck gemessen nach 1:45, eine Clofelin genommen, gewartet, bis der Blutdruck runtergeht, bevor ich die anderen Medikamente nehme. Zwanzig Minuten herumgebummelt, und am Ende habe ich doch nicht mehr gemessen; ins Bett um 3 Uhr.
8. Juli 2004
Von früh an ein schöner sonniger Tag, kein Tropfen Regen. Morgens Kaffee mit Kondensmilch, gegen 11 zur Altajskaja. Dort war es brechend voll, ich saß lange auf einer Bank am Teich, bis 13h, habe ins Grüne und in den Himmel geschaut, in die Wolken, und gesungen dabei, wie war mir wohl!
Auf den Spazierwegen waren Leute mit Hunden unterwegs, mit Kinderwagen, auf der Wiese scharenweise Sonnenanbeter in Badesachen, alle waren entspannt und vergnügt.
Danach bin ich ohne Warteschlange zur Kasse gegangen, habe Quark gekauft und mich langsam auf den Heimweg gemacht. Um die neue Schule herum haben sie so prächtig gepflanzt, hohe Kleeblumen und Heckenrosen – wunderschön! Auf der Straße spielten ein paar Jungen in einem kaputten Auto. Sie hatten eine Plastikflasche dabei, die bis oben hin mit Erbsenschoten gefüllt war. Man könnte sie essen, meinten sie.
11. Oktober 2005
Schlaflos, aber aufstehen wollte ich auch nicht, keine Lust, mich zu rühren, etwas zu tun … um 10:40 die Post geholt und wieder ins Bett. Danach kam bald Sweta. So ein schlaues Mädchen, sie weiß besser als ich, wie man einkauft! Tee getrunken und den Tag über im Bett geblieben. Bei Wl. Wass. für seine Post bedankt. … Nach 12 rief Bobrowa an. Sie ist seit Donnerstag hier …
Habe Morosko in der Nr. 79 angerufen, außerdem Ira aus dem ZSO, abends Jurtschuk. Wäsche gefaltet und nebenbei ferngesehen. Um 23:30 ins Bett.
Hitze. Das Röckchen von Tonja angezogen. »Ein graues, farbloses Leben, das keiner braucht.« Tagsüber Tee, abends Kaffee. Und keinerlei Appetit!
Und doch gab es einen Eintrag, der anders war als die anderen, am 17. Juni 2005:
Morgens Anruf bei Sima. Dann das Fotoalbum hervorgeholt. Wie immer habe ich alle Bilder herausgeschüttelt und lange angesehen. Hunger hatte ich keinen, und über den Fotos war mir so schwer ums Herz – Tränen, Trauer um die verflossene Zeit, um alle, die nicht mehr da sind, um mein eigenes unnützes, oder, besser gesagt, vergebliches Leben, die Leere im Herzen … Ich wollte nicht mehr denken.
Also habe ich mich wieder ins Bett gelegt und, ich weiß selber nicht wie, den ganzen Tag geschlafen, bis zum Abend bin ich kaum einmal aufgestanden. Um 20 Uhr ein Glas Milch getrunken, die Vorhänge zugezogen, mich wieder hingelegt und weiter geschlafen, immer weiter heraus aus der Wirklichkeit. Schlafen ist die Rettung.
*
Monate, Jahre vergingen. Galjas Hefte lagen hier und dort herum, gerieten zwischen andere Papiere, die man nicht wegräumt, weil man sie ja sehr bald brauchen wird, und so altern sie wie der Rest des Hausrats unbemerkt. Ich erinnerte mich wieder an sie, als ich nach Potschinki kam.
Das abgelegene Provinzstädtchen Potschinki, gut zweihundert Kilometer von Nishni Nowgorod im Amtsbezirk Arsamas, genoss bei uns zu Hause einen zweifelhaften Ruhm: Es war der Ort, woher alle kamen und wohin niemand zurückwollte, seit siebzig oder mehr Jahren. Vladimir Nabokov beschreibt das Leben als kurzen Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels; die erste dieser Ewigkeiten – die, in der wir noch nicht existieren – scheint noch abgründiger als die zweite. Auch das stille Potschinki hatte sich über die Jahre in ein schwarzes Loch im Familiengedächtnis verwandelt.
Ich erinnerte mich vage an Erzählungen von einem runden Dutzend Geschwister – die Familie muss riesig gewesen sein –, an Fotos von Pferdekarren und Holzhäusern, und das alles war überlagert von den späteren phantastischen Abenteuern meiner Urgroßmutter Sarra Ginsburg, auch sie eine Tochter von Potschinki, die es geschafft hatte, nicht nur unter dem Zaren im Gefängnis zu sitzen, sondern auch in Paris zu leben, Medizin zu studieren und schließlich als Ärztin sowjetische Kinder zu behandeln, darunter meine Mutter und mich. Alles, was man von ihr erzählte, hatte einen Beigeschmack von Lorbeer und Legende. Nach ihren Wurzeln zu forschen kam niemandem in den Sinn.
Allerdings gab es einen Verwandten, Leonid aus Saratow, der eine Erkundungsfahrt nach Potschinki plante – so gründlich, als wäre es eine Expedition zum Nordpol – und der versuchte, auch die nähere und fernere Verwandtschaft (zur letzteren zählte ich) dafür zu begeistern. Er hatte seltsam durchsichtige Augen, und in ihm arbeitete ein nie versiegender Enthusiasmus, dessen wechselnde Anlässe er mit den Erwachsenen der Familie erörterte. In Moskau war er nur selten, und als er wieder einmal vorbeikam, um über seinen Plan zu sprechen, traf er meine Eltern nicht mehr an: Sie wohnten seit kurzem in Deutschland, die Familie vertrat ich. Bislang hatte mich diese Art sentimentale Reise zwar nie interessiert, doch jetzt war ich leicht zu gewinnen: Zum ersten Mal schien mir unser Stammsitz erreichbar, also real. Und je mehr mein Gegenüber auf den Strapazen der Reise und der weiten Entfernung herumritt, die das Ganze zu einer schwierigen, gründliche Vorbereitung, Planung und Umsicht erfordernden Unternehmung machten, desto klarer wurde mir, dass man schon irgendwie hinkommen würde. Unser Verwandter wollte mit der Familie nach Potschinki fahren, und darunter verstand er so etwas wie die Rückkehr der Stämme Israels, die zwangsläufig zahlreich waren; also bereitete er sich weiter vor, und vor zehn Jahren ist er gestorben. Potschinki blieb vorerst so unsichtbar wie die versunkene Stadt Kitesh.
Jetzt aber kam ich ihm allmählich näher. Ich weiß nicht, was mich antrieb und was ich dort zu entdecken hoffte, jedenfalls recherchierte ich vor der Reise im Internet, um quasi meinen Blick scharfzustellen. Der Ort schien tatsächlich in einer Art Jenseits zu liegen; ich fand ihn schließlich auf einer alten Karte des Landkreises Lukojanow weit hinter Arsamas, in der Nähe von Puschkins Gut Boldino, zwischen Dörfern mit sonderbaren Namen wie Utka oder Pogibelka. Mit dem Zug kam man nicht in diese Gegend, der nächste Bahnhof lag drei Stunden entfernt. Das Einfachste war wohl, mit einem Mietwagen aus Nishni zu fahren.
Wir brachen früh am Morgen auf, die rosa überglänzten Prospekte hatten sich vom Winter noch nicht erholt. Eine eigentümliche, von Erinnerungsresten gezeichnete Stadtlandschaft – halb Industriebauten, halb Holzhäuser mit Zäunen und Palisaden, die keinen Fingerbreit vor der neuen Welt zurückwichen – verschwand in Talsohlen und stieg wieder auf Fensterhöhe. Als wir die Landstraße erreichten, nahm das Auto Fahrt auf und beschleunigte auf ein aberwitziges Tempo; der Fahrer, Vater eines dreijährigen Jungen, hielt die Hände am Steuer und schwieg verächtlich. Die Straße hob und senkte sich in sparsamen Wellen, unter den Fichten lagen kleine Pferdedecken aus verwirrtem altem Schnee. Die Welt wurde mit jedem durchquerten Kilometer ärmer. In schwärzlichen Dörfern leuchteten porzellanweiße neue Kirchen, wie blanke Zahnkronen. Ich hatte einen Reiseführer dabei, der die Schönheit des längst auf der rechten Seite vorübergezogenen Arsamas pries, und ein zwanzig Jahre altes Büchlein über Potschinki. Darin war der Laden »des Juden Ginsburg« erwähnt, der mit Nähmaschinen gehandelt hatte, mehr nicht. Von der heldenhaften Sarra kein Wort.
Die Fahrt dauerte Stunden. Sie führte in eine düstere, eher umbrisch als toskanisch anmutende Hügellandschaft von dunkler Kupferfarbe, gleichmäßig wie Ein- und Ausatmen. Manchmal blinkte kurz ein Wasserspiegel auf. Vom Abzweig nach Boldino an gab es hier und da Puschkin-Denkmäler; die ländliche Geliebte des Dichters stammte der Überlieferung nach aus dem Dorf Lukojanow, nach dem auch der Landkreis benannt war. Hier und da stand ein Grüppchen Bäume auf der Koppel.
Potschinki war an einer Achse ausgerichtet, von der links und rechts ordentliche Querstraßen abzweigten. Am Ende der Hauptstraße stand eine hübsche klassizistische Kirche – laut Reiseführer war es die Christi-Geburt-Kirche, wo ein Priester namens Orfanow gepredigt hatte. Den Namen kannte ich: Als ich klein war, ließ eine Walja Orfanowa mir regelmäßig Grüße ausrichten, und einmal bat sie meine Mutter, mir in ihrem Namen ein Buch zu kaufen, damit Mascha mich nicht vergisst. Meine Mutter wählte aus dem Angebot im Antiquariat ein Bändchen von Fjodor Sologub aus. Unglücklicherweise war es Das Große Läuten, eine 1923 erschienene Sammlung von Revolutionsgedichten: Nach meinen damaligen Maßstäben waren Phrasen wie »Bin ein freier Proletarier, heißes Herz in meiner Brust« völlig indiskutabel, und die durchaus vorhandenen klanglichen Qualitäten dieser Verse wusste ich noch nicht zu schätzen.
Auf dem leeren Hauptplatz, von dem man möglichst schnell irgendwohin abbiegen wollte, wo es etwas zu sehen und anzufassen gab, erwartete uns die Heimatforscherin Maria Fufajewa. Es war Sonntag, aber für uns wurde die Bibliothek aufgeschlossen, das örtliche Kulturzentrum, wo gerade eine Ausstellung lief: eine Sammlung von Aquarellen, die die Häuser und Straßen von Potschinki vor hundert Jahren zeigten. Sie kamen von einer deutschen Familie, die seit dem späten 19. Jahrhundert hier gewohnt hatte, und deren Namen, fiel mir jetzt ein, ich auch schon als Kind gehört hatte: Getling. Die Bilder waren bunt und anheimelnd; in diesem fröhlichen kleinen Haus mit den Malven und anheimelnd dem Apothekenschild zum Beispiel hatte Augusta Getling, die Schwester des Malers, meine junge Urgroßmutter aufs Gymnasium vorbereitet. Das Haus stand immer noch, hatte aber seine Vortreppe verloren und eine Betonverkleidung bekommen; die Blumen und die geschnitzten Fensterrahmen waren verschwunden. Wo Anfang des Jahrhunderts meine Sarra mit ihrer Familie gelebt hatte, wo ihr weitläufiger Hof stand und ihr Pferdekarren, wusste keiner.
Und dabei blieb es, mehr war nicht zu holen, wie in den Tagebüchern meiner Tante Galja, die mich mit Wetterberichten und Aufzählungen von Lebensmitteln und Fernsehsendungen abspeisten. Was dahinterstand, flimmernd und summend, hatte keine Eile, sich zu offenbaren, vielleicht hatte es das auch gar nicht vor. Wir wurden mit Tee bewirtet, wir wurden spazieren geführt. Meine Blicke tasteten den Boden ab, als hoffte ich, eine Münze zu finden.
Das heutige Dorf verdeckte nicht die Umrisse der Stadt, die einst den größten Pferdemarkt des Bezirks, wenn nicht des ganzen Gouvernements beherbergt hatte. Wir gingen quer über den früheren Marktplatz; der weite Raum war inzwischen mit Bäumen bewachsen, irgendwo in der Mitte stand das obligatorische bleigraue Lenindenkmal, aber der Ort war sichtlich keine Menschen mehr gewöhnt – und zu groß, um eine neue Bestimmung zu finden. Rundherum standen Spielzeughäuser wie auf den Bildern der Ausstellung, manche trugen die Spuren eines schnellen, gewaltsamen Umbaus. Und noch eine Leerstelle bekam ich gezeigt: das Asphaltquadrat, das den Laden von Sarras älterem Bruder Solomon Ginsburg ersetzte. Wir standen eine Weile da und fotografierten uns – eine Gruppe aufgeplusterter Frauen in Mänteln und Mützen. Es war windig. Am Rand der Grünfläche, neben der Fahrbahn, stand ein weiteres, silbrig glänzendes Denkmal: der mächtige Hengst Korporal, der der Region zwanzig Jahre lang als Beschäler gedient hatte.
Jenseits der Brücke über die Rudnja lag in einiger Entfernung der Betrieb, der die Stadt einst beherrscht hatte – das zu Puschkins Zeiten erbaute Gestüt des Reitenden Leibgarde-Regiments. Pferde hatte man hier auch früher schon gezüchtet, »Argamas- und Nogaier Hengste, Nogaier Rösser, Wallache und Stuten, Herdentiere und russische Fohlen«, aber Katharina II. machte daraus eine Produktion im industriellen Maßstab, und das ausgedehnte Gestüt mit den klassischen Konturen und dem rissigen weißen Anstrich, mit dem abgesackten, eingestürzten zentralen Türmchen und dem Eingangsportal, das sich auf der anderen Seite des Gevierts symmetrisch spiegelte, war als Bollwerk der Zivilisation gedacht, als Insel des wohlgeordneten Petersburgertums. Endgültig hinfällig geworden war es erst vor kurzem, in den neunziger Jahren. Jetzt war es von Ackerland umgeben, das der lange Winter kahlgeleckt hatte. In den offenen Ställen gingen die letzten Pferde umher: rötlich, schwer, mit hellem, bäurischem Schopf. Sie hoben die Köpfe und drückten die Nüstern in unsere ausgestreckten Hände. Der Himmel war blendend hell geworden, die Wolken bildeten eine fliegende Kette, unter der abgeblätterten Farbe kam der rosig-hautfarbene Untergrund zum Vorschein.
Auf dem Rückweg wurde mir auf halber Strecke plötzlich klar, dass ich an das Wichtigste gar nicht gedacht hatte: Es musste hier doch einen Friedhof geben, einen jüdischen oder auch nicht, auf dem all die Meinen lagen. Der Fahrer fuhr stur hundertzwanzig, Ortsnamen blitzten auf, Surowatika, Peschelan. Ich rief Maria Fufajewa an: Einen Friedhof gab es schon lange nicht mehr, wie es auch keine Juden mehr gab in Potschinki. Oder doch, einen gab es noch, und sie wusste auch, wie er hieß. Sein Nachname war Gurewitsch: wie der meiner Mutter.
2
Anfänge
Das erste Mal, dass ich vermieden habe, diesen Text zu schreiben, liegt gut dreißig Jahre zurück – damals ließ ich ihn nach zwei oder drei Seiten eines linierten Schulhefts liegen, »zum Reinwachsen«. Angesichts des Umfangs und der Bedeutung dessen, was ich mir vorgenommen hatte, verstand sich das bequeme »nicht jetzt« irgendwie von selbst.
Streng genommen, besteht die Geschichte dieses Buches aus einer langen Reihe von Rückziehern und Ausreden: Ich verschob es auf später, auf eine bessere Version meiner selbst, wie damals als Kind, und einstweilen brachte ich ihm bescheidene, immer ungenügende Opfergaben in Form kleiner Notizen dar, ritzte Kerben ein auf Zugfahrten oder während eines Telefonats: Gedächtnisstützen. Aus diesen Zwei- oder Dreiwort-Konzentraten sollte die Erinnerung irgendwann eine tragbare Konstruktion zusammenbauen, das wohnliche Zelt einer Handlung. Statt der Erinnerung an Geschehenes, die ich nicht habe, sollte die noch frische Erinnerung an Erzähltes wirksam werden; sie sollte die trockene Notiz befeuchten, bis daraus ein Kirschgarten wuchs.
In russischen Memoiren vom Anfang des 20. Jahrhunderts taucht gelegentlich eine Spielerei für Kinder auf: eine blassgelbe Papierscheibe, die man in eine Tasse legt und mit Wasser begießt, und schon wächst sie einem in den unwahrscheinlichsten, leuchtend asiatischen Farben entgegen, ein fremdes, fernes Blühen. Ich habe diese Zauberplättchen nie zu Gesicht bekommen – was ist eigentlich aus all diesen Dingen geworden? Immerhin gab es bei uns, im Arsenal der weihnachtlichen Noch-von-Babuschka-Schätze, ein Rauchmännchen, ein streichholzgroßes, schwarzgesichtiges Kerlchen, das sehr überzeugend winzige weiße Zigaretten paffte: Rauch stieg auf, Asche trat an die Stelle der Glut, bis der Tabakvorrat eines Tages endgültig aufgebraucht war. Von da an lebten die Fähigkeiten des Männchens im Erzählen weiter, und das kann man als Happy End sehen – wie es scheint, besteht für verschwindende Dinge und Alltagsgesten das Paradies genau darin, erwähnt zu werden.
Das erste Mal begann ich dieses Buch also im Alter von zehn Jahren zu schreiben, in derselben Wohnung in der Banny-Gasse, in der ich jetzt die ersten Buchstaben dieses Kapitels tippe. In den achtziger Jahren stand am Fenster ein Schreibtisch mit schartiger Kante, auf dem eine orange Tischlampe leuchtete; auf ihren weißen Kunststofffuß hatte ich ein Abziehbild geklebt, das beste von allen: Unter einem dunklen Schneehimmel schleppt eine plüschene Bärenmutter auf einem Schlitten eine Tanne und ein kleines, schief sitzendes Bärenkind hinter sich her, seitlich ist ein Sack mit Geschenken festgebunden. Fünf oder sechs Bilder waren damals auf jedem dieser klebrig glänzenden Blätter, man schnitt sie einzeln aus und legte sie in eine Schale mit warmem Wasser. Dann musste man die durchsichtige Farbfolie in einem Schwung abziehen, sie schnell auf eine freie Stelle legen und glattstreichen. Ich erinnere mich an einen Katzenjungen in Regenmantel und Karnevalsmaske auf der Tür des Küchenschranks und an einen Pinguin mit Pinguinkind vor grün-rosa gezacktem Nordlicht. Aber die Bären mochte ich am liebsten.
Als würde mir leichter, wenn ich sie eines nach dem anderen aufzähle, all diese beiläufig erinnerten Bruchstücke eines früheren Lebens, die noch zwanzig Jahre, bis zur nächsten Renovierung, am Küchenschrank nachdunkelten und mir erst in diesem Moment wieder lebhaft und bunt vor Augen stehen: der dicke Junge im Sombrero und schwarz-gelben Domino! die Maske mit den Lamettaschnörkeln! Als müsste ich – »sprach’s und war nicht mehr« – nach getaner Tat in tausend morsche, welke Sachen und Sächelchen zerspringen. Als wäre es meine Lebensaufgabe, sie zu katalogisieren, als wäre ich nur dafür erwachsen geworden.
Das zweite Mal begann ich dieses Buch, ohne es zu wissen, im schiefen, scheuen Alter von sechzehn Jahren zu schreiben. Es war am Ende einer Liebesgeschichte, von der mir damals mein weiteres Leben abzuhängen schien; mit den Jahren ist sie so verblasst und vertrocknet, dass ich das Gefühl eines Anfangs-von-allem, mit dem ich sie durchlebte, nicht wiederherstellen kann. Eine Sache ist mir aber noch sehr genau in Erinnerung. Als klar wurde, dass es vorbei war – vielleicht nicht in meiner Vorstellung, aber in Werken und Tagen – wollte ich mir unbedingt das Wichtigste merken, eine Art Best-of: Knotenpunkte, Gesprächsverläufe, Details, einzelne Sätze. Ich wollte sie festhalten, als Vorarbeit für eine spätere – irgendwann einmal – Beschreibung; eine lineare Erzählweise kam nicht in Frage, zu unplausibel wäre diese Linie ausgefallen. Also schrieb ich alles, was ich keinesfalls vergessen durfte, auf Zettel; auf jedem stand ein Wort oder ein Ausdruck, aus dem sich in der Erinnerung sofort ein ganzes Ereignisgebäude zusammensetzte: ein Gespräch, eine Straßenecke, ein Witz, ein Versprechen. Da das Geschehene sich in meinem Kopf verzweifelt dagegen wehrte, sich in eine Ordnung oder Reihenfolge bringen zu lassen, sei sie alphabetisch oder chronologisch, bestand die Aufgabe in Folgendem: Irgendwann in der nahen Zukunft würde ich alle diese Fragmente in einen Hut werfen (den meines Vaters, er hatte einen wunderbaren grauen Hut, den er nie trug), sie dann eines nach dem anderen hervorziehen und Geschichte für Geschichte, Punkt für Punkt aufschreiben, bis der Moment gekommen wäre, diese Karte des Lands der Zärtlichkeit hinter mir zu lassen: als Denkmal ihrer selbst. Mit der Zeit verteilten sich die dreißig oder vierzig Zettel über die Schubladen meines damaligen Schreibtischs, und irgendwann waren sie endgültig verschwunden, verschluckt von Umzügen, Renovierungen und plötzlichen Putzorgien.
Muss ich dazusagen, dass ich keines der vierzig Wörter mehr weiß, die zu vergessen ich damals so fürchtete?
*
Doch an sich beschäftigt mich die Idee eines fragmentarischen, zufälligen Bergens der eigenen und allgemeinen Geschichte aus dem Dunkel des Bekannten und Selbstverständlichen noch immer. Das Anfangsstadium dieser Rettungsaktion ist mir längst zur Gewohnheit geworden; der unsichtbare, unsystematisch wachsende Zettelkasten, der nie durchgesehen wird, ist heute ein fester Bestandteil meines Lebens. Nur die Menschen, mit denen man noch darüber sprechen kann, wie es gewesen ist, werden zusehends weniger.
Ich wusste immer, dass ich eines Tages ein Buch über meine Familie schreiben würde, und es gab eine Zeit, in der ich darin mein Lebenswerk sah (das Werk mehrerer zusammengeführter Leben vielmehr, denn zufällig war ich der erste und bisher einzige Mensch in der Familie, der Anlass zu einem nach außen gerichteten Reden hatte: unter der warmen Mütze des intimen Gesprächs hervor, nach draußen in die Bahnhofshalle der kollektiven Erfahrung). Dass alle diese Leute, die Lebenden wie die Toten, keine Gelegenheit hatten, gesehen zu werden, dass das Leben ihnen keine Chance ließ zu bleiben, erinnert zu werden, im Licht zu stehen, dass ihr Normalsein sie dem schlichten menschlichen Interesse entzog, schien mir ungerecht. Man musste von ihnen und für sie sprechen – und ich fürchtete mich, damit anzufangen: davor, auf einmal nicht mehr neugierige Zuhörerin und Adressatin zu sein, jener äußerste Punkt der Sippe, auf den die vieläugige, vielstufige Familiengeschichte zuläuft wie Telegrafendrähte, die sich in der Ferne zu treffen scheinen, sondern eine Fremde, eine von den anderen. Ein Erzähler nämlich, jene Auswahl- und Abwahlinstanz, die weiß, welcher Teil vom Unerzählten ins Licht zu rücken ist und welcher im Schatten bleiben soll, äußerlich wie innerlich.
Kurios war dabei, dass meine Großmütter und -väter einen beträchtlichen Teil ihrer Energie darauf verwendet hatten, unsichtbar zu bleiben. Möglichst unauffällig zu werden, im häuslichen Dunkel unterzutauchen, sich abseits zu halten von der Weltgeschichte mit ihren überlebensgroßen Narrativen und ihrer Fehlertoleranz von ein paar Millionen Menschenleben. Ob sie diesen Weg bewusst oder unbewusst wählten, ist schwer zu sagen. Meine fünfundzwanzigjährige Urgroßmutter zum Beispiel hätte, nachdem sie im Herbst 1914 auf Umwegen aus dem kriegführenden Frankreich nach Russland zurückgekehrt war, weitermachen können wie zuvor, sie hätte revolutionäre Umtriebe entfalten und sich einen Platz im Geschichtsbuch sowie, gut möglich, auf einer Erschießungsliste sichern können. Stattdessen zog sie sich an den äußersten Rand dieses Geschichtsbuchs zurück, dorthin, wohin sich nicht einmal eine Fußnote verirrt – man sieht nur gemusterte Tapeten und diese hässliche gelbe Butterdose, die sowohl die Hausherrin und ihre Welt als auch das 20. Jahrhundert überlebt hat.
In meiner frühen Jugend weckte all das eine Verlegenheit in mir, die ich schwer in Worte fassen konnte und mir nicht ganz eingestehen wollte. Sie bezog sich, wie soll ich es sagen, auf den Handlungsaufbau – ich musste mich damit abfinden, dass meine Verwandtschaft sich wenig Mühe gegeben hatte, unsere Geschichte interessant zu gestalten. Besonders fiel das zu den Jahrestagen des Kriegsendes auf – der Sieg war damals knapp über vierzig, so alt wie ich jetzt, und zu den Feiertagen kamen blumen- und ordensgeschmückte Großväter anderer Kinder in die Schule, die wenig erzählten (was sie erlebt hatten, ließ sich schwer in Anekdoten und Legenden verpacken), aber aufrecht vorn an der Tafel standen: wenn schon keine Zeugen, so doch lebende Zeugnisse. Mein Großvater Ljonja war nicht an der Front gewesen, er war Ingenieur und arbeitete im Hinterland; Großvater Kolja mit seinem Offiziersausweis und dem Roter-Stern-Orden machte da schon mehr her, doch wie sich herausstellte, hatte er während des Krieges im Fernen Osten gedient, und die Frage, ob er dort gekämpft hatte, blieb irgendwie in der Luft hängen.
Mit der Zeit bekam ich den Eindruck, dass er eher nicht gekämpft hatte: Er galt als nicht vertrauenswürdig infolge irgendeiner Sache, die ihm passiert war, einer dunklen Geschichte, die wie eine Wolke über diesem Teil der Familie hing, ohne sich je in einer Erzählung zu entladen. Das Ganze lief unter dem Titel »Als Vater ein Volksfeind war« und spielte sich in den Jahren 1938-1939 ab, zur Zeit der stillschweigenden Amnestie unter Beria, als manche Leute überraschend freigelassen wurden und andere, wie mein Großvater, gar nicht erst in Haft kamen. Was damals in Swerdlowsk eigentlich passiert war, kam nur beiläufig und undeutlich zur Sprache, und erst als ich später die Daten nebeneinanderlegte, wurde mir klar, dass in diese düsteren Monate die zweite Schwangerschaft meiner Großmutter fiel: mein Vater kam am 1. August 1939 zur Welt, genau einen Monat vor dem Beginn des Weltkriegs und Audens Gedicht:
Waves of anger and fear
Circulate over the bright
And darkened lands of the earth,
Obsessing our private lives;
The unmentionable odour of death
Offends the September night.
Gott weiß, welchem Wunder mein Vater es verdankte, dass er überlebte und in einer vollzähligen Familie aufwuchs, mit Vater-Mutter-Schwester. Zum Ausgang der Swerdlowsker Sache kenne ich zwei Versionen, und die, die in meiner Kindheit erzählt wurde, kommt mir wie ein Märchen vor, ein Apokryph – doch dazu später. Aus der Geschichte vom Soldatenopa wurde jedenfalls nichts, in der Familienüberlieferung war dem Großvater die Rolle des Holzspans im Wasserstrudel zugedacht, und in den Chor der Stimmen, die von Krieg und Sieg sangen, wollte sich das partout nicht fügen.
Kurz, bei allen anderen bestand die Familie aus Protagonisten der Geschichte, bei mir nur aus ihren Untermietern. Keiner meiner Verwandten hatte an der Front gekämpft, keiner war verfolgt worden (nebulöse Andeutungen über Verhaftung und Verhör gab es auch in Bezug auf den anderen Großvater, doch auch bei ihm war die Sache offenbar noch einmal gutgegangen, er war verschont geblieben), keiner war unter deutsche Besatzung oder in eines der großen Gemetzel des Jahrhunderts geraten. Eine Sache für sich war die Geschichte des zwanzigjährigen Sohns von Verotschka, der Schwester meiner Urgroßmutter, der an der Leningrader Front gefallen war – aber sie handelte nicht vom Krieg, sondern von der Ungerechtigkeit; sie war so gespickt mit eisigen Nadeln und die Fotos des kleinen Jungen in runden Filzstiefelchen konnten so unmöglich mit einer offiziellen Todesnachricht enden, dass mir noch heute, wie früher meiner Mutter, von der ich alle Worte und Namen übernommen habe, schwarz vor Augen und in der Kehle wird, wenn der Name Ljodik fällt.
Und natürlich gab es keine Prominenten: Auch was das Heer der Kunst anging, zogen meine Angehörigen unauffällige Zivilkleidung vor. Viele Ärzte waren unter ihnen, Ingenieure, Architekten (aber von der prosaischen Sorte, Leute, die eher Straßen und Brücken entwerfen als Kirchtürme und Fassaden), Buchhalter und Bibliothekare. Ihr Leben scheint sehr still verlaufen zu sein, abseits der kreisenden Mühlräder der Moderne. Fast keiner von ihnen war Parteimitglied, doch auch das hatte nichts Demonstratives; ihr Leben spielte sich einfach nur tief im Inneren des Erzgangs ab, es kam nicht an die Oberfläche, wo jede Bewegung registriert wird und ihre sichtbaren Folgen hat. Jetzt, da sie ins letzte Dunkel verschwunden und ihre Geschichten endgültig abgeschlossen sind, kann man über sie sprechen, sie aus der Nähe betrachten. Dem Gesehenwerden entkommt am Ende niemand – und einmal mehr gesehen zu werden wird ihnen kaum schaden.
*
Von Zeit zu Zeit – immer abends, meist am Wochenende oder wenn ich krank war und nicht zur Schule musste – rief meine Mutter mich plötzlich zu sich, um Fotos anzuschauen. Mit einiger Mühe machten wir die Schranktür auf (der Schrank war zur Hälfte vom Sofa verstellt, das Manöver war nicht einfach) und zogen, zu meinem höchsten Glück, eine Schublade voll kleiner Schachteln hervor. Darin lag kostbarer Kleinkram, Passbilder und Fotos verschiedenster Epochen, Steinchen von der Krim, in der Vorkriegszeit gesammelt, uralte Kinderrasseln, das Reißzeug meines Großvaters (»das bekommst du, wenn du groß bist«), dergleichen mehr.
Die Fotoalben standen gleich daneben, und es waren viele. Manche so prall, dass sie fast aus ihrem abgeschabten Einband platzten, andere leer, aber auch sie wurden hervorgeholt. Das dickste war in helles Leder gebunden und trug ein silbernes Zaumzeug, ein anderes hatte einen schwarzen Lackeinband, darauf eine gelbe Ritterburg auf einem Berg und die schräge Aufschrift Lausanne, noch ein anderes sah nach Jugendstil aus, mit Metallmonogramm und einer schon vor hundert Jahren altmodischen Madame Butterfly, und so ging es weiter, dicke und dünne Alben, große und kleine. Die Seiten waren auf eine altertümliche Art schwer, sie hatten breite Silberkanten und kleine Einschnitte für die Bilder, und es stimmte ein bisschen wehmütig, dass die glatten, glänzenden modernen Fotos partout nicht zu diesen Einschnitten passen wollten, sie waren zu breit oder zu schmal und in jedem Fall zu leicht. Die Dinge von damals wirkten substantieller und langlebiger; sie stellten alle meine Anstrengungen, mich selbst in einen dieser Rahmen einzupassen, in Frage.
Zu den Fotos gab es Geschichten. All diese Männer mit den dichten Bärten und dünnrandigen Brillen hatten unmittelbar mit uns zu tun, sie waren Ur- und Ururgroßväter (manchmal hängte ich im Geist noch ein paar »Ur« mehr an, damit es solider klang) oder deren Freunde und Bekannte; kleine Mädchen entpuppten sich als Großmütter oder Tanten mit bis zur Ununterscheidbarkeit ähnlichen Namen. Die Tanten Sanja, Sonja, Soka usw. auf diesen Porträts wechselten die Altersstufen, aber nicht den Gesichtsausdruck, sie saßen und standen vor verwaschenen Interieurs und phantastischen Landschaften. Wir fingen immer von vorne an, bei den ersten Bärten und Kragen, und etwa ab der Mitte des Abends begann alles zu verschwimmen, es blieb nur eine Vorstellung vom reinen Umfang. Dieser Umfang war groß, die geographische Streuung gewaltig – Chabarowsk und Gorki, Saratow und Leningrad, wo all diese Leute und ihre mit den Jahren verblassten Kinder gewohnt hatten, banden die Familiengeschichte nicht an konkrete Orte, sondern verschoben sie einmal mehr ins Nicht-Hier. Ich war glücklich, wenn wir endlich bei dem schmalen Album ankamen, in dem meine kleine Mutter zu sehen war – mit finsterer Miene in Jalutorowsk, während der Evakuierung, mit Puppe in Nachabino bei Moskau, mit Matrosenhemd und Fähnchen im Kindergarten. Das war ein Maßstab, den ich verstand, der mir entsprach, und in gewissem Sinn war das auch das Ziel der ganzen Übung: Der Blick auf diese kindliche Mama – schmollend, eingeschüchtert, auf einem lang vergessenen Lehmweg rennend, so schnell sie kann – war ein erster Schritt in eine neuartige, vorweggenommene Nähe, bei der ich die Ältere war und zärtlich und mitfühlend mit ihr sein konnte. Wenn ich heute aus der umgekehrten Altersperspektive darauf zurückblicke, sehe ich, dass diese Mitgefühls- und Ebenbürtigkeitsinjektion für mich zu früh kam – aber es ist gut, dass ich sie überhaupt bekam, denn als Erwachsene sollte ich die Rolle der Älteren, Mitfühlenden nicht spielen dürfen.
Erst viel später fiel mir auf, dass all die Einbände, die Erzählungen, die Fotos auf Pappe mit Goldschnitt (sie hatten tatsächlich einen richtigen Goldschnitt und auf der Rückseite verschnörkelte Aufschriften mit dem Namen des Fotografen und der Stadt, wo das Bild aufgenommen war) von der Seite der Braut kamen, also der meiner Mutter. Von der väterlichen Seite gab es nichts, nur zwei, drei Fotos auf dem Bücherregal. Auf diesen Fotos sah meine junge Großmutter Dora meiner jungen Mutter ähnlich, der strenge Großvater Kolja glich dem alten Pasternak – und so, als stumme Präsenz im heimischen Herrgottswinkel, blieben sie vom breiten Strom der Familiengeschichte mit seinen Anlegestellen, seinen Untiefen und seinem Delta so gut wie unberührt.
Neben den Fotos gab es auch Alben mit Postkarten (die ich erst später als Korrespondenz identifizierte: die Reste des Briefverkehrs meiner Urgroßmutter Sarra, eilig hingeworfene Nachrichten aus Paris, Nishni Nowgorod, Venedig, Montpellier), eine ganze Bibliothek einer anderen, untergegangenen visuellen Kultur. Pausbäckige Grazien und schnurrbärtige Beaus, russische Kinder in Kaftanen und symbolistische Der-Tod-und-das-Mädchen-Arrangements, Wasserspeier und eine endlose Reihe von Innokenti-Shukow-Skulpturen mit aufgerissenen Mündern. Sowie – diesmal ohne Gekritzel auf der Rückseite – Stadtansichten, gleichmäßig braune Veduten aus Italien, Frankreich, Deutschland.
Am liebsten hatte ich eine kleine Serie mit Ansichtskarten von Städten bei Nacht – dämmrige Gärten, eine leuchtende Straßenbahn in scharfer Kurve, ein leeres Karussell, ein verirrtes Kind, das vor einem Blumenbeet stand, in der Hand einen nutzlosen Fangreifen, hohe Häuser und die herzzerreißend roten, wie mit Lippenstift bestrichenen Fenster, hinter denen sich noch das alte, das Leben von damals abspielte. All das, dieses dunkle Blau, diese hellen Lichter dazwischen, verströmte reine Sehnsucht – und war doppelt und dreifach unerreichbar. Zum einen, weil die Unmöglichkeit des Reisens ein integraler, fragloser Teil des Alltags war: In unserer Welt fuhr man nicht ins Ausland (um die zwei oder drei Leute, die doch fuhren, lag die goldene Aura eines seltenen, kostbaren Glücks). Zum anderen, weil das moderne Paris aus dem Reiseführer von Maurois mit jenem, blauschwarzen, keinerlei Ähnlichkeit hatte, woraus klar hervorging, dass Jenes, wie auch immer man es nennen mochte, seit langem und unwiderruflich vorbei war. Die Ansichtskarten, wie auch die Visitenkarten meiner Urgroßmutter oder die hellen Kuverts mit dem himbeerroten matten Futter schrien danach, auf der Stelle benutzt zu werden – aber es war unmöglich, sich vorzustellen, was man hier und heute mit ihnen hätte anfangen können. Und so wurden die Alben wieder zugeklappt und zurück in den Schrank gestellt, die Karten in die Schachteln gelegt, und der Abend endete, wie Abende eben enden.
Einzelne Dinge aus dieser alten Welt (unser Haushalt war voll davon, er stand auf ihnen wie auf Pfoten) hatte man immerhin für das neue Leben nutzbar machen können; ein üppiger vergilbter Spitzenjabot wurde auf mein Musketierkostüm für einen Schulfasching aufgenäht, ein andermal kam ein schwarzer Pariser Hut mit unglaublich langer, gekräuselter Straußenfeder zum Einsatz. Die kleinen Glacéhandschuhe ließen sich nicht mehr überstreifen (sie waren mit den Jahren geschrumpft, aber ich dachte, sie wären mir einfach zu eng, und schämte mich wie Aschenputtels Schwester für meine groben Knochen). Aus den bunten, leichten Gardner-Tassen tranken wir zwei oder drei Mal im Jahr Tee, wenn Gäste kamen. All das fand an Feiertagen statt, den ungleichen Brüdern des Alltags, wenn die Gesetze verrutschen und das Verbotene erlaubt ist. An den übrigen Tagen lagen die Alben im Schrank, und die Zeit verging.
Ich muss an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen, dass meine Familie eine ganz gewöhnliche Familie war, weder reich noch berühmt, und dass sich die Fracht des von früher Erhaltenen bei Licht betrachtet als genau das erwies, was sie immer gewesen war: ein Museum des Intelligenzija-Lebens zu Beginn des Jahrhunderts, mit erschöpften Thonet-Stühlen, ein paar Eichensesseln und einer schwarzledernen Tolstoj-Ausgabe. Der vermeintliche Schatz war wirklich einer, aber in einem anderen, speziellen Sinn. Die Uhr schlug, das Barometer zeigte auf Sturm, der Briefbeschwerer mit der Eule lag da und tat nichts. Der Sinn dieser harmlosen, simplen Dinge bestand offenbar darin, zusammenzubleiben, und das war ihnen gelungen.
*
Es ist seltsam, dass diese Aufgabe – sich an alle zu erinnern – mich schon mein Leben lang begleitet und dass ich trotzdem so unfähig bin, sie zu erfüllen, heute wie damals. Keine Wiederholung des Durchgenommenen – und jedes Eintauchen in die Unterwasserhöhlen der Vergangenheit war eben dies: ein Aufzählen derselben Namen und Umstände, praktisch ohne Ergänzungen und Abweichungen – brachte mich dazu, die Liste auswendig zu lernen. Manches setzte sich von selbst im Gedächtnis fest, als blinder Passagier – in aller Regel war das eine Anekdote oder ein Kuriosum, ein Barthessches punctum, vom Visuellen ins Verbale verschoben. Es waren Sujets von der Art, die zum Weitererzählen taugen, und was änderte es schon, ob einer dieser Verwandten mit gestärktem Kragen Arzt oder Anwalt war. Das Gefühl einer selbstverschuldeten Lückenhaftigkeit blockierte mein Gedächtnis nur noch mehr und ließ mich genauere Nachfragen auf später verschieben. Es war ja klar, dass ich irgendwann ein Heft zur Hand nehmen und mich mit meiner Mutter hinsetzen würde, und sie würde mir alles erzählen, von Anfang an, und alles würde endlich Sinn ergeben und System haben; ich würde einen Stammbaum zeichnen, ich würde jeden einzelnen Cousin und Neffen kennen, und irgendwann gäbe es dann auch ein Buch. An der Notwendigkeit dieses Vorhabens zu zweifeln kam mir nie in den Sinn.
Aber ich fragte nicht nach und prägte mir nichts ein – trotz meines Talents, nutzlose (manchmal auch nützliche) Informationen zu behalten, und trotz meines Affengedächtnisses für alles Sprachliche. Es blieb bei Puzzleteilen: Sanja-Sonja-Soka, schnell heruntergerasselt, plus eine Anzahl namenloser Fotos ohne Bildlegenden, fliegende Geschichten ohne Subjekte, vertraute Gesichter von Unbekannten.
*
Ein wenig ähnelt das alles dem Mah-Jongg, das es früher auf unserer Datscha gab. Die Datscha (das Datschalein: ein kleines Zimmer, eine kleine Küche, eine Veranda, ein morastiges Grundstück, an dem sich ein paar starrsinnige Apfelbäume festkrallten) stand in Saltykowka bei Moskau; hierher brachten meine Angehörigen über Jahrzehnte alles, was seine beste Zeit hinter sich hatte, hier führte es ein robustes, solides zweites Leben. Ich glaube, bei uns wurde nie irgendetwas weggeworfen, die alt gewordenen Dinge machten die Welt nur dichter und eindeutiger. Die ehemaligen Möbel leisteten Schwerarbeit im Alter, sie mussten aufnehmen, einsammeln, aushalten, was immer zu unserem Sommerhaushalt gehörte: sinnlose Schreibgarnituren im Schuppen, hundertjährige Nachthemden in der Kommode, und im Schrank hinter dem Spiegel ein Mah-Jongg-Spiel im Leinensäckchen. Dieser Gegenstand fesselte mich über Jahre, mit jedem neuen Sommer hoffte ich, ihn zu verstehen und in den Dienst der Menschheit zu stellen. Vergeblich.
Ich wusste, dass meine Urgroßmutter das Mah-Jongg aus dem Ausland mitgebracht hatte (und da unser Hausstand auch zwei verschlissene, altersleichte Kimonos umfasste, einen großen und einen kleinen, der mir gehörte, zweifelte ich nicht daran, dass dieses Ausland Japan war). Das Säckchen enthielt dunkelbraune Spielsteine, und jeder Stein hatte einen weißen Bauch mit unverständlichen Hieroglyphen, in die ich vergeblich Ordnung zu bringen suchte: das Boot zu den Booten, den floralen Schnörkel zu seinesgleichen. Es waren zu viele Kategorien und beängstigend wenig verwandte Elemente; irgendwann kam mir der Gedanke, dass über die Jahre vielleicht Spielsteine verlorengegangen waren, was mich endgültig verwirrte. Dass es hier ein System gab, war offensichtlich, aber ebenso klar war, dass ich dieses System weder verstehen noch mir auf seiner Basis mein eigenes, einfacheres ausdenken konnte. Ich konnte nicht einmal einen Spielstein abzweigen und in der Jackentasche mit mir herumtragen, ohne dass das Ganze litt.
Als ich ernsthaft ans Erinnern ging, wurde mir plötzlich klar, dass ich nichts in der Hand hatte. Von den Abenden im Licht der alten Fotos war so gut wie nichts geblieben, weder Daten noch sonstige Angaben, nicht einmal angedeutete Verwandtschaftslinien: Wer war wessen Cousin, wessen Neffe? Dieser segelohrige Junge in der Uniformjacke mit den Goldknöpfen und jener segelohrige Erwachsene im Offizierstuch waren offenbar derselbe Mensch, aber wie war ich mit ihm verwandt? Ich wusste nur noch, und auch das nicht ganz sicher, dass er Grigori hieß, aber das half mir nicht weiter. Die Leute, aus denen diese Welt mit ihren Valenzen, ihren Verwandtschaftsverhältnissen und ihrem städteübergreifenden Wärmenetz bestand, waren tot, in alle Richtungen zerstreut, verschollen. Die Familiengeschichte, die ich mir als zügiges, lineares Narrativ vorgestellt hatte, zerfiel in meinem Bewusstsein in kleine quadratische Fragmente, in Fußnoten zu einem nicht vorhandenen Text, in Hypothesen, die zu überprüfen mir niemand helfen konnte.
Denn nicht nur rankten sich um die Erzählungen meiner Mutter einige zweifelhafte Sujets von der Sorte, die dem gewöhnlichen Übergang von einer Generation zur nächsten Würze geben, die aber als Apokryphen gehandelt werden. Solche Geschichten beschränken sich oft auf einen Halbsatz am Rande der eigentlichen Erzählung: Angeblich wohnte er in …; wenn ich mich nicht irre, war sie eine …; der Legende nach ist ihm … passiert. Natürlich ist dieses Märchenelement der wonnevollste Teil der Überlieferung. Es sind gerade diese Kristallisationskeime einer Romanform, die sich für immer einprägen, über das öde Wann und Wo hinweg; gerade sie möchte man ausbreiten, nacherzählen, mit selbstgemachten Details anreichern. Ich erinnere mich gut an sie. Das Problem ist nur, dass auch sie ohne lebendigen Träger ihren Sinn, ihre Überprüfbarkeit und im Lauf der Jahre auch ihre Individualität verlieren; sie richten sich an geläufigen Modellen, den Bahnen des Typischen aus. Inzwischen kann ich kaum mehr sagen, was von dem, was ich behalten habe, real war – nicht nur real geschehen, sondern real gesagt: was davon mündlich überliefert wurde und was ich unwissentlich aus eigenem Willen hinzugefügt habe.
Oder manchmal auch wissentlich: Ich erinnere mich noch gut, wie ich mich als junges Mädchen mit einer Geschichte von einem angeblichen Fluch in der Familie interessant zu machen versuchte. Er verliebte sich leidenschaftlich in eine verarmte polnische Adelige, behauptete ich, aber um sie zu heiraten, musste er sich taufen lassen – deshalb hat sein Vater ihn verflucht und nie wieder ein Wort mit ihm geredet, und sie lebten in Armut und starben jung an Schwindsucht.
Tatsächlich endete die bewusste Geschichte nicht mit Schwindsucht – Familienfotos zeigen den verstoßenen Sohn in seiner augenscheinlich glücklichen Zukunft, mit Brille auf der Nase, umgeben von Enkeln, vor einem ganz normalen sowjetischen Hintergrund. Und die polnische Adelige – hat es sie wirklich gegeben, oder habe ich sie zur Ausschmückung hinzugefügt? Polnisch – weil ausländisch gleich interessant war; adelig – um die öde Reihe von Kaufleuten, Juristen und Ärzten mit etwas Fremdem, Ungewöhnlichem aufzulockern? Ich weiß es nicht, ich erinnere mich nicht. Irgendetwas war da in der Erzählung meiner Mutter, ein schwach leuchtender Ausgangspunkt, an den mein freies Phantasieren sich knüpfte – aber es gelingt mir nicht mehr, ihn zu vergrößern, ich bekomme das erste Samenkorn nicht zu fassen. In meiner Geschichte bleibt die ungewisse polnische Adelige die Ursache eines handfesten, fraglosen familiären Unglücks. Denn den Fluch hat es wirklich gegeben, und ebenso die Armut; mein Ururgroßvater hat seinen Ältesten nie wieder gesehen, und irgendwann sind sie in der Tat alle gestorben.
Und noch etwas gehört zu meinem Erbe, das auch mit der Konstruktion dieser Geschichte zu tun hat, damit, wie und von wem sie erzählt wurde: die Vorstellung von unserer Familie als weiblichem Clan, als Reihe von starken, für sich stehenden Frauen (Werstpfähle quer durchs Jahrhundert). Ihre Lebensgeschichten wirkten besonders vergrößert, sie standen – Hand in Hand, ineinander übergehend – im Vordergrund des vielköpfigen Gruppenbilds. Obwohl sie alle verheiratet waren, fiel auf die Männer der Familie weniger Licht, als hätte diese Geschichte fast nur Heldinnen und kaum Helden. Andererseits hatte auch das seine Gründe: Die Männer waren nicht die Stütze dieser Sippe, und dafür konnten sie wenig. Einer starb früh, ein zweiter noch früher, ein dritter war mit anderen, offenbar unerheblichen Dingen beschäftigt. Die letzte Etappe – der Abschnitt der Erzählung, in dem das heitere Durcheinander sich schon zu einer Vorgeschichte ordnete, zu Stufen, die geradewegs auf mich zuliefen – bestand in meinem Kopf (und vielleicht auch in dem meiner Mutter) ausschließlich aus Frauen. Sarra gebar Lola, Lola gebar Natascha, Natascha gebar mich. Die Generationenmatrjoschka schien auf eine kontinuierliche Reihe weiblicher Einzelkinder festgelegt, und diese einzige Tochter, die aus einer anderen einzigen Tochter hervorging, bekam deshalb auch die Gabe und das Recht, als Einzige zu erzählen.
*
Was war eigentlich meine Idee gewesen, was hatte ich vorgehabt in all den Jahren? Ich wollte ein Denkmal errichten für diese Menschen, dafür sorgen, dass sie sich nicht auflösen, unerwähnt und unerinnert. Dabei war ich die Erste, die sie vergessen hatte. Meine Familiengeschichte besteht aus Anekdoten, zu denen es praktisch keine Gesichter und Namen gibt, aus Fragen, die ich nicht formulieren kann, weil mir die Grundlage dafür fehlt, und die ich ohnehin niemandem mehr stellen könnte.
Jacques Rancière stellt in seinem Essay über die Figuren der Geschichte einen Gegensatz zwischen Dokument und Monument her: Unter Dokument versteht er jeden Bericht über ein Ereignis, der erschöpfend sein will, der beansprucht, Geschichte zu erzählen – »eine Erinnerung offiziell zu machen«. Der Gegensatz dazu, das Monument, ist im ursprünglichen Sinn »das, was durch sein bloßes Dasein Erinnerung bewahrt, was direkt spricht, gerade weil es eigentlich nicht sprechen sollte – (…) der Lageplan eines Geländes, der besser von vergangenem menschlichen Handeln Zeugnis ablegt als jede Chronik; ein Haushaltsgegenstand, ein Stück Stoff, ein Tongefäß, ein Grabstein, das Muster, mit dem eine Truhe bemalt ist, oder ein Vertrag zwischen zwei Personen, über die wir nichts wissen (…)«.
Mein Denkmal, mein Monument in diesem Sinn war längst errichtet, ich hatte wie in einer Pyramide all diese Jahre darin gelebt: zwischen Sessel und Klavier, in einem Raum, der durchsetzt war von den Fotos und Objekten eines fremd-eigenen, vergangen-andauernden Lebens. Die Kisten mit dem Familiennachlass, in denen sich so gut wie keine zum historischen Zeugnis taugende persönliche Aufzeichnung findet, dafür jede Menge Glückwunschkarten und Gewerkschaftsausweise, Epithelzellen des Erlebten und Unausgesprochenen, sind keine schlechteren Erzähler als jene, die für sich selbst sprechen können. Schon eine einfache Auflistung der Gegenstände wäre genug.
Man könnte hoffen, aus all diesen Dingen den toten Osiris zusammenzusetzen, den kollektiven Körper der Familie, die nicht mehr hier wohnt. Zweifellos bilden all diese Erinnerungsfragmente und Splitter der alten Welt ein Ganzes, eine spezielle Form der Einheit. Und dieses defizitäre, unvollständige Ganze, das vor allem aus Lücken und Abwesenheiten besteht, ist nicht schlechter und nicht besser als ein beliebiger Mensch, der sein Leben gelebt und überlebt hat – oder genauer, als dessen unbeweglicher, finaler Korpus.
Der invalide Körper, der außerstande ist, das ins Gedächtnis Zurückgerufene zu einer kohärenten Erzählung zusammenzufügen – will er gesehen werden? Und selbst angenommen, dass er gar nichts mehr will, darf man ihn zum Gegenstand einer eigenen Erzählung machen, zum Ausstellungsobjekt – dem rosa Strumpf der Kaiserin Sissi oder dem blutverschmierten verrosteten Schraubenzieher, der ihr Ende war? Indem ich meine Familie den Blicken der Allgemeinheit aussetze, und sei es mit der größtmöglichen Liebe, mit den besten Worten in der besten Reihenfolge, handle ich doch wie einst Ham: ich enthülle die wehrlose Blöße meiner Sippe, ihre dunklen Achselhöhlen, ihren weißen Bauch.
Wahrscheinlich werde ich nichts Neues über sie erfahren. In meiner Geschichte gibt es weder Intrige noch Ermittlung, weder die Hölle eines Péter Esterházy, der erfahren musste, dass sein geliebter Vater ein Informant der Geheimpolizei war, noch das Paradies derer, die von klein auf alles über ihre Angehörigen wissen und die Erinnerung an sie in Ehren halten. Bei mir ist es anders gekommen, und auch mein Buch über meine Familie wird ein Buch über etwas anderes. Am ehesten wohl darüber, wie Erinnerung funktioniert und was sie von mir will.
*
Im Frühjahr 2011 lud mich ein Bekannter nach Saratow ein. Geplant war eine Art Vortrag über das Internet-Portal, bei dem ich arbeitete; mein Bekannter tat etwas für sein geliebtes Saratow, indem er Leute aus der Hauptstadt, die etwas Interessantes zu sagen hatten, dorthin einlud. Im Gespräch kamen wir von meinem Vortrag schnell auf Saratow selbst, die Heimat meines Urgroßvaters, wo ich nie gewesen war. Früher waren von Zeit zu Zeit Verwandte von dort bei uns zu Hause aufgetaucht – ich fieberte ihrem Besuch entgegen, seit mir einer von ihnen einmal als Gutenachtgeschichte Gogols Wij erzählt hatte, in einer bei Licht betrachtet überaus merkwürdigen eigenen Version mit Happy End: Das Fräulein und Choma schlenderten darin Arm in Arm durch die luftigen Stockwerke, von Himmel zu Himmel, von Galerie zu Galerie, über rote Rosenblütenblätter. Noch vor dem Wij gab es einen lächelnden roten Spielzeughund namens Pif-aus-Saratow, und viele Dinge mehr, aber im Lauf der Zeit reduzierte sich die Erinnerung auf diese zwei.
Mein Bekannter hatte ein Tablet dabei, und auf dem Tablet fanden sich zu meiner Überraschung Dutzende gescannte Ansichtskarten aus dem vorrevolutionären Saratow: Grün und Weiß, Bäume und Kirchen, je weiter wir blätterten, desto mehr verschwammen die Konturen, ich erinnere mich nur noch an die weite, mit Schiffen besetzte Wasserfläche der Wolga. Das Tout Saratow von 1908 habe ich auch heruntergeladen, sagte mein Bekannter, hier. Graue Listen von Namen und Straßen tauchten auf; ich habe versucht, meine Familie zu finden, sagte er, aber das ist hoffnungslos, die Gridassows ziehen sich hier über zehn Seiten.