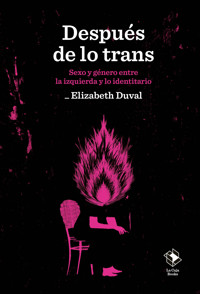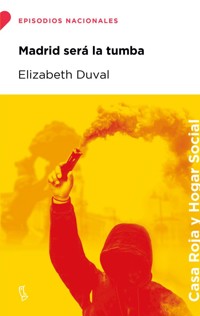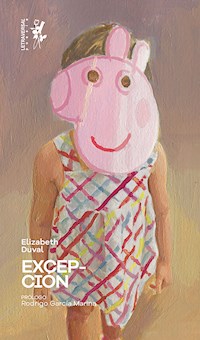Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Immer mehr Menschen identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde. Die Debatte um ein neues Selbstbestimmungsgesetz wird zunehmend heftiger geführt – nicht zuletzt innerhalb der LGBTQ-Community wie auch in Teilen des Feminismus und der Linken. Kein Wunder, schließlich handelt es sich bei der Einteilung in Frau und Mann um eine der weitreichendsten sozialen Unterscheidungsformen. Trans sprengt dieses Muster und fordert damit das Denken heraus: Was heißt es, sich als trans zu erfahren? Was kann trans sein – und was nicht? Verschwindet die binäre Geschlechterdifferenz? Elizabeth Duval, selbst Transfrau und in Spanien längst eine einflussreiche Intellektuelle, stellt sich diesen Fragen mit Witz, argumentativer Sorgfalt und Sinn fürs Grundsätzliche – jenseits persönlicher Bekenntnisse und diskursiver Erregungsdynamiken um Transgender-Toiletten. Abwägend, nie abwertend, schreibt Duval über Geschlecht als komplexes soziales System, über historische und heutige Phänomene der Fluidität, über Diskriminierung, die Grenzen der Selbstbestimmung und darüber, was nach Trans kommt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Was bedeutet es, trans zu sein? Elizabeth Duval über Biologie und Begriffe, Geschlechtsidentität und Gender-Neuplatonismus – und die Zukunft der Linken: ein brillanter philosophischer Essay, streitbar, aber nicht unversöhnlich.
»Dieses Buch hat mein Denken verändert.«Wolfram Eilenberger
Elizabeth Duval
Nach Trans
Sex, Gender und die Linke
Aus dem Spanischen von Luisa Donnerberg
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
Vorwort zu den internationalen Ausgaben
Prolegomena Die Schnauze voll von trans
I Erwerb und Selbstbestimmung des Geschlechts:Haben versus Sein
Eine kurze Trans-Geschichte
Ein Versuch, Geschlecht zu definieren
Die begriffliche Unmöglichkeit der Selbstbestimmung
Das Subjekt, sein Bild und das Virtuelle
Ein erstes politisches Programm: Subjekt werden
II Trans, Identitätspolitik und die Linke
Über Identität sprechen
Materielle Realität und Neuer Materialismus
Die trans-ausschließende Reaktion: Eine Einführung
Geschlecht als System und Geschlecht als Prozess
Die Rolle der Wahrnehmung bei Begehren und Gewalt
Trans: Historizität und Kontext
Vier Thesen über trans
III Gegen Toleranz und Statistik
IV Niemand weiß, was ein emanzipatorischer Anus kann: Disput mit Paul B. Preciado
Manifest gegen das Kontrasexuelle Manifest
Entzugsklinik für Testo-Junkies
Über die Legitimität der vorübergehend autonomen Zonen auf dem Uranus
Dialog zwischen sprechenden Monstern
V Um wen und was geht's im Feminismus?
Kathleen Stock oder: warum die Wirklichkeit für trans unerlässlich ist
Die Tricks von Irreversible Damage und Abigail Shrier
Auseinandersetzung mit dem Philosophischen Feminismus
Szenen eines politischen Konflikts
VI Nach trans
Trans-Ströme
Nach trans
Epilog Ein politisch-moralischer Vorschlag
Dank
Editorische Notiz
Anmerkungen
À Hannah : la suite, l'évolution, on la vivra ensemble. Permets-moi de paraphraser : il y a dans la contemplation du beau quelque chose qui nous détache de nous-mêmes, en nous faisant sentir que la perfection vaut mieux que nous, et qui par cette conviction, nous inspirant un désintéressement momentané, réveille en nous la puissance du sacrifice, qui est la source de toute vertu. Nous sommes meilleurs lorsque nous sommes émus, et aussi longtemps que nous le sommes. Tu me reprochais (et je sais bien que «reprocher» n'est pas le verbe pertinent) de mentir dans une dédicace originelle, car je n'avais pas écrit la plupart du texte à ton côté; j'étais éloignée, à Madrid, à cause du confinement.
Mais je suis convaincue du fait que je n'aurais pas aimé ce texte sans t'aimer, et que je n'aurais jamais autant d'amour pour les choses sans le tien. Je ne dirais aucun mensonge si je disais de ce livre, ou de n'importe quel autre que j'écrive, qu'il doit quelque chose à la paix tranquille de tes bras. Or, je ne suis plus apathique, je ne suis plus cynique : je crois désormais à quelque chose. Je pense avec toi, et je pense à côté de toi, et je te pense; et, grâce à toi, je suis émue.
Für meinen ersten Lehrer, Felipe Martín Ignacio Silvero: Dank dir kann Philosophie nicht anders, als in Erscheinung zu treten.
Machen wir uns nichts vor. Wir werden vom Anderen dekomponiert. Und wenn es nicht so ist, fehlt uns etwas. Bei der Trauer scheint das eindeutig so zu sein, allerdings nur deshalb, weil es schon beim Begehren so war. Man bleibt nicht immer intakt. Vielleicht will man das oder bleibt es, aber es kann auch so sein, dass man trotz aller Anstrengungen aufgelöst wird, beim Anblick des Anderen, durch die Berührung, den Duft, das Gefühl, durch die Aussicht auf Berührung, durch die Erinnerung an das Verspürte. Wenn wir von meiner Sexualität oder meiner Geschlechtsidentität sprechen, wie wir es tun (und tun müssen), meinen wir also etwas Kompliziertes. Genau genommen ist weder das eine noch das andere ein Besitz, vielmehr sind beide als Modi der Enteignung zu verstehen, als Formen des Daseins für einen Anderen oder sogar kraft eines Anderen.
Judith Butler: Die Macht der Geschlechternormen
Dieses Zertifikat lehne ich ab: Ich bin kein Dichter, sondern ein Gedicht. Eines, das geschrieben wird, auch wenn es so aussieht, als sei es ein Subjekt.
Jacques Lacan: Vorwort zur englischen Ausgabe von Seminar XI
Vorwort zu den internationalen Ausgaben
Der Angriff auf die Rechte von trans Menschen ist ein internationales Phänomen, und als solches muss es behandelt werden. Wir können die Spanierinnen Amelia Valcárcel, Laura Freixas, Carmen Calvo oder Ángeles Álvarez nicht ohne die Britinnen J. K. Rowling und Kathleen Stock oder die US-Amerikanerin Abigail Shrier verstehen; und auch nicht, ohne uns der Bedeutung von Alice Schwarzer in Deutschland oder von Marguerite Stern in Frankreich bewusst zu sein. Dabei ist diese Aufzählung längst nicht vollständig. Denn Angriffe auf die Rechte von trans Menschen ereignen sich nicht nur im Westen, es gibt sie ganz genauso beispielsweise in lateinamerikanischen Ländern. Es ist nicht so kompliziert, wie es zunächst scheint, eine internationale Perspektive in einen Text zu integrieren, der in einem und für einen ganz konkreten Kontext wie den Spaniens geschrieben worden ist. Die meisten Argumente gegen Trans-Gesetze, die auf dem juristischen Prinzip der Selbstbestimmung beruhen (also der Möglichkeit für trans Menschen, ihre Identität ohne zwischengeschaltetes Kontrollverfahren selbst zu bestimmen und vom Staat anerkennen zu lassen), sind hier wie dort die gleichen, beziehungsweise viele der in den jeweiligen nationalen Debatten vorgetragenen Argumente werden schlicht aus ausländischen Diskursen übernommen, ohne dass sie in ihrem neuen Kontext ihren Sinn behielten.
Ich denke, es ist angemessen, für meine internationalen Leser ein Vorwort zu schreiben, das von denen der verschiedenen spanischen Ausgaben inhaltlich etwas abweicht und zugleich wirksame Argumente enthalten kann, wenn es darum geht, bestimmte Gesetzesänderungen in verschiedenen Teilen der Welt zu verteidigen. Gleichzeitig möchte ich solche Reformen, und wie sie meiner Meinung nach aussehen sollten, aus einer globaleren Perspektive betrachten und analysieren.
Meine Leser sollten wissen, dass dieses Buch in Spanien kontrovers aufgenommen worden ist und meine Worte dabei bisweilen verdreht wurden. Ich bereue nichts von dem, was ich in diesem Essay geschrieben habe. Ich würde nicht schreiben, wenn ich der Ansicht wäre, dass Zweifeln schwächer macht. Ich glaube im Gegenteil, dass es uns stärkt. Und dennoch habe ich ein wenig Angst davor, wie meine Thesen interpretiert werden könnten. Ich habe beharrlich versucht, darauf hinzuweisen, dass ich, wenn ich mir mehr oder weniger nahestehende politische Vorschläge kritisiere, das immer aus Zuneigung und dem Wunsch heraus tue, einander zu verstehen, die Dinge besser zu machen und ihnen eine stabilere Grundlage zu geben. Ich weiß nicht, ob meine beharrlichen Hinweise ausreichen. Auch deshalb scheint mir dieses neue Vorwort wichtig. Ich nehme nichts von dem, was ich gesagt habe, zurück, aber ich möchte ein paar neue Erläuterungen bereitstellen, die beim Verständnis meines Textes hilfreich sein könnten.
Alle, die etwas von mir gelesen haben, wissen, dass ich immer dazu bereit gewesen bin, mit absolut jedem zu debattieren, auch – und das nicht selten – in feindlicher Umgebung. Ich habe mich dem Dialog nie verweigert. Traurigerweise sind mir in Spanien Hass und Engstirnigkeit begegnet. Vor kurzem und ohne dass es etwas mit der Veröffentlichung meines Buches zu tun gehabt hätte, habe ich eine wirklich unheimliche Menge an Hass und verbaler Gewalt erfahren. Und zwar nur, weil ich mich öffentlich über das spanische Trans-Gesetz geäußert und seine Ansätze und Ziele in Teilen unterstützt habe. Die Leser dieses Essays werden gleich zu Beginn erfahren, was ich über Meinungsfreiheit denke. Dass ich gegen die juristische Sanktionierung solcher verbalen Übergriffe bin, bedeutet allerdings nicht, dass ich sie in moralischer oder ethischer Hinsicht für »gut« befinde. Ich halte sie für ungerecht, und ich halte sie für falsch. Wer will, kann besser sein und die Dinge besser machen. Und genau deshalb lehne ich es umgekehrt auch ab, jeden, der Vorbehalte gegen die Verabschiedung eines Trans-Gesetzes hat, als gewalttätigen und hasserfüllten Menschen zu karikieren, der sich dem Thema aus einer zutiefst von Angst getrübten Perspektive nähert. Ich glaube, dass viele Wortführer der trans-ausschließenden Gegenbewegungen sich der Frage allerdings mit solchen Gefühlen nähern und sich im Grunde wirklich die Ausrottung von trans Menschen wünschen. Ich denke da an die Worte von Janice G. Raymond: »Das Transsexualitätsproblem wäre am besten dadurch zu lösen, dass man es moralisch aus der Existenz hinausbefiehlt«.1 Das heißt nicht, dass es nicht auch Menschen gibt, die gleichzeitig Bedenken und gute Absichten haben. Und ich bin sicher, dass es Menschen mit Bedenken und guten Absichten sogar unter denen gibt, die sich trans von der Angst her nähern, sei es aus Angst vor dem Schreckgespenst der Angreifer auf der Toilette oder vor irgendetwas anderem. Ich glaube, dass diese Angst ein Ausdruck von Verletzlichkeit ist, von einer Wunde, die sich zum Glück noch nicht so weit entzündet hat, dass sie sich zur Wut wandelt: Wenn es sich um Angst handelt, dann ist da auch noch eine Möglichkeit. Und wenn da noch eine Möglichkeit ist, dann ist es notwendig, auf der Tugend des Dialogs zu bestehen und auf den Versuch, den anderen zu verstehen.
Ich wende mich an diejenigen, die nicht zulassen, dass die Art, wie sie auf die Welt blicken, von Angst beherrscht wird. Dieser Essay wäre sinnlos, wenn meine einzige Absicht darin bestünde, zu denen zu predigen, die bereits überzeugt sind. Ich versuche die zu verstehen, die zweifeln: Ich versuche ihnen aufmerksam, ja sogar liebevoll zu begegnen – trotz allem. Deshalb debattiere ich weiter, und deshalb erlaube ich mir, in diesem Vorwort ein paar der Gemeinplätze und Widersprüchlichkeiten aufzuführen, die gegen Trans-Gesetze und ihre Verabschiedung vorgebracht werden.
Ein Teil der Gegner von Trans-Gesetzen – der Teil, der sich verständnisvoller oder dialogbereiter und gemäßigter gibt – spricht Trans-Gesetzen, die dem Prinzip der Selbstbestimmung unterliegen, geradewegs die Befähigung ab, trans Menschen selbst zugutezukommen. Dabei wird argumentiert, hier dringe die Queer Theory ins Rechtssystem ein. Der erste Entwurf des spanischen Trans-Gesetzes widmet sich verschiedenen Fragen, aber das Grundlegende ist die erleichterte Änderung des Geschlechtseintrags (und des Vornamens). In neun Mitgliedsländern des Europarats ist solch eine erleichterte Änderung bereits möglich, wie in einem Bericht über die rechtliche Anerkennung des Geschlechts in Europa aus dem Jahr 2022 nachzulesen ist: in Belgien seit 2018, in Dänemark seit 2014, in Island seit 2019, in Irland seit 2015, in Luxemburg seit 2018, in Malta seit 2015, in Norwegen seit 2016, in Portugal seit 2018 und in der Schweiz seit 2021.2 Hilft das trans Menschen? Wenn man den Studien Glauben schenken darf, lautet die Antwort: Ja. In dem Paper Chosen Name Use Is Linked to Reduced Depressive Symptoms, Suicidal Ideation, and Suicidal Behavior Among Transgender Youth von Russell et al., das 2018 im Journal of Adolescent Health erschien, geben die Autoren an, dass der Gebrauch eines selbst gewählten Namens, der durch Trans-Gesetze erheblich erleichtert wird, das Risiko von Suizidgedanken und anderen psychischen Problemen – wie Depressionen und suizidalem Verhalten im Allgemeinen – bei trans Menschen deutlich reduziere.3
Ein weiteres Argument, das benutzt wird, um das Kollektiv der trans Menschen zu stigmatisieren (das mit dem Verweis auf vermeintliche Pathologien einhergeht, wenn beispielsweise Gender-Dysphorie als Geisteskrankheit betrachtet wird), ist die Häufigkeit von Suizidgedanken unter trans Menschen. Konkrete Daten diesbezüglich, die auch von Interesse sind, wenn es um die Notwendigkeit einer Transition geht, lassen sich ebenfalls in wissenschaftlichen Untersuchungen finden: In dem Paper Suicide risk in the UK trans population and the role of gender transition in decreasing suicidal ideation and suicide attempt von Bailey et al., das 2014 im Mental Health Review Journal erschien und auf der bislang umfangreichsten Studie zur psychischen Gesundheit von trans Menschen in Großbritannien basiert (der Trans Mental Health Study von McNeil et al. aus dem Jahr 2012), heißt es: 67 Prozent der Befragten hätten vor der Transition über Suizid nachgedacht, demgegenüber seien es nach der Transition nur noch 3 Prozent gewesen.4
Die trans-ausschließende Reaktion ist ähnlich strukturiert wie andere reaktionäre Strömungen oder rechtsextreme Bewegungen, was nicht bedeutet, dass jeder, der trans-ausschließende Bestrebungen verfolgt, in eine dieser Kategorien fällt, sondern lediglich, dass sich die Methoden ähneln. Eine der wichtigsten Referenzen für bestimmte Kreise ist das Buch Irreversible Damage (2020) von Abigail Shrier, das als Plädoyer gegen die geschlechtsangleichende Behandlung von Minderjährigen präsentiert wird. Es ist ein Buch, in dem trans als eine »soziale Epidemie« bezeichnet wird, die insbesondere junge Frauen und Mädchen betreffe – im Einklang mit der Theorie der sogenannten »Rapid Onset Gender Dysphoria«, die von Verbänden wie der Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada in Spanien, Genspect in Großbritannien, Parents with Inconvenient Truth About Trans in den USA, Ypomoni in Frankreich oder Trans Teens Sorge Berechtigt in Deutschland verbreitet wird. Besagte Theorie sieht folgendermaßen aus: In den letzten Jahren habe es Jugendliche gegeben, die nicht wirklich trans sind und ihre Transition nur begonnen hätten, um mit anderen psychologischen oder sozialen Problemen fertigzuwerden; außerdem verbreite sich diese Dysphorie in Freundes- und Bezugsgruppen von vor allem jungen Mädchen. In Papern wie dem kürzlich im Journal of Pediatrics erschienenen Do Clinical Data from Transgender Adolescents Support the Phenomenon of »Rapid Onset Gender Dysphoria«? ist zu lesen, es gebe in klinischen Studien keinerlei Nachweise dafür, dass ein solches Phänomen tatsächlich existiere. Die Verfasser des Papers vermuten, das behauptete Phänomen der »Rapid Onset Gender Dysphoria« sei eher auf nicht repräsentative Stichproben von Erfahrungen oder Wahrnehmungsweisen konkreter Gruppen von Eltern zurückzuführen.5
Abigail Shriers Buch, das ich später eingehender analysieren werde, hat diese Theorie popularisiert und in internationalen Medien für großen Wirbel gesorgt. Dabei ist es kein argumentativ überzeugendes Buch, sondern ein Pamphlet, das sich laut Verlagswerbung gegen das »Establishment in Medizin und Wissenschaft« richtet. Shrier verficht darin die Meinung, dass der gefährliche »Transgender-Hype« beziehungsweise die gefährliche »Gender-Ideologie« das Leben tausender Mädchen ruiniere. Shrier erklärt, dass wissenschaftlichen und medizinischen Spezialisten zu viel und den Bedenken der Eltern zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt werde.
Die Tatsache, dass der überwiegende Teil der Kritik an Trans-Gesetzen und insbesondere derjenigen an den Gesetzen, die Minderjährige betreffen, kaum begründet ist oder schlichtweg fehlgeht, bedeutet nicht, dass man keine vernünftige Kritik an bestimmten Aspekten der Gesetzgebung zu trans üben kann. Es sollte in jedem Fall darauf geachtet werden, wie wir die Dinge benennen und auf welche Weise wir sie in unsere Gesetzestexte aufnehmen. In Spanien gab es linke Parteien, die trans Menschen in ihren Wahlprogrammen als »Menschen, die mit der Binarität von sex und gender brechen« bezeichnen oder Geschlechtsidentität als etwas darstellen, das »selbst gewählt« und »völlig autonom« festgelegt werden kann. Solche Formulierungen sind in Wirklichkeit zutiefst kontraproduktiv. Dafür einzutreten, dass trans Menschen weder absurden medizinischen Beurteilungen (im Englischen würde man das Gatekeeping nennen) noch psychiatrischen Untersuchungen ausgesetzt sein sollten, ist etwas anderes, als zu behaupten, dass Geschlecht etwas sei, das frei gewählt wird, und nicht etwa die Folge der Existenz in einer ganz bestimmten Gesellschaft ist.
Es ist viel einfacher, anderer Meinung zu sein, wenn jemand von der Freiheit spricht, über sein Geschlecht selbst zu entscheiden, als wenn jemand bekräftigt, dass trans Menschen gewisse Grundrechte haben. Das Problem besteht darin, dass man versucht hat, einen juristischen Begriff (den der »Selbstbestimmung«) auf soziale und politische Realitäten zu übertragen. Es ist ein Fehler gewesen, von der Entpathologisierung und der Forderung, sich von der Voraussetzung medizinischer Diagnosen zu befreien, dazu überzugehen, von Geschlecht zu sprechen, als könne man es sich morgens nach dem Aufstehen und beim Anziehen aussuchen, ganz so, als wäre es eine Art Kostüm. Das ist ein Fehler, weil diese Beschreibung genau dem entspricht, wie uns die trans-ausschließende Reaktion haben will.
Die Rede von Wahlfreiheit und Selbstbestimmung verschleiert Geschlecht als soziale Tatsache und System. Ich schlage vor, lieber davon zu sprechen, dass trans Menschen ein Recht auf Anerkennung ihres Geschlechts haben, das heißt auf Anerkennung ihrer frei zum Ausdruck gebrachten Geschlechtsidentität, ohne dass ein medizinischer Befund erforderlich ist. Zum Glück gehen viele Entwürfe für Trans-Gesetze in diese Richtung. Selbstbestimmung wird darin als juristisches und nicht als begriffliches Werkzeug gehandhabt. Das ist eine weit weniger unzureichende Form, über trans zu sprechen, als mithilfe von Begrifflichkeiten der Entscheidungsfreiheit.
Woher kommt die Rede von der Selbstbestimmung des Geschlechts? Sie ist bereits in Dean Spades Aufsatz Compliance Is Gendered: Struggling for Gender Self-Determination in a Hostile Economy von 2006 zu finden. Dean Spade spricht dort davon, dass »die medizinische Evidenz der entscheidende Faktor bei der Bestimmung der [Rechte von trans Menschen] bleibt«. Er definiert die Selbstbestimmung des Geschlechts als »Instrument, mit dem sich Widerstand gegen die Zwangsmechanismen des binären Geschlechtersystems ausdrücken lässt«. Er sagt weiter, dass er den Begriff »strategisch verwendet«, während er sich gleichzeitig bewusst sei, »dass jede Vorstellung von Selbstbestimmung mit einem Verständnis von Individualität verbunden ist, das kapitalistische Konzepte wie das der persönlichen ›Freiheit, seine Arbeitskraft zu verkaufen‹, unterstützt und dass diese Konzepte Unterdrückungsmechanismen verschleiern«.6 Der Begriff der Selbstbestimmung des Geschlechts wird von Dean Spade also definitiv als Mittel zu einem bestimmten Zweck verwendet, der darin besteht, die Zwangsmechanismen von Geschlecht und geschlechtsspezifische Regulierungen in den verschiedensten Räumen abzuschaffen. Eric A. Stanley formuliert das auf ähnliche Weise in einem Artikel für die Zeitschrift Transgender Studies Quarterly: »Die Selbstbestimmung des Geschlechts ist emotional mit Praktiken und Theorien der Selbstbestimmung verbunden, wie sie von verschiedenen bis heute aktiven antikolonialen, Black-Power- und Anti-Gefängnis-Bewegungen verkörpert wurden und werden«.7 Es wäre also ein Fehler, die Selbstbestimmung des Geschlechts von anderen Arten des Kampfes für die Abschaffung von Geschlecht oder für die Befreiung queerer Menschen (begrifflich) zu unterscheiden. Die Selbstbestimmung des Geschlechts so zu interpretieren, als könne jeder sein Geschlecht »frei wählen« und es dann dem Staat zur Anerkennung »übermitteln«, entkräftet nicht nur den emanzipatorischen Ursprung dieser Idee (mit dem ich mehr oder weniger einverstanden bin), sondern verortet sie auch in einem rein kapitalistischen und neoliberalen Rahmen, der solcherlei Definitionen von Individuum und Freiheit ermöglicht.
Forderungen der Trans-Bewegung waren ursprünglich eher mit Ideen wie der Entpathologisierung verbunden als mit diesem Begriff der Selbstbestimmung des Geschlechts, das von Dean Spade und anderen Denkern entwickelt wurde. Forderungen nach Entpathologisierung sind beispielsweise im Rahmen der Kampagne Stop Trans Pathologization seit 2012 und (laut Miquel Missé) einer Reihe von trans Aktivisten zu finden, die sich dem französischen Vorbild Existrans folgend seit 2007 in Barcelona und anderen Städten mobilisieren. Der juristische Begriff der »Selbstbestimmung des Geschlechts«, der die Anerkennung der frei zum Ausdruck gebrachten Geschlechtsidentität ausdrückt, bedeutet weniger die Annahme der radikalen Freiheit des Individuums, zu wählen, wer es ist. Er ist vielmehr ein Instrument zur Entpathologisierung von trans Existenzen, was beinhaltet, dass medizinische und psychiatrische Kontrollverfahren im Rahmen der Anerkennung von trans Menschen abgeschafft werden. Es wäre sicherlich interessant, zu untersuchen, woher die hier angeführten Freiheitsbegriffe kommen, die weit über ein an die kapitalistische Struktur gebundenes Denken hinausreichen: Man müsste dann über scholastische Begriffe wie dem iudicium de agendis, der electio, dem iudicium practicum nachdenken oder über die Gleichsetzung von Willensfreiheit und Willen ebenso wie über die Debatten zwischen Thomas von Aquin und franziskanischen Theologen wie Walter von Brügge. Letztlich gelangt man durch die Untersuchung eines jeden Freiheitsbegriffs zu dessen Ursprüngen im Mittelalter und zu Debatten, in denen Religion fast immer eine bedeutsame Rolle zukommt. Um ein wenig schneller voranzuschreiten, möchte ich es bei der folgenden Formulierung belassen, die ich später wiederholen werde: Das Subjekt hat die Freiheit, zu erkennen – auch wenn das vermutlich eher die Ausnahme ist –, was dazu geführt hat, dass es so ist, wie es ist. Für das Subjekt ist das Erkennen dieser Bestimmungen der Ausdruck seiner frei ausgedrückten Geschlechtsidentität. Die Gültigkeit dieses Ausdrucks zuzugestehen und anzuerkennen bedeutet keinesfalls, davon auszugehen, dass das Subjekt frei zwischen verschiedenen Optionen wählen kann.
Wie der juristische Blog Queerídico in einer Analyse des Verhältnisses von Menschenrechten und spanischer Trans-Gesetzgebung aufzeigt, ist eine der Grundlagen des spanischen Gesetzes das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) im Fall A. P., Garçon und Nicot gegen Frankreich vom 6. April 2017 (das zugleich dazu dienen mag, die Implementierung der Selbstbestimmung des Geschlechts in der europäischen Gesetzgebung zu begründen): Ausgehend davon, dass die französische Gesetzgebung für die Änderung des Geschlechtseintrags in den Personenstandsdaten eine (geschlechtsangleichende) Operation oder eine (hormonelle) Behandlung voraussetzt, vertrat der EGMR die Auffassung: »Die Anerkennung der sexuellen Identität von Transgendern der Bedingung der Vornahme einer sterilisierenden – oder sehr wahrscheinlich einen solchen Effekt hervorrufenden – Operation oder Behandlung zu unterwerfen, der sie sich nicht unterwerfen wollen, läuft daher darauf hinaus, die vollständige Ausübung ihres Rechts auf Achtung ihres Privatlebens nach Art. 8 EMRK [Europäische Menschenrechtskonvention, Anm. d. Ü.] davon abhängig zu machen, dass sie auf die vollständige Ausübung ihres Rechts auf Achtung ihrer physischen Integrität verzichten, die nicht nur von dieser Konventionsbestimmung garantiert wird, sondern auch von Art. 3 EMRK [Verbot von Folter, Anm. d. Ü.].«8
Diese Schlussfolgerungen wurden im Urteil des Falls X und Y gegen Rumänien vom 19. Januar 2021 bekräftigt. Und auch das Hohe Kommissariat der Vereinten Nationen für Menschenrechte spricht sich in einer Broschüre zu »best practices« aus dem Jahr 2016 dafür aus, die rechtliche Anerkennung der Geschlechtsidentität von trans Menschen in amtlichen Dokumenten solle »ein einfacher Verwaltungsprozess sein«, »auf der Selbstbestimmung des Antragstellenden beruhen«, »Antragstellenden weder medizinische Zertifikate noch Operationen, Sterilisierung oder Scheidung abverlangen«, »non-binäre Identitäten anerkennen« und »Minderjährigen die Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität ermöglichen«.9
Kurzum, Spanien ist dazu angehalten, auf rechtlicher Ebene dafür zu sorgen, dass die Änderung der Geschlechtsangabe in den Personenstandsdaten nicht an Operationen oder medizinische Behandlung geknüpft wird. An eine psychologische Diagnose könnte sie indes weiter geknüpft werden, da es sich dabei nicht unbedingt um eine Verletzung der Menschenrechte handelt. Sowohl der Unabhängige Experte zum Schutz vor Diskriminierung und Gewalt aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität der Vereinten Nationen als auch, wie bereits erwähnt, das Hohe Kommissariat der Vereinten Nationen für Menschenrechte raten jedoch von solch einer Diagnose ab. Und auch die Parlamentarische Versammlung des Europarates fordert ihre Mitgliedstaaten in Resolution 2048 (Discrimination against transgender people in Europe, 2015) auf, »für die Namens- und Geschlechtsänderung von trans Menschen in Geburtsurkunden, Personalausweisen, Reisepässen, Zeugnissen und anderen ähnlichen Dokumenten schnelle, transparente und zugängliche Verfahren auf der Grundlage der Selbstbestimmung zu entwickeln […]; Sterilisierung und andere verpflichtende medizinische Behandlungen sowie die Diagnose psychischer Gesundheit als notwendige rechtliche Voraussetzung für die Anerkennung der Geschlechtsidentität aus den Gesetzen, die das Verfahren der Namens- und Geschlechtsänderung in den Personenstandsdaten regeln, zu streichen; […] für diejenigen, die dies wünschen, die Aufnahme eines dritten Geschlechts in Ausweisdokumenten in Betracht zu ziehen«.10
Häufiger hört man die Behauptung, dass die Entpathologisierung von trans Menschen durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO), auf die man sich berufe, um die rechtlichen Verfahren bei trans Menschen so rücksichtsvoll wie möglich zu gestalten, keine wirkliche Grundlage habe, da Transsexualität nach wie vor in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandten Gesundheitsprobleme, in der ICD-11, auftauche. Diese Argumentation ist deshalb falsch, weil sie von der Behauptung ausgeht, dass aus der Aufnahme von trans in die ICD-11 notwendigerweise eine Einstufung als psychische Störung folge. Psychische Störungen, Verhaltensstörungen und neuronale Entwicklungsstörungen werden aber im sechsten Kapitel der ICD-11 aufgeführt, »Genderinkongruenz« ist hingegen Teil des 17. Kapitels, in dem es um Zustände mit Bezug zur sexuellen Gesundheit geht, die getrennt von beispielsweise den paraphilen Störungen aufgeführt werden. Bei der Beschreibung der Genderinkongruenz ist kein einziges pathologisierendes Kriterium zu finden. Ja, es wird sogar spezifiziert, dass eine Genderinkongruenz nicht vorliege, wenn lediglich Verhaltensweisen beobachtet würden, die von der erwarteten Geschlechterrolle abweichen (womit auf weitere Bedenken reagiert wird, auf die Behauptung, die »Trans-Lobby« verfolge die Agenda, aus jedem Mädchen mit männlichem Verhalten einen Jungen zu machen und umgekehrt). Die Aufnahme der Genderinkongruenz in die ICD-11 entspringt auch einer Notwendigkeit: Es geht vor allem darum, die medizinische und psychologische Behandlung für diejenigen trans Menschen sicherzustellen, die sich eine solche Behandlung wünschen – was bedeutet, dass es einen Eintrag in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten geben muss –, ohne ihnen eine Diagnose aufzuerlegen, die sie in irgendeiner Weise als gestört einstuft.
Die menschenrechtlichen Grundlagen für die Verabschiedung eines Gesetzes, das die Namens- und Geschlechtsänderung in den Personenstandsdaten vereinfacht, habe ich bereits untersucht. Aber was ist mit einem möglichen Rechtsmissbrauch?
Ich bin davon überzeugt, dass die Verabschiedung eines Gesetzes, das solche Verfahren für trans Menschen erleichtert, keine Flut von Männern hervorrufen wird, die ihren Geschlechtseintrag ändern lassen wollen. In keinem der Länder, in denen solche Gesetze bereits erlassen wurden, ist so etwas passiert. Wenn Schreckensgeschichten dieser Art als Argumente benutzt werden, ist das eine Verdrehung der Realität, und ihre Verfechter kommen nicht umhin, sich dabei auf ihnen ferne und schlicht verzerrende Erfahrungsberichte zu berufen. Es ist schwer vorstellbar, dass die Antragsstellung auf Personenstandsänderung und die darauffolgende Wartezeit auf das Mahlen der bürokratischen Mühlen und eine anschließende Modifizierung des Geschlechtseintrags potenziellen Aggressoren die Mühe wert ist.
Wir müssen diese Angst, die deswegen nicht aufhört, legitim und verständlich zu sein, als irrationalen Ausdruck von Misstrauen begreifen. Werden sich hunderte Männer in öffentliche Toiletten für Frauen schmuggeln? Die Antwort darauf dürfte mit folgender Erläuterung wohl mehr als klar sein: Viele Butches (männliche Frauen, um es auf die einfachste Weise zu sagen, obwohl das nicht die genaue Definition ist) mit »weiblichen Geschlechtsorganen« und einer Sexualentwicklung, die mehr oder minder dem entspricht, was die trans-ausschließende Reaktion »biologische Frauen« (beziehungsweise »echte [sic, E. D.] Frauen«) nennt, haben auf öffentlichen Toiletten Erfahrungen mit Belästigungen oder Gewalt gemacht, eben weil sie nicht den Geschlechterstereotypen angepasst waren – und ihre Genitalität oder ihre Sexualentwicklung haben dabei absolut keine Rolle gespielt. Geschlechtsspezifische Regulierungen an Orten wie öffentlichen Toiletten funktionieren, wie ich in späteren Kapiteln dieses Essays darlegen werde, über Wahrnehmungen und Blicke. Und Wahrnehmungsweisen und Blicke, beides zutiefst sozial und kulturell verankert, können von keinem Gesetz auch nur annähernd geändert werden. Es gibt Vorschläge, vor einer Änderung in den Personenstandsdaten eine Bedenkzeit von mehreren Monaten einzuführen. Eine solche Zeitspanne verstieße allerdings wohl gegen die Empfehlung eines schnellen, möglichst nicht übergriffigen Verfahrens. Ich habe es bereits bei anderen Gelegenheiten gesagt: Besonnene juristische und theoretische Debatten kann und sollte man immer führen, aber Wahrheit und Lüge lassen sich niemals miteinander versöhnen.
An einigen Stellen dieses Essays behaupte ich, dass mir die hier behandelten Themen nicht so wichtig seien: Heute würde ich sagen, dass ich mir selbst etwas vorgemacht habe, als ich das schrieb. Ich spreche in diesem Text auch – glücklicher- oder unglücklicherweise – über mein Leben, obwohl die für die theoretische Arbeit notwendige Abstraktion eine Distanzierung zu meinem Leben mit sich bringt. Ich schreibe aus einer außerordentlich privilegierten Position, aber ich versuche immer, diese Position, die es mir heute erlaubt, meine Zeit dem Schreiben zu widmen, zu nutzen, damit Letzteres sich im Rahmen der Möglichkeiten positiv auf jene auswirkt, die sich in schwierigeren Situation befinden als ich. An mehreren Stellen des Essays klinge ich sehr hart, aber ich habe nie gezögert, noch einmal über trans zu sprechen – obwohl es mir davor graut, zum Token, zur Symbolfigur von Zwangsinklusion gemacht oder auf meine Andersartigkeit reduziert zu werden –, wenn ich glaubte, dass das notwendig sei. Angesichts dessen, was momentan auf der Welt und in verschiedenen miteinander verflochtenen Kämpfen passiert, scheint mir die Möglichkeit, außerhalb Spaniens über trans zu sprechen, eine dieser Gelegenheiten zu sein, Notwendiges zu äußern. Glücklicher- oder unglücklicherweise gibt es noch viele Dinge, die gesagt, und viele Lügen, die aufgedeckt werden müssen. Ich hoffe, dass all diese Worte letzten Endes nützlich sind, dass sie provozieren, Türen öffnen und für ein wenig Licht sorgen.
Elizabeth Duval, Oaxaca, 27. Oktober 2022
Prolegomena Die Schnauze voll von trans
Ich bin nicht nur richtig wütend, nein: Ich hab die Schnauze voll von trans. Erklärender Vermerk: Ich habe mich zu-rück-ge-zo-gen, ich gehe in den Ruhestand, ich will Rente oder zumindest irgendeine kleine Vergütung für meine Dienste an unserem postmodern-queeren Heimatland. Mir reicht's, ich hab genug: Ich war mit vierzehn zur Hauptsendezeit im Fernsehen, um darüber zu reden, wie es ist, trans zu sein, ich war als Jugendliche auf den Titelseiten der Kultur- und Modebeilagen, ich habe Interviews gegeben oder bin als Diskussionsteilnehmerin aufgetreten, als katholische Rechtsextreme einen Bus mit der Aufschrift »Jungs haben einen Penis, Mädchen eine Vulva. Lass dich nicht täuschen« durch die Gegend fahren ließen, und dann die Fotokampagnen, ich hab genug von Kundgebungen, Verbänden und Organisationen – und von Twitter, ja, vor allem von Twitter: Ich habe keine Lust mehr auf dieses Aktivisten- oder LGBTI-Getwitter. Es reicht, das war's. Der nächsten Person, die darauf besteht, dass die Autorin dieser Seiten die bekannte und unverschämt junge »TRANS-AKTIVISTIN« Elizabeth Duval ist, werde ich nicht ins Gesicht sehen können – auch wenn ich's wirklich gerne würde! Wie soll ich denn eine Aktivistin sein, wo ich doch gar nichts mache! Mir wurde mal gesagt, dass man mich wenn überhaupt Trans-Passivistin nennen müsse und dass, wer mich als Trans-Aktivistin bezeichne oder das, was ich mache, von trans bestimmt sehe, keinen blassen Schimmer habe: Wie wahr! Was habe ich (in letzter Zeit) getan, um als Trans-Aktivistin bezeichnet zu werden? Mit welchem Aspekt von trans habe ich mich denn besonders beschäftigt? Gibt es Trans-Aktivismus? Existiere ich in meinem Alltag als trans Person? Bin ich schon Aktivistin, nur weil es mich gibt? Ist Ana Botín, Aufsichtsratsvorsitzende der größten spanischen Bank, eine militante Feministin, weil sie eine Frau und ab und an im Fernsehen ist? Ich schwöre hoch und heilig, viel mehr als das mache ich auch nicht, ehrlich, als trans Mensch bin ich wirklich nicht interessant, meine Erfahrungen sind nicht sonderlich von Belang, ich leide selten auf der Straße, ich befinde mich in einer sehr privilegierten Position. Ich rette niemandem das Leben, ich schreibe nicht über trans, ich beschäftige mich nicht besonders ausgiebig mit Gender, ich bin keine Gender-Theoretikerin oder möchte Paul B. Preciado von seinem Thron stoßen. Und ich habe auch nicht vor, mir einen Kurzhaarschnitt wie den von Judith Butler zuzulegen, finito, arrête ça, beruhigen Sie sich!
Liebe Leser, es ist nicht meine Absicht, meinem Ego einen Altar zu errichten, trotzdem möchte ich kurz darüber sprechen, wie über mich gesprochen wird: »Duval, lesbisch, trans, Aktivistin, Performerin und noch 200 andere Dinge, ist eine frühreife Seele.« »Wenn man Elizabeth Duval googelt, werden einem Begriffe wie ›trans‹ oder ›lesbisch‹ vorgeschlagen, ›Etiketten‹, von denen sie selbst denkt, dass sie ›überflüssig sein sollten‹.« »Twitternde Trans-Aktivistin und Marxistin …« »Die junge Trans-Autorin stellt uns ihren Debütroman Reina vor.« Nun ja, gut, hier wird gesagt, dass es mich gibt, dass ich trans und andere Dinge bin, aber mehr trans als das andere (zumindest laut einiger der Beschreibungen). Dass ich lesbisch, Aktivistin (das glaube ich schon weniger), Marxistin (da bin ich mir ebenfalls nicht so sicher, ich würde fast sagen: »Marxianerin« oder gar nichts), Performerin (das sind heutzutage alle, lassen Sie mich also damit in Ruhe, ich performe auch nicht mehr als Christen, die in den Gottesdienst gehen!), dass ich unverschämt jung und, ach ja, trans bin.
Ich habe mir viele Gedanken über jedes einzelne Kapitel dieses Buches gemacht. Ich wollte eigentlich einen anderen Text schreiben als den, den Sie nun in den Händen halten. Vielleicht nicht nur einen anderen, sondern viele andere, die jetzt möglicherweise für immer verloren sind – Züge, die ich für immer verpasst habe! Nun gut: Hier haben Sie Nach Trans. Sex, Gender und die Linke. Sie werden sehen, dass es kein autofiktionales Buch ist. Auf den folgenden Seiten gibt es Randbemerkungen, Notizen, theoretische Auseinandersetzungen – und jede Menge kochende Wut. Denn sogar während ich schreibe, bin ich noch stinksauer!
Aber ich will mich mäßigen: Ich glaube, dass ich schreibe, weil ich nie biologische Mutter sein werde. In Camila Sosa Villadas El Viaje inútil heißt es: »Der Wunsch zu schreiben kommt zu mir und zeigt mir, dass ich fruchtbar bin, dass ich ein Weibchen bin, fähig, etwas auszubrüten. Er legt seine Eier, und ich trage ihn in mir wie eine Mutter.«11Ich bin – ebenso wenig wie Sosa Villada – ein Weibchen, das dazu fähig ist, etwas auszubrüten (bin ich überhaupt ein Weibchen?), noch ist es mir möglich, etwas zu befruchten, wie es der Wunsch tut (und dann?). Ich gehöre zu keiner dieser beiden Kategorien und befinde mich auch nicht im Übergang von der einen zur anderen. Ich bewohne die Auflösung. Die Hormonbehandlung hat mich unfruchtbar gemacht, und ich habe nirgends mehr haploide Geschlechtszellen, mit denen eine künstliche Befruchtung möglich wäre. In Ermangelung technologischer Entwicklungen und weil eine Cyberpunk-Welt so nah nun auch nicht ist, wird mir Mutterschaft fremd bleiben; also schreibe ich.
Und ich tröste mich, indem ich mir sage, dass Platon das Schreiben zumindest nicht verurteilt, frage mich aber, ob er Mutterschaft verurteilt. Bei Platon sind Denken und Gespräch fast ein und dasselbe: Denken ist ein innerer Monolog, der auseinanderfällt, ein Dialog, bei dem die Spaltung des Sprechenden zwei autonome und absolute Subjekte hervorbringt. Schreiben ist der Widerschein dieses inneren dialogischen Prozesses. Diesen Dialog in die Welt zu projizieren ist kein Symptom eines Willens, zu indoktrinieren, sondern Ausdruck der Hoffnung, im anderen die Möglichkeit eines Prozesses zu wecken, eines Forschergeistes oder den Wunsch zu verstehen: Die Logik des gesamten platonischen Werkes lässt sich in den Prozessen finden, mittels derer wir die Dinge begreifen.
Weder das Lob des Dialogs noch das Lob eines Gegenübers sind unvereinbar mit Wut. Aber das ist ein heikles Thema: Obwohl ich einige der wichtigsten Beiträge des Differenzfeminismus und Denkerinnen wie Luce Irigaray oder Hélène Cixous schätze, ist mir klar, dass Wut oder Tonfall mir schnell übel mitspielen können. Meine Leser könnten sich angesichts dessen, was sie für eine übermäßig vehemente Aufforderung zur Stellungnahme halten mögen, gekränkt fühlen. Meine Gesprächspartner könnten denken, dass ich meiner Wut mit persönlichen Rachefeldzügen freien Lauf lasse. Und die akademische Welt könnte der Meinung sein, dass ich nicht weniger als an den Fundamenten des essayistischen oder philosophischen Schreibens rüttele, ja sie pervertiere. Schreiben ist eine Frage des Tonfalls, aber darüber hinaus auch eine des Status, und ich kann mir noch nicht alles oder jede Art der Heftigkeit erlauben. Aber darf ich vehement sein, wenn ich sichergehen möchte, dass mein Text nicht in der Schublade »weibliches Schreiben« oder »queere Literatur« landet, deklassiert als zweitrangige Literatur? Kann ich sicher sein, dass ich – weil ich klar und verständlich sein möchte, weil ich nicht alle Konzepte als bekannt voraussetze, weil ich keinen hermetischen Jargon benutze oder sinnloses Wortgeklingel produziere (und ich meine hier wohlgemerkt nicht eine notwendige Fachsprache) – in der akademischen Welt, in der Welt der Theorie trotzdem beachtet werde? Kann ich denn umgekehrt erwarten, dass die gewöhnlichen Leser irgendein Interesse an diesem Text haben werden? Für wen schreibe ich, und warum überhaupt auf diese Weise schreiben, wo ich doch meinen Körper nicht für einen Text oder meine Möglichkeit zu schreiben, mein weibliches Sprechen, nicht für einen Kosmos halte, dessen Realität auf dem Körper oder den Organen beruht?
In Das Lachen der Medusa schreibt Hélène Cixous:
Wenn die Frau immer »innerhalb« des Männerdiskurses funktioniert hat, als Signifikant der immer auf den ihm entgegengesetzten Signifikanten bezogen blieb, was seine besondere Energie aufgehoben, seine so andersartigen Klänge unterdrückt oder erstickt hat, dann ist es Zeit, daß die Frau dieses »Innerhalb« auseinanderbricht, es zum Bersten bringt, es umdreht und sich seiner bemächtigt. Daß sie es sich zu eigen macht, indem sie es verstehend in sich aufnimmt, es in ihren eigenen Mund nimmt, ihm mit ihren eigenen Zähnen auf die Zunge und Sprache beißt, daß sie eine Sprache erfindet um mit ihm zusammenzustoßen. Und mit wieviel Leichtigkeit, Du wirst sehen, kann sie aus diesem »Innerhalb« in das sie schläfrig eingebettet war, auf und über die Lippen kommen die übergehen werden von ihrem Schäumen.12
Ein weiblicher Text kann gar nicht nicht weit mehr als subversiv sein: wenn er sich schreibt, dann indem er vulkanisch die alte unbewegliche Immobilienkruste auf- und anhebt.13
Es ist unerläßlich, daß sie sich schreibt, weil das Erfinden einer neuen, aufrührerischen Schrift es ist, was es ihr erlauben wird, wenn der Moment ihrer Befreiung gekommen ist, die erforderlichen Durchbrüche und Umgestaltungen in ihrer Geschichte vorzunehmen[.]14
Ich möchte an dieser Stelle Wut und Zorn aus den gleichen Gründen verteidigen, aus denen die Männer im Griechenland des Aristoteles (jenem Herrn der großen Vernunft, des geradlinigen Urteils und der goldenen Mitte) den Frauen misstrauten und ihnen Intrigen und Verschwörungen unterstellten, um sie kleinzuhalten: Sie hatten Angst vor uns! Wenn die Vernunft und die Besonnenheit historisch gesehen von den Männern monopolisiert wurden, glaube ich nicht, dass es die Lösung für uns Schriftstellerinnen wäre, unbedingt diese Position von Vernunft und Besonnenheit einnehmen zu wollen, gerade so, als ob wir unterwegs aufgehört hätten, Subalterne zu sein. Wenn etwas getan werden muss, dann dies: Form und Inhalt der (männlichen) Vernunft, die sich als die einzig mögliche gibt, aufzubrechen: »Aufhören, wie die Jungs zu schreiben: mit diesen verlogen neutralen Stimmen«, wie die baskische Autorin Aixa de la Cruz es ausdrückt. Die männliche Hochstapelei muss aufgegeben werden: Wir sollten Essays auf eine andere, rigorose Weise schreiben!
Ich glaube nicht, dass jeder von einer Frau geschriebene Roman von sexueller Gewalt oder von #MeToo handeln oder immer von Alltagserfahrungen auf Allgemeingültiges schließen muss, damit wir »aufhören, wie die Jungs zu schreiben«. Und ich glaube noch weniger, dass jeder Gedichtband, in dem nach einer weiblichen Sprache oder einem weiblichen Schreiben gesucht wird, von körperlichen Erfahrungen, von Innerlichkeit und dem Persönlichsten ausgehen oder sich von dem lossagen muss, was als symbolische Vorstellungswelt der Männer gilt. Solche Naturalisierungen lehne ich ab. Ich lehne sogar die Ansicht ab, dass ein weiblicher Text gar nicht anders als subversiv sein kann. Aber ich bediene mich solcher Zuschreibungen auch zu meinen Gunsten, ganz so, wie es mir gefällt, und ich betrüge meine Vorgängerinnen, indem ich ihre Begriffe verwende, wie ich Lust habe. Das ist ein Weg, Sie ahnen es schon, um jedwede Art der Einflussangst zu überwinden. Und wenngleich ich Cixous' Aussage hier ablehne, bekräftige ich meine Position noch einmal mit anderen Worten von ihr, zum Beispiel mit diesen widersprüchlichen und außergewöhnlichen:
Unmöglich eine weibliche Art des Schreibens zu definieren, das ist von einer Unmöglichkeit die weiterbestehen wird, denn man wird diese Schreibart nie theorisieren, umgrenzen, kodieren können, was nicht bedeutet, daß es sie nicht gibt. Aber sie wird immer über den, vom phallozentrischen System bestimmten Diskurs hinausführen. Sie findet anderswo statt und wird anderswo stattfinden als in jenen Gebieten die der philosophisch-theoretischen Herrschaft untergeordnet sind.15
Seien wir jähzornig. (Ich möchte an die ersten Worte dieses Essays erinnern: Ich habe »die Schnauze voll von trans«, vergessen Sie das nicht.) Schreiben wir ausgehend vom, wegen und für den militärischen Anklang des Wortes, so wie Virginia Woolf in Das Mal an der Wand. Diejenigen, die Romane schreiben (oder Essays und alles, was die Gattungen, Genera, Genre noch hergeben, und nicht nur die literarischen!), werden künftig immer mehr die Bedeutung der Spiegelungen wahrnehmen, wobei sie die Beschreibung von Wirklichkeit immer mehr aus ihren Erzählungen herauslassen werden.16 »Der militärische Anklang des Wortes« wird genügen. Die wirksamste Gewalt, die wir ausüben können, und der beste Weg, um die großen Schriften und das kanonische männliche Schreiben zu beleidigen, wird in diesem »militärischen Anklang des Wortes« liegen. Und das impliziert notwendigerweise Vehemenz. Dies ist ein Essay über Notwendigkeiten, Zufälligkeiten, Definitionsfehler, über fremden und eigenen Unsinn … und über ein weitverbreitetes Gefühl, die Schnauze voll zu haben.
Mithilfe des Geschriebenen und Gesagten den Wunsch des anderen nähren, selbst zu schreiben und zu sprechen. Ein Zeichensystem aufzeigen, eine Sprache, die »keine Entität« ist und »nur in den sprechenden Subjekten [existiert].«17 Liebe Leser, seien Sie hier und jetzt meine Gesprächspartner, meine sprechenden Subjekte: Ich schreibe Bücher, die zu Gräbern jüngerer Bäume werden (arbor, arbre, die Arbitrarität des Zeichens). Und ich bin mir des Unterschieds bewusst. In neun Monaten werde ich keine Mutter sein. Ich werde Autorin sein. Beide, Mütter und Autorinnen, haben etwas Zärtliches, eine Autorin zu sein erfordert Beredsamkeit und Anerkennung. Eine Autorin zwingt sich der Welt auf, zwingt ihren Wunsch der Welt auf. Bei der Mutterschaft ist es der Wunsch (und der kommt woher?), der sich aufzwingt.
Ich möchte den Lesern dieses Textes keinerlei Wahrheit aufzwingen. Ich möchte nicht, dass Sie denken, dass ich Ihnen überlegen bin, weil ich bestimmte Autoren gelesen und über gewisse Themen nachgedacht habe. Ich stehe auf keinem Sockel: Ich möchte einen Dialog eröffnen und Möglichkeiten aufzeigen. Und ich glaube, dass jeder an diesem Dialog teilnehmen und das Wort ergreifen kann. In diesem Buch geht es um trans, ja, aber es richtet sich nicht an ein trans Publikum, und es gibt auch keinen Grund, warum es das tun sollte. Dieser Essay wird nicht mehrheitlich von trans Menschen gelesen werden, das weiß ich im Voraus. Ich bin nicht einmal so sicher (Achtung, ein Tipp: Mit das Wichtigste, was ich zu sagen habe, ist hier angedeutet), ob dieses als »trans Menschen« bezeichnete Kollektiv überhaupt als stimmige Kategorie existiert. Und das macht es viel schwieriger, dieses Buch zu schreiben.
Wie entkommt man dem Sich-Verschließen, dem unvermeidlichen Jargon, den akademischen Ausdrücken? Wie kriegt man es hin, eine kohärente Theorie von Geschlecht zu entwerfen und gleichzeitig sicherzustellen, dass genug von ihr nicht nur ein Fachpublikum erreicht, sondern darüber hinaus Debatten anregt?
Ich weiß, dass ich damit scheitern werde, aber wir müssen uns das Scheitern auch erlauben. Die umso radikalere Formulierung einer Idee führt nicht per se dazu, dass die Idee selbst radikal ist. Ich bin der Ansicht, dass Ideen ein gewisses Gewicht haben und dass jede Idee notwendige, unverrückbare Eigenschaften mit sich bringt. Die virtuoseste Idee kann alles Gewicht der Welt für ihren Träger bedeuten, aber dieses Gewicht (dessen du dich nicht annimmst) ist nutzlos, wenn es niemanden erreicht. Wenn eine Idee an ihren Wirkungen gemessen wird, dann ist das eine Verkehrung des Kantischen. Diese Prolegomena sollen sich nicht ausschließlich an künftige Lehrer richten, sind nicht einzig als Werkzeug für die Konzipierung einer Wissenschaft gedacht: Ein Text sollte die Möglichkeit einer radikal anderen Perspektive auf die Welt eröffnen. Es geht nicht um Popularisierung, sondern um Transparenz. Nein zum Nebel, ja zum Kristall. Ich möchte Sie dazu ermuntern, Ihren Horizont zu erweitern und das gesamte Gebiet dieses Textes zu erkunden.
Lassen Sie mich kurz auf Struktur und Aufbau des Buches eingehen, bevor ich die einzelnen Kapitel inhaltlich zusammenfasse. Einige der Kapitel sind ausführliche Reflexionen und theoretische Exkurse, die die Texte anderer Leute als Ausgangspunkt nehmen und somit eine Art Antwort auf die von anderen aufgeworfenen Debatten und Fragen bilden. Die Debatten und Fragen nutze ich als Sprungbrett, um dann meine eigenen Thesen im letzten Kapitel zu bündeln und in einen Zusammenhang zu bringen. In jedem einzelnen dieser Kapitel wird mehrmals auf einige der wichtigsten Fragestellungen des gesamten Buches rekurriert. So haben die Leser die Möglichkeit, jedes der Kapitel unabhängig voneinander zu lesen oder als Ensemble von eigenständigen Gefügen zu betrachten, die gleichwohl miteinander verbunden sind und eine Einheit bilden. In anderen Kapiteln entwickele ich Konzepte und Überlegungen unabhängiger von den Texten Dritter, obwohl ich hier notwendigerweise ebenfalls die Werke anderer einbeziehen muss, damit meine eigenen Reflexionen als Teil eines Dialogs fungieren können. Diese Kapitel umfassen freiere und in Unterabschnitte gegliederte Untersuchungen. Sie beschäftigen sich mit Themen wie der Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht, dem Begriff der Gender-Technologie bei Teresa de Lauretis, Aktualisierungen und Kritik der lacanschen Psychoanalyse oder dem Erbe der Phänomenologie in einer zeitgemäßen Geschlechter-Konzeption.
Im ersten Kapitel – Erwerb und Selbstbestimmung des Geschlechts: Haben versus Sein – skizziere ich ausgehend von Joanne Meyerowitz' Überlegungen eine sehr kurze Genealogie wissenschaftlicher Erklärungen aus den USA und Europa, insbesondere zu Beginn der zwanziger Jahre, für die Existenz von trans Menschen. Diese Einschätzungen verknüpfe ich mit der Gegenwart (wobei ich mich vor allem auf Miquel Missés Kritiken dieser Positionen beziehe und auf Möglichkeiten, den Geschlechtserwerb neu zu denken) und schließe einige kritische Bemerkungen zum voluntaristischen Diskurs an, der nicht ganz uneigennützig eine vermeintliche Selbstbestimmung des Geschlechts behauptet. Mein Kommentar stützt sich zum einen auf Ideen der lacanschen Psychoanalyse und zum anderen auf die Konstruktion des Subjekts, wie sie beispielsweise bei Judith Butler zu finden ist. Das zentrale Anliegen dieses ersten Kapitels besteht darin, eine kohärente Erklärung für den Sozialisationsprozess im Hinblick auf Geschlecht beziehungsweise für den Erwerb der Geschlechterdifferenz bei trans Menschen zu bieten.
Im zweiten Kapitel – Trans, Identitätspolitik und die Linke – gebe ich eine Antwort auf die Frage, ob es angebracht ist oder nicht, über einen Begriff zu debattieren, der so eng mit dem Leben einiger Menschen verknüpft ist. Ich widme mich hier sowohl der Argumentation derjenigen, die auf einer Art conditio trans