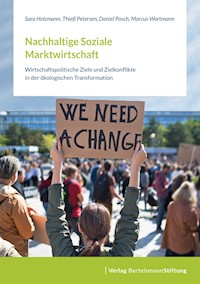
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Bertelsmann Stiftung
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Eindämmung der Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit, ökologische Nachhaltigkeit die Voraussetzung für Lebensqualität und Wohlstand künftiger Generationen. Der Weg zu einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft ist allerdings gekennzeichnet von komplexen wirtschaftspolitischen Fragestellungen und Zielkonflikten. Um materiellen Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit gleichzeitig sichern zu können, bedarf es einer klug austarierten Wirtschaftspolitik mit einem zeitgemäßen und praxistauglichen Zielsystem. Unsere Publikation definiert sieben Zieldimensionen einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft und analysiert deren jeweilige Wechselwirkungen mit dem zentralen Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit. Anhand aktueller empirischer Erkenntnisse und mithilfe ökonomischer Theorie zeigen wir, wo Konflikte bestehen und wo Ziele im Einklang miteinander sind. Mit Blick auf die wirtschaftspolitische Steuerung der Transformation benennt das Buch zentrale Stellhebel, um Zielkonflikten vorzubeugen und sie aufzulösen sowie Synergiepotenziale freizusetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sara Holzmann, Thieß Petersen, Daniel Posch, Marcus Wortmann
Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft
Wirtschaftspolitische Ziele und Zielkonflikte in der ökologischen Transformation
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2022 Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
Verantwortlich: Sara Holzmann, Marcus Wortmann
Lektorat: Heike Herrberg
Herstellung: Christiane Raffel
Umschlaggestaltung: Elisabeth Menke
Bildnachweis: Halfpoint – stock.adobe.com (Cover), S. 182 oben, S. 183 oben Ansichtssache_Britta Schröder, S. 182 unten Steffen Krinke, S. 183 unten Kai Uwe Oesterhellweg
Satz: Büro für Grafische Gestaltung – Kerstin Schröder, Bielefeld
Druck: Hans Gieselmann Druck und Medienhaus GmbH & Co. KG, Bielefeld
ISBN 978-3-86793-961-4 (Print)
ISBN 978-3-86793-962-1 (E-Book PDF)
ISBN 978-3-86793-963-8 (E-Book EPUB)
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
Inhalt
1Einführung
2Die Soziale Marktwirtschaft: Das »Magische Viereck« hat ausgedient
3Die wirtschaftspolitischen Ziele einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft
3.1Ökologische Nachhaltigkeit
3.2Hoher materieller Wohlstand
3.3Hoher Beschäftigungsstand
3.4Stabiles Preisniveau
3.5Außenwirtschaftliches Gleichgewicht
3.6Faire Einkommensverteilung
3.7Tragfähige Staatsfinanzen
4Ausgewählte Zielkonflikte einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft
4.1Ökologische Nachhaltigkeit und hoher materieller Wohlstand
4.2Ökologische Nachhaltigkeit und hoher Beschäftigungsstand
4.3Ökologische Nachhaltigkeit und stabiles Preisniveau
4.4Ökologische Nachhaltigkeit und außenwirtschaftliches Gleichgewicht
4.5Ökologische Nachhaltigkeit und faire Einkommensverteilung
4.6Ökologische Nachhaltigkeit und tragfähige Staatsfinanzen
5Transformation zur Nachhaltigkeit – eine ganzheitliche Perspektive für die Wirtschaftspolitik
Projektbeschreibung
Autor:innen
Zusammenfassung
Abstract
1Einführung
»Wohlstand für Alle« ist nicht nur der Titel eines Ende der 1950er-Jahre veröffentlichten Buches, sondern auch das zentrale Versprechen der Wirtschaftsordnung, welche die Bundesrepublik Deutschland seitdem stark geprägt hat. Dieser Losung entsprechend soll die Soziale Marktwirtschaft wirtschaftliche Dynamik mit sozialem Ausgleich kombinieren. Die konkrete Ausgestaltung dieses normativen Fundaments muss allerdings – so argumentierten bereits jene, die dieses Leitbild entwarfen – ständig an aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen angepasst werden. Denn als lebende Systeme befinden sich Wirtschaft und Gesellschaft in einem stetigen Wandel. Von dieser Anpassungsfähigkeit hängt ab, ob und wie es auch in Zukunft gelingt, Lebensqualität und Teilhabechancen möglichst vieler Menschen sicherzustellen.
Die größte Herausforderung unserer Zeit ist zweifellos die Eindämmung der Klimakrise. Damit steht und fällt nicht nur der Wohlstand heutiger, sondern auch die Lebensgrundlage künftiger Generationen. Die Transformation hin zu einer Wirtschaftsweise innerhalb der planetaren Grenzen ist unausweichlich. Ökologische Nachhaltigkeit ist alternativlos und die Voraussetzung dafür, materiellen Wohlstand dauerhaft generieren und Teilhabe für breite Bevölkerungsschichten in allen Lebensbereichen verwirklichen zu können. Daher braucht es ein Update der aktuellen Wirtschaftsordnung hin zu einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft.
Das deutsche Bundesklimaschutzgesetz schreibt das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 vor – ein erster Schritt in die richtige Richtung. Doch der Weg in eine Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft ist gekennzeichnet von komplexen makroökonomischen Wirkungszusammenhängen und Zielkonflikten – diese auszutarieren, erfordert eine kluge wirtschaftspolitische Steuerung. Der gesetzliche Orientierungsrahmen zur Bewältigung dieser Herausforderung ist allerdings sehr alt.
»Wohlstand für alle« wird zunehmend schwer einlösbar
Vor mehr als 50 Jahren entstand mit dem Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (im Folgenden: Stabilitätsgesetz) das Leitbild der deutschen Wirtschaftspolitik, das für die Erfüllung der Ziele der Sozialen Marktwirtschaft jahrzehntelang handlungsleitend sein sollte. Demnach sollten angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum, ein hoher Beschäftigungsstand, ein stabiles Preisniveau und außenwirtschaftliches Gleichgewicht gleichrangig angestrebt werden (Meurers, Weinberg und Herzum 2015).
Im Laufe der Zeit erwies sich dieser Rahmen jedoch als immer weniger angemessen und Zweifel an seiner Praxistauglichkeit wuchsen. Die dynamischen Megatrends der Globalisierung und Digitalisierung sowie des demografischen Wandels stellten und stellen die Soziale Marktwirtschaft vor große Herausforderungen und machen das Versprechen, materiellen Wohlstand und soziale Gerechtigkeit gleichzeitig zu erreichen, zunehmend schwer einlösbar (Petersen 2022).
Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise und der Zerstörung planetarer Lebensgrundlagen geraten vor allem die Bedürfnisse künftiger Generationen immer stärker in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen und politischen Debatten. Im März 2021 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass das bis dahin gültige deutsche Klimaschutzgesetz nicht grundgesetzkonform sei, da es die Pflicht zur Emissionsreduktion übermäßig auf den Zeitraum nach 2030 verschiebe, wodurch künftigen Generationen enorme Freiheitseinschränkungen entstehen können (Bundesverfassungsgericht 2021). Die ökologische Transformation der Wirtschaft, ihre Entkopplung vom Einsatz natürlicher Ressourcen und das Ende der Emission von Treibhausgasen werden immer dringlicher. Expert:innen sind sich einig: Das aktuelle Jahrzehnt ist entscheidend für den Erfolg der Klimaschutzanstrengungen (IPCC 2022).
Wohlstand meint auch ökologische und soziale Nachhaltigkeit
Diese Entwicklungen führten und führen immer wieder zu Bestrebungen, das allgemeine Verständnis von Wohlstand und die einseitige Fokussierung auf seine materielle Ausdehnung zu überdenken und schließlich auch das wirtschaftspolitische Zielsystem einer grundlegenden Erneuerung mit Blick auf die Vollständigkeit, Gewichtung und Messung der Parameter zu unterziehen, an denen es sich zu orientieren gilt. Neben verschiedenen parteipolitischen Initiativen in den 1990er-Jahren sind die Ansätze der Enquete-Kommission »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft«, der Friedrich-Ebert-Stiftung und zuletzt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zur Erarbeitung einer umfassenderen Wirtschaftsberichterstattung hervorzuheben (ausführlicher in Kapitel 2).
Gemeinsam ist diesen Ansätzen die Intention, eine gesamtheitliche Wohlstandsmessung etablieren zu wollen, die neben der traditionellen Betrachtung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) als zentraler Gradmesser für Wohlstand und Lebensqualität auch die Dimensionen der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit sowie der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen stärker berücksichtigt. Unterschiede zeigen sich bezüglich der Anzahl und Gewichtung von Zieldimensionen sowie der entsprechenden Indikatorik, die zur Messung vorgeschlagen wird. Trotz der weitgehenden Übereinstimmung bezüglich der Notwendigkeit einer zeitgemäßen Novellierung des Stabilitätsgesetzes hat sich bis heute noch kein Ansatz mit Gesetzeskraft durchgesetzt.
Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie bedeuten neue außenwirtschaftliche Ziele
Der von Russland geführte Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt in vielfacher Hinsicht eine Zeitenwende dar, die auch die Ziele der deutschen Außen-, Energie- und Wirtschaftspolitik erneut auf den Prüfstand stellt. Insbesondere außenwirtschaftliche Verflechtungen, Abhängigkeiten europäischer Volkswirtschaften sowie die Zukunft des globalen Handelssystems werden kontrovers debattiert. Dabei bekommen Konzepte wie Resilienz und Souveränität einen höheren Stellenwert und erfordern ein neues Verständnis des wirtschaftspolitischen Ziels eines außenwirtschaftlichen Gleichgewichts.
Das Streben nach einer größeren wirtschaftlichen Sicherheit und Unabhängigkeit gegenüber geopolitischen Konflikten, Lieferkettenproblemen und Knappheiten wird dabei wiederum verbunden sein mit vielfältigen Folgewirkungen für unseren materiellen Wohlstand, die ökologische Nachhaltigkeit und weitere wirtschaftspolitische Parameter (Petersen 2022). Für die Beschreibung eines zeitgemäßen wirtschaftspolitischen Zielsystems und die Analyse seiner inhärenten Konflikte gilt es daher, über den erstrebenswerten Grad der außenwirtschaftlichen Verflechtung Deutschlands neu nachzudenken. Dieser sollte nicht nur ermöglichen, die ökologischen Ziele einzuhalten, sondern auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, die Risiken aus kritischen Abhängigkeiten zu minimieren und die Verlagerung von CO2-Emissionen ins Ausland zu verhindern.
Postfossiles Zeitalter erfordert ein Update des wirtschaftspolitischen Zielsystems
Wenn »Wohlstand für alle« zu einem leeren Versprechen wird, kann dies die Stabilität des politischen Systems gefährden. Die Folgen des Klimawandels sowie andere globale Konflikte und Krisen sind in der Lage, dieses Problem zu verschärfen, da sie ökonomische Disparitäten tendenziell vergrößern. Materieller Wohlstand und sozialer Ausgleich sind untrennbar mit der erfolgreichen Eindämmung der Klimakrise verbunden (Chancel 2020). Doch auch die politisch forcierte Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaftsweise bringt Risiken mit sich, die sowohl den Wohlstand als auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden können.
Für eine klug austarierte Steuerung dieser ökologischen Transformation bedarf es daher nicht nur eines Updates des wirtschaftspolitischen Leitbildes. Notwendig ist auch die Fähigkeit, die inhärenten Spannungsfelder und Zielkonflikte zu entschärfen und ihnen vorzubeugen. Nur so kann es gelingen, zu einer Wirtschaftsweise zu kommen, die das erneuerte Versprechen einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft – »Wohlstand für alle innerhalb der planetaren Grenzen« – auch zukünftig einlösen kann.
Vor diesem Hintergrund widmet sich das vorliegende Buch nicht nur einer zeitgemäßen und praxistauglichen Neugestaltung des wirtschaftspolitischen Zielsystems, sondern nimmt explizit die makroökonomischen Wirkungszusammenhänge zwischen den verschiedenen Zielparametern einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft in den Blick. Der Fokus liegt auf theoretischen Wirkungskanälen und aktuellen empirischen Erkenntnissen zu den Wechselwirkungen zwischen der ökologischen Nachhaltigkeit und den anderen Zieldimensionen eines solchen Wirtschaftsmodells. Die Analyse dieser Interdependenzen, die sich in Form von Zielkonflikten und Synergien manifestieren können, ist die notwendige Voraussetzung für eine intelligente wirtschaftspolitische Steuerung der Transformation zu einer klimaneutralen und umweltschonenden Ökonomie. Darüber hinaus werden mögliche wirtschafts- und klimapolitische Stellhebel besprochen, die sich zur Vorbeugung oder Auflösung von Zielkonflikten sowie zur Nutzung von Synergiepotenzialen anbieten.
Im Folgenden widmet sich Kapitel 2 der Entstehung und Geschichte der wirtschaftspolitischen Zielsetzungen der Sozialen Marktwirtschaft sowie den verschiedenen Ansätzen, diese um Dimensionen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit sowie um ein breiteres Wohlstandsverständnis zu ergänzen. In Kapitel 3 werden zunächst eigene Überlegungen zur Neugestaltung des wirtschaftspolitischen Leitbildes dargelegt und die sieben Zieldimensionen einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft definiert. Kapitel 4 analysiert die ökonomischen Wirkungszusammenhänge und Spannungsfelder zwischen dem Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit und den anderen sechs Zieldimensionen. Abschließend gibt Kapitel 5 einen Überblick über politische Handlungsoptionen, die »Wohlstand für alle innerhalb der planetaren Grenzen« ermöglichen können, und ermuntert zu einer ganzheitlichen wirtschaftspolitischen Sichtweise auf die ökologische Transformation.
Literatur
Bundesverfassungsgericht (2021). »Verfassungsbeschwerde gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich«. Pressemitteilung Nr. 31/2021 vom 29. April 2021. www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021bvg21-031.html.
Chancel, Lucas (2020). Unsustainable Inequalities. Social Justice and the Environment. Cambridge.
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (2022). »Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change«. Working Group III contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/.
Meurers, Martin, Dagmar Weinberg und Nadine Herzum (2015). »Das Stabilitätsund Wachstumsgesetz Eine Würdigung im Lichte der aktuellen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Diskussion ganzheitlicher Wohlfahrtsziele«. Monatsbericht 12-2015. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Berlin.
Petersen, Thieß (2022). Megatrend-Report #4: Die Rückkehr der Knappheit. Wie globale Demografie, Deglobalisierung und Dekarbonisierung Verteilungskonflikte verschärfen. Hrsg. Bertelsmann Stiftung. Gütersloh. www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/megatrend-report-4-die-rueckkehr-der-knappheit.
2Die Soziale Marktwirtschaft: Das »Magische Viereck« hat ausgedient
Die Soziale Marktwirtschaft bildet seit Jahrzehnten das konzeptionelle Leitbild für wirtschaftspolitisches Handeln in der Bundesrepublik Deutschland. Im Kern der Sozialen Marktwirtschaft steht, die marktwirtschaftlichen Prozesse so frei wie möglich wirken zu lassen, während gleichzeitig durch einen geeigneten Ordnungsrahmen eine möglichst breite gesellschaftliche Teilhabe am wirtschaftlichen Wohlstand sicherzustellen ist. Ziel ist ein stetiges und angemessenes Wachstum, das Wohlstand, soziale Absicherung und Aufstiegschancen miteinander vereint.
Das Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft wurde 1967 in Form des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes in Deutschland festgeschrieben. In diesem Zuge wurden vier gleichberechtigte Ziele für ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht definiert. Die Zieldimensionen »stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum«, »stabiles Preisniveau«, »hoher Beschäftigungsstand« und »außenwirtschaftliches Gleichgewicht« bilden gemeinsam mit den im Gesetz vorgeschlagenen politischen Instrumenten für die Zielerreichung nun seit mehr als 50 Jahren den Orientierungsrahmen für das wirtschaftspolitische Handeln hierzulande (BMWK 2022; siehe Abbildung 1).
Abbildung 1: Das »Magische Viereck« der Wirtschaftspolitik
Quelle: Eigene Darstellung
Die Beziehungen dieser vier gesamtwirtschaftlichen Ziele sind geprägt von wechselseitigen Abhängigkeiten und Zielkonflikten zwischen einzelnen Idealzuständen. Da die Ziele trotz möglicher Unvereinbarkeiten untereinander gleichrangig sein sollen, wird in der Volkswirtschaftslehre vom »Magischen Viereck« gesprochen. Beispielsweise wurde in den 1950er-Jahren empirisch ein negativer Zusammenhang zwischen Inflationsrate und Arbeitslosenquote identifiziert, der als modifizierte Phillipskurve in die ökonomische Theorie einging. Die Phillipskurve besagt, dass höhere Inflation mit geringerer Arbeitslosigkeit einhergeht und umgekehrt. Damit suggeriert sie, dass es nicht möglich ist, gleichzeitig einen hohen Beschäftigungsstand und ein stabiles Preisniveau zu erreichen, sondern stattdessen positive Entwicklungen des einen durch negative Veränderungen des anderen Parameters erkauft werden müssen (Snowdon und Vane 2005).
Initiativen zur Weiterentwicklung des wirtschaftspolitischen Zielsystems gewinnen an Bedeutung
Aus heutiger Perspektive ist das Stabilitätsgesetz als wirtschaftspolitischer Ordnungsrahmen der Sozialen Marktwirtschaft in vielerlei Hinsicht nicht mehr zeitgemäß. Die wirtschaftspolitischen sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft unterscheiden sich stark von denen der 1960er-Jahre. Gleichzeitig hat sich auch das Verständnis von Wohlstand gewandelt und die soziale sowie ökologische Nachhaltigkeit haben sich als gesellschaftliche Leitgedanken etabliert. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Debatte um die Erneuerung des Stabilitätsgesetzes und die Reform des wirtschaftspolitischen Zielsystems der Bundesrepublik Deutschland seit Jahren zunehmend an Bedeutung.
Ein erster öffentlich geführter und grundlegender Diskurs zur Gestaltung eines nachhaltigen Wirtschaftssystems mündete 2010 in der Einsetzung der Enquete-Kommission »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität« durch den Deutschen Bundestag. Ziel war, die Diskussion rund um ein ganzheitliches Wohlstandsverständnis und die alternative Messung von gesellschaftlichem Wohlstand aufzubereiten und voranzubringen. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass das Bruttoinlandsprodukt als alleiniger Indikator für Wohlstand, Lebensqualität und gesellschaftlichen Fortschritt unzureichend ist, da vor allem die Dimensionen »soziale Gerechtigkeit« und »Ökologie« keine Berücksichtigung finden. Als neues Wohlstandsmaß wurden die W3-Indikatoren entwickelt, eine Zusammensetzung von zehn Leitindikatoren aus den drei Wohlstandsdimensionen »materieller Wohlstand«, »Soziales/Teilhabe« und »Ökologie« (Enquete-Kommission 2013).
Zeitgleich veröffentlichte die Friedrich-Ebert-Stiftung einen Vorschlag zur Reform des Stabilitätsgesetzes und den damit verbundenen wirtschaftspolitischen Zielen (Dullien und van Treeck 2012). In den Folgejahren wurde das Konzept des »neuen Magischen Vierecks« weiter konkretisiert und der Indikatorensatz entsprechend angepasst (Dullien 2017). Gemäß dem »neuen Magischen Viereck« soll das wirtschaftspolitische Handeln an den vier Zieldimensionen »materieller Wohlstand und ökonomische Nachhaltigkeit«, »Nachhaltigkeit der Staatstätigkeit und der Staatsfinanzen«, »soziale Nachhaltigkeit« und »ökologische Nachhaltigkeit« ausgerichtet werden. Neben der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Stabilität erfassen die gewählten Indikatoren auch die Verschuldungs- und Investitionsentscheidungen des Staates, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Umgang mit Ressourcen und Energie.
Europäische Integration ergänzt nationale Ziele des Stabilitätsgesetzes
Derweil hat das Stabilitätsgesetz im Zuge der europäischen Integration – gerade im Hinblick auf öffentliche Finanzen, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und Preisniveaustabilität – an Bedeutung verloren. Mit der Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel in vielen europäischen Ländern seit 1999 wurde die geldpolitische Verantwortung auf die supranationale Ebene übertragen. In den Mitgliedstaaten der Währungsunion bestimmt die Europäische Zentralbank (EZB) anstelle der nationalen Zentralbanken über die gemeinsame Geldpolitik und ist dafür verantwortlich, ein stabiles Preisniveau sicherzustellen.
Durch die Eurokrise ab 2010 gerieten die im Vertrag von Maastricht verankerten Staatsschuldengrenzen in den Fokus der Wirtschafts- und Geldpolitik. Das Ziel, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen dauerhaft zu sichern, wurde schließlich im Fiskalpakt der Europäischen Union (EU) von 2012 festgehalten. Bereits 2009 hatte Deutschland eine Schuldenbremse im Grundgesetz verankert, deren Angemessenheit und Ausgestaltung gerade im Hinblick auf die Erfordernisse der ökologischen Transformation bis heute auch unter Ökonomen und Ökonominnen kontrovers diskutiert werden (vgl. u. a. Gründler, Potrafke und Ruthardt 2022).
Darüber hinaus werden seit 2011 auch makroökonomische Ungleichgewichte zwischen den EU-Mitgliedstaaten überwacht, um zu ermitteln, ob diese die länderspezifischen und gemeinschaftlichen wirtschaftspolitischen Ziele gefährden könnten. Im Makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahren werden anhand eines Scoreboards vierzehn Indikatoren, wie öffentliche Verschuldung, Leistungsbilanzsaldo oder Arbeitslosenzahlen, zur frühzeitigen Erkennung von Risiken ausgewertet. Überschreitet ein Land die Schwellenwerte, kann es zu Gegenmaßnahmen verpflichtet werden, um potenziell schädliche Ungleichgewichte zu beheben und die makroökonomische Stabilität des europäischen Wirtschaftsraums zu gewährleisten (Europäische Kommission 2016).
Internationale Zielvereinbarungen beim Klimaschutz werden immer wichtiger
Deutschlands Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens unterstrich 2015 schließlich die herausgehobene Bedeutung der ökologischen Nachhaltigkeit im wirtschaftspolitischen Zielsystem. Mit dem Übereinkommen von Paris verpflichten sich aktuell 195 Staaten dazu, den menschengemachten Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C – möglichst auf 1,5 °C – gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Der Vertrag bildet zudem die Grundlage für die europäischen und nationalen Klimaschutzziele. Die EU strebt bis 2030 eine Emissionsreduktion von 55 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 an und will die Klimaneutralität bis 2050 erreichen (Europäische Kommission 2021). Das deutsche Bundesklimaschutzgesetz von 2021 schreibt bis 2030 eine Treibhausgasreduktion von 65 Prozent im Vergleich zum Niveau von 1990 vor sowie die Klimaneutralität bis 2045 (BMU 2021). Neben dem Erreichen rein makroökonomischer und wirtschaftspolitischer Ziele muss ein neues wirtschaftspolitisches Leitbild demnach auch sicherstellen, dass globale und nationale Klimaschutzziele sowie andere ökologische Zielsetzungen eingehalten werden.
In der jüngsten Vergangenheit hat sich die Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbericht 2022 der Transformation des wirtschaftspolitischen Zielsystems hin zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft gewidmet. Erstmalig bekennt eine Bundesregierung explizit, dass langfristige Fehlentwicklungen des Wirtschaftssystems nicht länger nur punktuell behoben werden können, sondern dass stattdessen die grundlegende Weiterentwicklung des wirtschaftspolitischen Leitbildes notwendig ist. Zentral sind laut Bundesregierung erstens ein verbindlicher ökologischer Ordnungsrahmen – orientiert an den internationalen Klima- und Biodiversitätszielen –, zweitens die Erweiterung der Wohlstandsmessung um Indikatoren der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und drittens die Anpassung des finanz- und wirtschaftspolitischen Instrumentariums in Einklang mit den ökologischen Zielen (BMWK 2022).
Um den Erhalt der planetaren Lebensgrundlagen und damit auch den gesellschaftlichen Wohlstand sowie die Lebensqualität sicherzustellen, ist der ökologischen Nachhaltigkeit eine herausragende Bedeutung im wirtschaftspolitischen Zielsystem zuzuordnen. Die Transformation hin zu einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft erfordert zusätzlich, die potenziellen Zielkonflikte zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und den anderen Zielparametern zu lösen oder ihnen vorzubeugen sowie die verschiedenen wirtschaftspolitischen Dimensionen in einem ganzheitlichen System zu vereinen.
Im Folgenden stellen wir zunächst einige grundsätzliche Überlegungen zu den An- und Widersprüchen eines zeitgemäßen wirtschaftspolitischen Leitbildes an. Dann definieren wir die wirtschaftspolitischen Ziele einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft im Einzelnen und schließlich nehmen wir mögliche Spannungsfelder mit dem Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit in den Blick.
Literatur
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2021). Lesefassung des Bundes-Klimaschutzgesetztes 2021 mit markierten Änderungen zur Fassung von 2019. Stand 7.7.2021. Berlin.
BMWK – Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2022). Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung 2022. Für eine Sozial-ökologische Marktwirtschaft – Transformation innovativ gestalten. Berlin.
Dullien, Sebastian (2017). Das neue »Magische Viereck«. Zur Neu-Vermessung des Wohlstands in Deutschland (2009–2015). Hrsg. Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn.
Dullien, Sebastian, und Till van Treeck (2012). »Ein neues ›Magisches Viereck‹. Ziele einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik und Überlegungen für ein neues ›Stabilitätsund Wohlstandsgesetz‹«. Werkbericht Nr. 2. Hrsg. Denkwerk Demokratie. Berlin.
Enquete-Kommission »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft« (2013). Schlussbericht. Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode. Drucksache 17/13300. Berlin.
Europäische Kommission (2016). »The Macroeconomic Imbalance Procedure. Rationale, Process, Application: A Compendium«. Institutional Paper 039. European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Publications Office of the European Union. Luxemburg.
Europäische Kommission (2021). European Green Deal – Delivering on our targets. Luxemburg. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3688.
Gründler, Klaus, Niklas Potrafke und Fabian Ruthardt (2022). »Der Ampel-Koalitionsvertrag im Ökonomentest«. Ifo Schnelldienst (75) 1. 52–56.
Snowdon, Brian, und Howard V. Vane (2005): Modern Macroeconomics. Its origins, development and current state. Cheltenham.
3Die wirtschaftspolitischen Ziele einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft
Bevor hier näher beschrieben wird, wie ein zeitgemäßes wirtschaftspolitisches Zielsystem aussehen könnte und welche Ziele darin konkret verfolgt werden sollten, erscheinen einige grundsätzliche Vorbemerkungen angebracht. Denn jede normative Herleitung eines solchen idealtypischen Leitbildes ist das Resultat verschiedener Wertvorstellungen und gesellschaftlicher Abwägungen, die im Detail natürlich weder bekannt noch statisch sind. Dies gilt umso mehr in Zeiten, die von dynamischen globalen Entwicklungen wie dem Klimawandel, Pandemien oder kriegerischen Konflikten geprägt sind. So ist etwa das Ziel der Preisniveaustabilität binnen kurzer Zeit wieder enorm wichtig geworden, als im Zuge der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine globale Lieferengpässe entstanden und fossile Energieträger sowie Nahrungsmittel sich rapide verteuerten.
Angesichts des nach wie vor hohen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stellenwerts der vier Ziele des Stabilitätsgesetzes – und mit dem Anspruch, eine möglichst anknüpfungsfähige Weiterentwicklung des bestehenden Leitbildes vorzulegen – fußt der folgende Ansatz auf einer gewissenhaften Zusammenschau und Synthese bestehender Arbeiten, Diskussionen und der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur. Er umfasst sieben wirtschaftspolitische Ziele, die in einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft verfolgt werden sollten: das Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit als rahmengebendes Element mit herausragender Bedeutung sowie die sechs Zieldimensionen »hoher materieller Wohlstand«, »hoher Beschäftigungsstand«, »stabiles Preisniveau«, »außenwirtschaftliches Gleichgewicht«, »faire Einkommensverteilung« und »tragfähige Staatsfinanzen« (Abbildung 2).
Abbildung 2: Zielsystem einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft
Quelle: Eigene Darstellung
Das wirtschaftspolitische Zielsystem wird erweitert und neu gedacht
Das bisherige »Magische Viereck« wird ergänzt durch die Ziele der ökologischen Nachhaltigkeit, der fairen Einkommensverteilung innerhalb der Gesellschaft sowie der finanzpolitischen Tragfähigkeit, sodass ein umfangreicheres Zielsystem entsteht. Explizit priorisiert wird lediglich, indem der ökologischen Nachhaltigkeit in diesem System eine herausgehobene Rolle zukommt. Im Folgenden sollen aber auch die ursprünglichen vier Ziele des Stabilitätsgesetzes auf den Prüfstand gestellt und zeitgemäß neu bewertet werden. Dies gilt insbesondere für das Ziel des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts, das vor dem Hintergrund des Klimawandels und der geopolitischen Verwerfungen ein neues, breiteres Verständnis benötigt. Zudem ersetzt das Ziel eines hohen materiellen Wohlstands die Zieldimension »angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum« aus dem Stabilitätsgesetz. Dadurch wird das gesellschaftliche Wohlstandslevel – und nicht das Wirtschaftswachstum an sich – zu einer wirtschaftspolitischen Zielgröße im System einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft.
Im Unterschied zu bisherigen Vorschlägen einer umfassenderen Wohlstandsmessung fokussiert der vorliegende Ansatz auf die wirtschaftspolitische Steuerung der anstehenden Transformation, sodass etwa Ziele im Bildungs- und Gesundheitsbereich sowie der menschlichen Entwicklung im Allgemeinen bewusst ausgeblendet werden. Natürlich dienen aber auch alle hier diskutierten wirtschaftspolitischen Zieldimensionen dem höheren Ziel eines Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, das dem Wohlergehen aller Menschen und künftiger Generationen dient, ihnen größtmöglichen Freiraum für ihre individuellen Lebenswege und Entfaltungsmöglichkeiten eröffnet sowie Teilhabechancen, soziale Absicherung und ein friedliches Zusammenleben sicherstellt.
Die sieben wirtschaftspolitischen Zieldimensionen können auch anders gefasst, als Vorbedingungen oder Teilziele verstanden oder mit anderen Indikatoren unterfüttert werden. Insofern sind sie nicht dogmatisch zu verstehen, sondern sollen ein zeitgemäßes wirtschaftspolitisches Zielsystem mit dem Anspruch einer praxistauglichen Anwendung und Überprüfbarkeit darstellen. Aus diesem Grund wurde mit Ausnahme der ökologischen Nachhaltigkeit eine gleichrangige grafische Anordnung der sechs anderen Ziele gewählt, wenngleich damit eine Gleichgewichtung hineininterpretiert werden könnte, die hier explizit nicht unterstellt wird. Einerseits stehen alle Ziele aufgrund gesellschaftlicher Präferenzen in einer dynamischen Hierarchie; andererseits besteht eine inhärente Rangfolge, die jedoch nicht eindeutig zu beschreiben ist. So kann etwa materieller Wohlstand nur gerecht verteilt werden, wenn (hinreichend) Wertschöpfung und Einkommen überhaupt entstehen.
Auch können hoher materieller Wohlstand, seine faire Verteilung und ein hoher Beschäftigungsstand nur dann sichergestellt werden, wenn die planetaren Lebensgrundlagen – die Voraussetzung für jedwedes Leben und damit auch wirtschaftliche Aktivität sind – langfristig in funktionsfähigem Zustand erhalten bleiben. So verdeutlicht der aktuelle Sachstandsbericht des Weltklimarats (IPCC), dass die langfristigen ökonomischen Vorteile einer erfolgreichen Begrenzung der Erderwärmung deutlich größer sind als die Kosten der Maßnahmen zur Emissionsreduktion und auch die Kosten der Beibehaltung des Status quo. Außerdem weist der IPCC eindringlich darauf hin, dass das aktuelle Jahrzehnt für die Bekämpfung der Klimakrise entscheidend ist (IPCC 2022). Das Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit erhält daher eine herausragende Bedeutung und wird in Kapitel 4 dieses Buches als Ausgangspunkt für mögliche Zielkonflikte mit den sechs weiteren wirtschaftspolitischen Zieldimensionen verwendet.
Doch weder erübrigen sich dadurch die anderen sechs Ziele, noch können sie als völlig nachrangig oder aufschiebbar behandelt werden. Denn hoher materieller Wohlstand und ein hoher Beschäftigungsstand, stabile Preise, ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht, eine faire Verteilung sowie tragfähige Staatsfinanzen lassen sich allesamt mit guten Gründen als wesentliche Vorbedingungen für das Erreichen ökologischer Nachhaltigkeit werten. Als Maßgabe einer Nachhaltigen Sozialen Marktwirtschaft soll die Formulierung »Wohlstand für alle innerhalb der planetaren Grenzen« diese interdependenten Zusammenhänge, wonach das eine Ziel jeweils die Vorbedingung für das Erreichen des anderen Ziels ist, zum Ausdruck bringen.
Dabei ist zu beachten, dass die Zielkonflikte selbst häufig erst durch die Wahl einer politischen Strategie oder eines Instruments entstehen oder verschärft werden. Kluge Wirtschaftspolitik kann Zielkonflikte auflösen oder vermeiden. Eine kluge wirtschaftspolitische Steuerung sollte daher auf einer sorgfältigen Analyse der makroökonomischen Wirkungszusammenhänge aller Zieldimensionen beruhen.
3.1 Ökologische Nachhaltigkeit
Warum ist ökologische Nachhaltigkeit ein relevantes wirtschaftspolitisches Ziel?
Der Begriff der ökologischen Nachhaltigkeit ist umfassend zu verstehen. Er bedeutet, dass die jetzt lebenden Generationen mit der Natur und der Umwelt schonend und pfleglich umgehen, damit auch die nachfolgenden Generationen eine weitgehend intakte Umwelt vorfinden. Ökologische Nachhaltigkeit bezieht sich daher u. a. auf den Erhalt der biologischen Artenvielfalt, den Gesundheitszustand von Ökosystemen, den sparsamen Einsatz nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen (z.B. fossile Energieträger), die Nutzung erneuerbarer natürlicher Ressourcen (z.B. Wald- und Tierbestände) unter Berücksichtigung ihrer Regenerationsfähigkeit und auf den Klimaschutz (Petersen 2012).
Die aktuell größte Herausforderung für die ökologische Nachhaltigkeit ist der vom Menschen verursachte Klimawandel. Treibhausgasemissionen spielen dabei eine besonders große Rolle, denn sie sind eine zentrale Ursache für den Treibhauseffekt und die damit verbundene globale Erderwärmung. Aus der globalen Erwärmung ergeben sich zahlreiche negative Effekte (vgl. ausführlicher Petersen 2021 und IPCC 2022): das Abschmelzen von Gletschern und Meereis sowie der daraus resultierende Anstieg des Meeresspiegels mit zunehmendem Überflutungsrisiko, die Zunahme von Wetterextremen (Hitzewellen, Dürren, Stürme etc.) und die damit verbundenen Schäden an Gebäuden und Infrastruktur, eine steigende Zahl von Hitzetoten und mehr hitzebedingte Erkrankungen sowie gravierende Folgen für die Ökosysteme, etwa das Massensterben von Tier- und Pflanzenarten.
Weitere Konsequenzen sind immer mehr Waldbrände, ein Rückgang der Anzahl von bestäubenden Insekten bei gleichzeitigem stärkerem Befall durch Insektenschädlinge, die Ausbreitung von Krankheiten, die von Insekten übertragen werden (z.B. Malaria, Borreliose), sowie die Versauerung der Ozeane durch eine erhöhte CO2-Konzentration. Wassermangel, Dürren, Stürme, Überflutungen, ein stärkerer Schädlingsbefall sowie der Verlust der funktionellen Dienstleistungen von Bestäubern und Zersetzern haben gravierende Folgen für die Produktion von Nahrungsmitteln, da sie zu Ernteausfällen führen.
Um diese negativen Effekte zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, die Treibhausgasemissionen zu verringern. Mit Blick auf das jährliche Emissionsvolumen macht Kohlenstoffdioxid den mit Abstand größten Anteil an den Treibhausgasemissionen aus (UBA 2022a). Daher steht die CO2-Reduzierung im Zentrum der Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels. Trotz der großen Bedeutung des globalen Artenschutzes und Biodiversitätserhalts widmen wir uns in diesem Buch vorwiegend der CO2-Reduktion und Klimaneutralität als zentralem Baustein für das Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit.





























