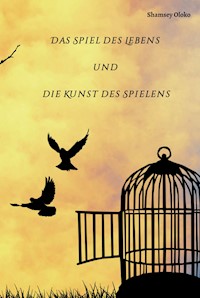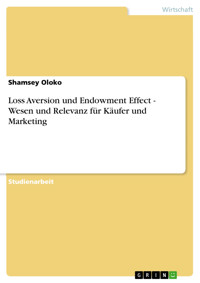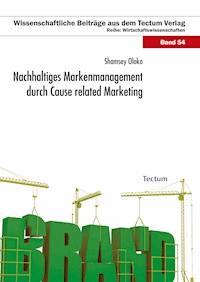
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum-Verlag
- Sprache: Deutsch
Unternehmen müssen nach dem Willen ihrer Kapitalgeber den Umsatz steigern, die Marke emotionalisieren und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Zunehmend setzen sie dazu auf Cause related Marketing. Dabei verspricht das Unternehmen dem Kunden im Gegenzug zu seinem Produktkauf eine Spende für einen wohltätigen Zweck. So schützt der Kunde der Krombacher Brauerei mit dem Kauf eines Kastens Bier einen Quadratmeter Regenwald. Diese Verknüpfung kann den Absatz steigern, die Marke prosozial aufladen und gleichzeitig soziale oder ökologische Missstände beheben. Dieses Buch liefert erstmals ein theoretisches Fundament für Cause related Marketing und analysiert das Instrument in einer bislang unerreichten Detailtiefe. Dabei erklärt der Autor auch, woher das entstehende "gute Gefühl" rührt. Kritisch hinterfragt er dennoch, ob Cause related Marketing tatsächlich das Image einer Marke nachhaltig verbessern kann. Das Buch richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker zugleich und verbindet differenzierte Forschungsansätze mit wertvollen praktischen Folgerungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Shamsey Oloko
Nachhaltiges Markenmanagement durch Cause related Marketing
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag. Wirtschaftswissenschaften, Bd. 54
© Tectum Verlag Marburg, 2011
Zugl.: Univ. Diss. Potsdam, 2010
ISSN 1861-8073
ISBN 978-3-8288-5639-4
Bildnachweis Cover: thesuperph – www.istockphoto.com
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-2558-1 im Tectum Verlag erschienen.)
Besuchen Sie uns im Internet unter www.tectum-verlag.de
www.facebook.com/Tectum.Verlag
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Problemstellung und Relevanz
1.2 Zielsetzung der Arbeit
1.3 Gang der Arbeit
2. CAUSE RELATED MARKETING
2.1 Definition und Abgrenzung
2.2 Entwicklung und Verbreitung
2.2.1 USA
2.2.2 Deutschland
2.2.3 Weltweit
2.3 Konzeptionelle Einordnung
2.3.1 Perspektive des Unternehmens
2.3.1.1 Kommunikationspolitik
2.3.1.2 Produktpolitik
2.3.1.3 Corporate Citizenship
2.3.2 Perspektive der Nonprofit Organisation
2.4 Cause related Marketing im Zielsystem der Akteure
2.4.1 Triadisches Beziehungsgefüge
2.4.2 Cause related Marketing im Zielsystem des Unternehmens
2.4.2.1 Mehrwert durch Konsumenten
2.4.2.2 Mehrwert durch Nonprofit Organisationen
2.4.2.3 Mehrwert durch Fach- und Führungskräfte
2.4.2.4 Risiken für Unternehmen
2.4.3 Cause related Marketing im Zielsystem der Nonprofit Organisation
2.4.3.1 Mehrwert durch Unternehmen
2.4.3.2 Mehrwert durch Konsumenten
2.4.3.3 Risiken für Nonprofit Organisationen
2.4.4 Cause related Marketing im Zielsystem des Konsumenten
2.5 Einflussfaktoren auf die Wirkung vonCause related Marketing
2.5.1 Klassifikation der Einflussfaktoren
2.5.2 Passive Einflussfaktoren als Rahmenbedingungen
2.5.2.1 Unternehmensbezogene Faktoren
2.5.2.2 Konsumentenbezogene Faktoren
2.5.3 Aktive Einflussfaktoren als Gestaltungsparameter
2.5.3.1 Unternehmensbezogene Faktoren
2.5.3.2 NPO-bezogene Faktoren
2.6 Strategische und taktische Anwendung vonCause related Marketing
3. THEORIEN UND KONZEPTE ZU CAUSE RELATEDMARKETING
3.1 Nutzenkonzept als Bezugsrahmen für dasCause related Marketing
3.1.1 Definition und Abgrenzung
3.1.2 Konzeptualisierung der Nutzendimensionen
3.1.3 Zwischenfazit
3.2 Prosoziales Verhalten als Erklärungsansatz für dasCause related Marketing
3.2.1 Definition und Abgrenzung
3.2.2 Evolutionspsychologische Erklärungsansätze
3.2.3 Kognitive Erklärungsansätze
3.2.4 Affektive Erklärungsansätze
3.2.5 Mikroökonomische Erklärungsansätze
3.2.6 Selbstwerterhöhung als transzendentales Bedürfnis des prosozialen Verhaltens
3.3 Moralischer Zusatznutzen durch Cause related Marketing
3.3.1 Definition und Abgrenzung
3.3.2 Konzeptualisierung und Typologie
3.3.3 Ausgestaltung der Nutzenbeiträge
3.3.4 Entstehung und Erosion
3.3.5 Komparativer Kostenvorteil der CrM-Spende
3.3.6 Zwischenfazit
4. THEORIEN UND KONZEPTE ZUM MARKENIMAGE
4.1 Grundlagen zur Marke
4.1.1 Perspektiven des Markenkonzepts
4.1.2 Identitätsbasierte Markenführung als Rahmenkonzept
4.1.3 Definition und Konzeptualisierung des Markenimages
4.2 Partialdimensionen des Markenimages
4.2.1 Definition und Konzeptualisierung der Markenpersönlichkeit
4.2.2 Definition und Konzeptualisierung des Markennutzens
4.2.3 Selbstwerterhöhung als transzendentales Bedürfnis des Konsums
4.3 Zwischenfazit
5. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
5.1 Hypothesen und Operationalisierung
5.1.1 Hypothesen
5.1.1.1 Zusammenfassung des Wirkungssystems von Cause related Marketing
5.1.1.2 Wirkung auf den Markennutzen
5.1.1.3 Wirkung auf die Markenpersönlichkeit
5.1.1.4 Wirkung auf das globale Markenimage
5.1.1.5 Einfluss der Glaubwürdigkeit
5.1.2 Operationalisierung der Konstrukte
5.1.2.1 Markennutzen
5.1.2.2 Markenpersönlichkeit
5.1.2.3 Markenimage
5.1.2.4 Glaubwürdigkeit
5.1.2.5 Kovariate
5.2 Messmethodik
5.2.1 Gütekriterien für die Messung
5.2.1.1 Kriterien der ersten Generation
5.2.1.2 Kriterien der zweiten Generation
5.2.1.3 Invarianz des Messmodells
5.2.2 Signifikanzniveaus für die Auswertung
5.2.2.1 Statistische Signifikanz
5.2.2.2 Praktische Signifikanz
5.2.3 Zusammenfassung des Prüf- und Evaluationsschemas
5.3 Experiment zu CrM in der Produktgruppe Schokolade
5.3.1 Design und Methodik
5.3.1.1 Stimulus
5.3.1.2 Faktorstufen
5.3.2 Ergebnisse
5.3.2.1 Zusammensetzung der Stichprobe
5.3.2.2 Manipulation Check
5.3.2.3 Evaluation der Gütekriterien
5.3.2.4 Prüfung der Verfahrensprämissen
5.3.2.5 Prüfung der Hypothesen
5.3.3 Diskussion
5.4 Interventionsstudie zu CrM beim Fußballverein HERTHA BSC
5.4.1 Design und Methodik der Interventionsstudie
5.4.1.1 Auswahl des Unternehmens
5.4.1.2 Stimulus
5.4.2 Ergebnisse
5.4.2.1 Zusammensetzung der Stichprobe
5.4.2.2 Evaluation der Gütekriterien Teil A
5.4.2.3 Prüfung der Verfahrensprämissen Teil A
5.4.2.4 Prüfung der Hypothesen Teil A
5.4.2.5 Evaluation der Gütekriterien Teil B
5.4.2.6 Prüfung der Verfahrensprämissen Teil B
5.4.2.7 Prüfung der Hypothesen Teil B
5.4.3 Diskussion
6. FAZIT
LITERATURVERZEICHNIS
ANHANG
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Herbst 2010 von der Universität Potsdam als Dissertationsschrift angenommen. Auf unterschiedlichste Art und Weise haben dabei verschiedene Personen zum erfolgreichen Abschluss dieser Arbeit beigetragen. Auch wenn es nicht möglich ist, jeden einzelnen namentlich zu würdigen – und ich bitte um Nachsicht bei jedem, der sich in diesem Vorwort nicht wiederfindet – so möchte ich doch einige Personen hervorheben und ihnen an dieser Stelle meine Dankbarkeit aussprechen.
Besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Prof. Dr. Ingo Balderjahn für seine Bereitschaft, mich als externen Doktoranden am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing anzunehmen und zu betreuen. Im konstruktiven Dialog haben seine Anregungen nachhaltig zum Qualitätsstandard der Arbeit beigetragen. Prof. Dr. Christoph Rasche gebührt mein Dank für die bereitwillige Übernahme des Zweitgutachtens. Der KKGS-Stiftung danke ich für ihr Vertrauen in meine akademische Leistung und die damit verbundene finanzielle Unterstützung während meiner Promotion.
Bedanken möchte ich mich zudem bei HERTHA BSC für die erfolgreiche wissenschaftliche Begleitung ihres Cause related Marketings. Insbesondere Ingo Schiller, Thomas Herrich und Benjamin Weber haben dazu beigetragen, den empirischen Teil dieser Arbeit durch eine reibungslose Kooperation substanziell mit Leben zu füllen. In diesem Zusammenhang richtet sich mein Dank auch an das Team der Unternehmensberatung kleinundpläcking, das diese Kooperation engagiert unterstützt hat. Stellvertretend für alle möchte ich mich dafür bei Arne Klein und Oliver Hoffman bedanken.
Im privaten Bereich gebührt mein besonderer Dank Alexander Berlin für dessen zahlreiche Anregungen zu (fast) jeder Tages- und Nachtzeit. Er hat durch die Einnahme als Ratgeber und geschätzter Diskussionspartner in der Position eines Advocatus Diaboli mit großem Eifer maßgeblich zur Schärfung meiner Gedankengänge beigetragen.
Linda Weber danke ich für die intensive fachliche, organisatorische und vor allem emotionale Unterstützung – insbesondere während meiner Momente als hochkonzentrierter Einsiedlerkrebs. Leider konnte ich ihr nicht in allen Phasen der Promotion die Bedeutung ihrer Unterstützung und Fürsorge vermitteln, obwohl mir die Bedeutung jederzeit bewusst war.
Die erfrischende Ablenkung während meiner Promotion verdanke ich Florian Methner für die zahlreichen Anstoss-Abende und seinen damit verbundenen Niederlagen im Spiel. Sie haben mir stets neue Kraft gegeben! Mein Dank gilt auch Katja „Kaddel“ Bönisch, deren unermüdlicher (monologischer) Informationstransfer stets zu einer herrlichen kognitiven Entlastung meinerseits führte und den ich auch in Zukunft nicht missen möchte. Bei Min-Ju Kim, Patrick Schopohl und Roy Matthes bedanke ich mich für die fantasiereichen Ausflüge nach Aventurien, die hoffentlich auch in ferner Zukunft noch abenteuerlich ausfallen werden. Andreas Wolter, Nicolai Woyczechowski und Sven Grunow danke ich für die vielen Fußball-, Kino- und Konsolenabende, die stets mit großem Vergnügen und legendären Anekdoten verbunden bleiben. Der 1. Herrenbasketballmannschaft von TuS Lichterfelde danke ich für die vielen tollen Jahre als Teammitglied und für deren Verständnis, meine promotionsbedingte Abstinenz vom Training mit milder Nachsicht zu sanktionieren. Jakob Ndi möchte ich dafür danken, dass er meine Wurzeln im Hip Hop am Leben erhalten hat. Philippe Bahlburg und Henner Ceynowa danke ich dafür, fortan die „Gelegenheit beim Schopfe zu packen“.
Am Ende dieses Vorworts gilt mein besonderer Dank meiner Familie. Eva Leithäuser danke ich für die anregenden Diskussionen und ihr unbeirrtes Vertrauen in meine Person. Meinen Schwestern Kimsey und Gillian Oloko danke ich für die zuverlässige Unterstützung in den unterschiedlichen Phasen meiner Promotion. Ein ganz besonderer Dank gebührt aber meinen Eltern Ayo und Irene Oloko, die mich während meiner nunmehr seit über zwei Jahrzehnten andauernden schulischen und akademischen Ausbildung vorbehaltlos und unermüdlich unterstützt haben. Es ist ihr Verdienst, dass ich Abitur machen, studieren und promovieren konnte und zugleich mein Leben durch verschiedene Hobbys sowie zahlreiche Leidenschaften in meiner Freizeit bereichern konnte. Ihnen gebührt ein großer Anteil an dem was ich war, was ich bin und was ich sein werde, und ihnen widme ich daher diese Arbeit in Liebe und Dankbarkeit.
2. Cause related Marketing
2.1 Definition und Abgrenzung
Innerhalb der deutschsprachigen Literatur liegt bislang keine einheitlich akzeptierte Übersetzung des Fachbegriffs CrM vor. Am nahesten kommt die wörtliche Übersetzung „zweckgebundenes Marketing“ (HELMIG/LAUPER 2007), aber auch die Bezeichnungen „Sozialkampagne“ (LUCHTEFELD et al. 2006), „Förderung altruistischer Zwecke“ (HAMMEL 2008) oder „erlösbezogene Werbung“ (GLÖCKNER 2006) finden sich in der deutschsprachigen Literatur wieder. Im Einklang mit der überwiegend englischsprachigen Forschung zu CrM wird in der vorliegenden Arbeit der englische Fachbegriff „Cause related Marketing“ verwendet.
Mit Blick auf die Definitionen zu CrM lassen sich innerhalb der Literatur zwei Strömungen identifizieren, die entweder auf eine enge oder auf eine weite Definition zurückgreifen. Prominente Fürsprecher der engen Definition sind VARADARAJAN und MENON, die CrM in ihrem richtungweisenden Artikel im Journal of Marketing aus dem Jahr 1988 erstmalig definieren als:
Def.: „The process of formulating and implementing marketing activities that are characterized by an offer from the firm to contribute a specified amount to a designated cause when customers engage in revenueproviding exchanges that satisfy organizational and individual objectives.” (VARADARAJAN/MENON 1988, S. 60).
Gemäß dieser engen Definition ist CrM transaktionsbasiert und stets an einen Kaufakt gebunden. Dadurch steht der Konsument als Auslöser der CrM-Spende immer und unmittelbar im Mittelpunkt dieses Marketinginstruments.
Eine Weiterentwicklung der engen Definition wird von GUPTA und PIRSCH (2006) vorgeschlagen. Die Autorinnen kritisieren die Beschränkung auf ausschließlich organisationale und individuelle Zielsysteme und erweitern die Definition von VARADARAJAN und MENON wie folgt: „Causerelated marketing is the process of formulating and implementing marketing activities that are characterized by an offer from the firm to contribute a specified amount to a designated cause when customers engage in revenueproviding exchanges to induce favourable responses from all company stakeholders (e.g. investors, suppliers, employees and customers) which in turn satisfy organizational and individual objectives [Hervorhebung durch den Verfasser].” (Ebd. 2006, S. 39). Diese Erweiterung ist insofern sinnvoll, als dass die in der Literatur diskutierten, anspruchsgruppenübergreifenden Zielsysteme einer CrM-Kampagne dadurch auch definitorisch verankert werden. Da in der vorliegenden Arbeit neben dem Unternehmen nur der Konsument im Mittelpunkt steht, stellt diese Zielgruppenerweiterung allerdings keinen Mehrwert dar. Für eine Auswahl an engen Definitionen von CrM siehe Anhang 2.1.
Demgegenüber setzt die weite Definition von CrM nicht zwangsläufig eine Transaktion voraus, sondern subsumiert unter diesem Begriff auch andere, transaktionsunabhängige Formen kommerzieller Zusammenarbeit zwischen einer NPO und einem Unternehmen. Eine prominente Fürsprecherin dieser Strömung ist ADKINS (1999). Sie definiert CrM als:
Def.: „A commercial activity by which businesses and charities or causes form a partnership with each other to market an image, product or service for mutual benefit.” (ADKINS 1999, S. 15).
Einhergehend mit dieser weiten Definition hat ANDREASEN (1996, S. 49) eine Typologisierung von CrM in eine Transaction-Based Promotion, eine Joint Issue Promotion und einem Licensing vorgenommen:
Bei einer Joint Issue Promotion handelt es sich um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, bei der ein Unternehmen und eine NPO gemeinsam auf einen gesellschaftlichen Missstand aufmerksam machen. Hierunter fällt bspw. die Aktion „Rettet die Eisbären“ des Handelskonzerns REWE Group und des WWF in 2008. Diese Aktion hatte zum Ziel, durch den Verkauf von über 200.000 Philips-Energiesparlampen in rund 5.500 Märkten einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.Beim Licensing werden dem Unternehmen der Name und das Logo der NPO für einen festen Betrag zu kommerziellen Zwecken zur Verfügung gestellt. Hierunter fällt bspw. die Zusammenarbeit zwischen dem WWF und dem Batteriehersteller Uniross, dessen wiederaufladbare Batterien der Marke Hybrio mit dem WWF-Logo gekennzeichnet sind. Analog zur Joint Issue Promotion ist auch in diesem Fall der Geldfluss zwischen Unternehmen und NPO vom Produktkauf emanzipiert.Die Transaction-Based Promotion als dritte Form stimmt inhaltlich mit der engen Definition von CrM überein. ANDREASEN definiert die Transaction-Based Promotion wie folgt: „[…] a corporation donates a specific amount of cash, food, or equipment in direct proportion to sales revenue – often up to some limit – to one or more nonprofits.” (Ebd. 1996, S. 49).Für eine Auswahl an weiten Definitionen von CrM siehe Anhang 2.2.
Den Zusammenhang zwischen enger und weiter Definition von CrM berücksichtigend, verfolgen ELLEN et al. (2000, S. 405) den Ansatz, den Begriff „Cause related Marketing“ mit der Definition von VARADARAJAN und MENON (1988) sowie mit der Transaction-Based Promotion von ANDREASEN (1996) gleichzusetzen, während sie unter dem Begriff „Cause Marketing“ die Joint Issue Promotion und das Licensing subsumieren. WYMER und SAMU (2003) bilden mit den Business-Nonprofit Alliances einen allgemeinen Oberbegriff, dem zusätzlich zu der von ANDREASEN (1996) genannten Typologie auch das Joint Venture, das Sponsorship, die Corporate Foundation und die Corporate Philanthropy zuzuordnen sind. Die einzelnen Allianzen lassen sich dem Corporate Citizenship zuordnen, weshalb die Bezeichnung „Business-Nonprofit Alliance“ auch als Synonym für den Corporate Citizenship-Mix betrachtet werden kann (siehe hierzu Abschnitt 2.3.1.3). Tab. 3 fasst den Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Ansätzen der Terminologie und Typologie zu CrM zusammen.
Für die vorliegende Arbeit gilt die enge Definition von VARADARAJAN und MENON (1988) in der terminologischen Einordnung von ELLEN et al. (2003). Die enge Definition bietet im Vergleich zur weiten Definition eine größere Präzision im Hinblick auf die Funktionsweise von CrM und besitzt damit eine für die vorliegende Arbeit höhere Trennschärfe zu anderen Marketinginstrumenten. Zudem lässt sich innerhalb der Literatur zu CrM eine Dominanz der engen Definition identifizieren (z.B. BARNES 1994; BERGER et al. 1999; BRONN/VRIONI 2001; CUI et al. 2003; DAHL/LAVACK 1995; GRAU/ FOLSE 2007; HUBER et al. 2008; LAFFERTY/GOLDSMITH 2005; OLSEN et al. 2003; POLONSKY/WOOD 2001; ROSS et al. 1991; STRAHILEVITZ 1999; WEBB/MOHR 1998).
Tabelle 3: Terminologische und typologische Einordnung von CrM
(Quelle: Eigene Darstellung)
2.2 Entwicklung und Verbreitung
2.2.1 USA
Während die grundlegende Funktionsweise der Kopplung einer CrM-Spende an den Kauf eines Produktes andernorts bereits im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eingesetzt wurde (ADKINS 1999, S. 9; PRINGLE/ THOMPSON 1999, S. XXI), lässt sich die erste größere regionale CrM-Kampagne auf das Jahr 1981 datieren. In diesem Jahr spendete der Finanzdienstleister American Express im Rahmen des San Francisco Arts Festival in den USA jeweils 5 Cent pro Nutzung der Kreditkarte an unterschiedliche wohltätige Zwecke. Darüber hinaus wurden weitere 2 Dollar für jeden Neukunden im Aktionszeitraum gespendet. Am Ende betrug die Gesamtspende der dreimonatigen CrM-Kampagne 100.000 Dollar (MESCON et al. 1995, S. 60).
Häufig wird der Beginn von CrM allerdings mit der zweiten, 1983 von American Express durchgeführten Kampagne in Verbindung gebracht (ADKINS 1999, S. 14; BARNES 1992, S. 21; BERGER et al. 1999, S. 491; HAMLIN/ WILSON 2004, S. 664; HUBER et al. 2008, S. 7; KOTLER/LEE 2005, S. 82; VARADARAJAN/MENON 1988, S. 59). Jeweils 1 Cent pro Nutzung der Kreditkarte und 1 Dollar für jeden Neukunden im Aktionszeitraum wurden bei der weltweit ersten nationalen CrM-Kampagne „When Did You First Fall in Love With Her?“ für die Restauration der New Yorker Freiheitsstatue an die Statue of Liberty-Ellis Island Foundation gespendet. Im Rahmen dieser dreimonatigen CrM-Kampagne hat American Express ca. 4 Mio. Dollar in die Kommunikation investiert und über 1,7 Mio. Dollar für die Restauration gespendet.8 Die Nutzung der Kreditkarte stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28% und die Neuanmeldungen erhöhten sich um 45%. Von American Express stammt auch die Bezeichnung „Cause related Marketing“, die von dem Unternehmen beim U.S. Patent Office als Dienstleistungsmarke registriert wurde (BARNES/FITZGIBBONS 1991, S. 20; CAESAR 1987, S. 24).
In den USA hat die Verbreitung von CrM seither stark zugenommen. Bereits 1991 ergab eine Befragung bei Unternehmen der Fortune 500 Liste, dass CrM einen Bekanntheitsgrad von 76% hatte (LAFRANCOIS 1991). Vergleicht man die Ausgaben für CrM in Höhe von 120 Mio. Dollar aus dem Jahre 1990 mit den prognostizierten 1,61 Mrd. Dollar in 2010, so entspricht das einem absoluten Wachstum von 1.242% in 20 Jahren und einem durchschnittlichen Wachstum von 14% pro Jahr (siehe Abb. 3).
Abbildung 3: Entwicklung der Ausgaben für CrM in den USA
(Quelle: IEG 2009)
Bezüglich der Anwendung von CrM lässt sich festhalten, dass sich das Marketinginstrument von einem eher taktischen und aktionistisch geprägten Gebrauch zu einem stärker in der Marken- und CSR-Strategie verankerten Instrument weiterentwickelt hat. GHOSH und POSA argumentieren übereinstimmend: „Donations of cause marketing evolve from sales promotion approaches to sophisticated brand building strategies.“ (Ebd. 2006a, S. III). Insgesamt unterscheidet DAW (2006, S. 41 ff.) vier Entwicklungsstufen von CrM in den USA, die sich vier Zeiträumen zuordnen lassen. Die Autorin bezeichnet diese Entwicklungsstufen als Sales Phase, Customer Loyalty Phase, Branding Phase und CSR Phase (siehe Tab. 4). Die Reihenfolge der Entwicklungsstufen entspricht dem zunehmend strategischeren Verständnis von CrM. PRINGLE und THOMPSON (1999, S. 64 ff.) identifizieren drei generische Phasen des Brandings, die sie in rational, emotional und spirituell unterscheiden. Die Autoren sehen die Entstehung und Verbreitung von CrM als Konsequenz der dritten Phase des Brandings, die den Marken neben rationalen und emotionalen Werten eine „Seele“ geben soll. Innerhalb dieser spirituellen Phase lassen sich die letzten beiden Entwicklungsstufen von DAW (2006) einordnen.
Tabelle 4: Entwicklungsstufen von CrM in den USA
(Quelle: In Anlehnung an DAW 2006, S. 41 ff.; MEFFERT/HOLZBERG 2009a, S. 48)
Neben der Unternehmensseite lässt sich auch auf Seiten der Konsumenten eine steigende Akzeptanz im Zeitablauf beobachten. So lag die Zustimmung für CrM 1993 bei 66%, 1998 bei 74% und 2008 bei 85% (CONE 1999; 2008). Mit 68% betrachteten die meisten Konsumenten CrM bereits 1991 als ein sinnvolles Instrument zum Fundraising (ROSS et al. 1991). Ähnlich wie bei den Unternehmen rangierte zudem die Bekanntheit von CrM mit 98% schon 1992 auf einem sehr hohen Niveau (BARNES 1992). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen später auch WEBB und MOHR (1998), die im Rahmen einer qualitativen Untersuchung festhalten, dass 79% der Teilnehmer ein breites bis sehr breites Wissen bzgl. CrM besaßen. Diese Teilnehmer konnten sich demnach an mindestens eine CrM-Kampagne genau erinnern.
2.2.2 Deutschland
Die erste bundesweite Umsetzung von CrM begann 1998, als der Generikahersteller Betapharm gemeinsam mit der Elterninitiative Der Bunte Kreis kooperierte. Für jedes verkaufte Medikament wurden 5 Pfennig für die heimische Betreuung krebskranker Kinder und deren Familien gespendet. Eine größere Aufmerksamkeit erlangte CrM hierzulande erst 2002 durch die via Fernsehen kommunizierte Kampagne der Brauerei Krombacher (MEFFERT/ HOLZBERG 2009a, S. 48). BLUMBERG und CONRAD bezeichnen diese CrM-Kampagne auch als ,„Urmutter’ aller deutschen Cause Related Marketing Programme.“ (Ebd. 2006, S. 43). Unter der Bezeichnung „Krombacher Regenwaldprojekt“ wurde pro Kasten Bier 1 m2 Regenwald geschützt. Dieses Versprechen galt für Krombacher Pils, Alkoholfrei und Radler. Für die Gastronomie galt, dass für ein 30 l Fass 2 m² und für ein 50 l Fass 5 m² Regenwald geschützt werden. Laut Angaben des WWF schützt jeder Quadratmeter den Dzanga Sangha-Regenwald in Zentralafrika für 100 Jahre.
Abbildung 4: Krombacher Regenwaldprojekt 2002 und 2008
(Quelle: KROMBACHER Pressearchiv)
Unter Einsatz eines Kommunikationsbudgets von ca. 9 Mio. Euro konnte Krombacher den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 8,1% auf 460 Mio. Euro steigern (BRODER 2003; KROMBACHER Pressearchiv). Allerdings sind in diesem Zusammenhang auch andere, CrM unabhängige Effekte wie z.B. die Fußballweltmeisterschaft zu berücksichtigen, die sich ebenfalls positiv auf den Abverkauf der Bierprodukte ausgewirkt haben können und nicht eindeutig abzugrenzen ist. Im Anschluss an die dreimonatige Kampagne wurden dem WWF ca. 1 Mio. Euro übergeben, die für den Schutz von 15.129.378 m² des Regenwaldes garantieren sollten. Weil die rechtlichen Rahmenbedingungen zu diesem Zeitpunkt noch weitestgehend unklar waren, wurde diese CrM-Kampagne kritisch betrachtet: Im gleichen Jahr erhielt Krombacher eine einstweilige Verfügung wegen unlauteren Wettbewerbs (Landgericht Siegen Az. 7 O 72/02, 80/02). Dieser Rechtsstreit wurde nicht abschließend geklärt, da sich die Parteien außergerichtlich geeinigt haben (HAMMEL 2008). Aus den Wiederholungen in 2003, 2004, 2006 und 2008 lässt sich jedoch schließen, dass für Krombacher die Vorteile von CrM in ihrer Gesamtheit größer waren als die (juristischen) Nachteile.
Wenn nicht die Funktionsweise, so ist zumindest der Fachbegriff CrM hierzulande noch relativ unbekannt. In einer Studie von FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER (2006) gaben lediglich 36% der befragten Unternehmen an, den Fachbegriff CrM zu kennen und noch weniger, nämlich lediglich 13% der Unternehmen, benutzten diesen Begriff in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch innerhalb der letzten vier Wochen. Dennoch haben hierzulande bis Ende 2009 nach eigener Desk-Recherche mehr als 150 verschiedene Unternehmen bzw. Marken CrM-Kampagnen durchgeführt (siehe Abb. 5). Für eine ausführliche Auflistung der CrM-Kampagnen siehe Anhang 3.
Abbildung 5: Entwicklung neuer CrM-Kampagnen in Deutschland
(Quelle: Eigene Recherche, Stand: März 2010)
Auffällig ist der Sprung zwischen 2004 und 2005, bei dem sich die Anzahl der erstmals durchgeführten CrM-Kampagnen verdreifacht hat. Ursächlich dafür ist hauptsächlich der Wegfall juristischer Unklarheiten: Im Jahr 2004 gab es eine grundlegende Novelle des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), die für eine bessere Rechtslage für CrM sorgte. Während CrM zuvor als „gefühlsbetonte Werbung“ grundsätzlich als unlauter und damit als Verstoß gegen das UWG angesehen werden konnte, kann es seitdem nur noch unter § 4 Nr. 1 UWG9 fallen, da die Fallgruppe „gefühlsbetonte Werbung“ als solche im novellierten Gesetz nicht mehr aufgenommen wurde (GLÖCKNER 2006). Die Novellierung des UWG basiert auf einem grundsätzlichen Wandel in der Rechtssprechung, der bereits 2002 eingetreten ist: Beeinflusst durch den Europäischen Gerichtshof übernahm der Bundesgerichtshof das Leitbild des mündigen Verbrauchers, der sich durch soziale Aktivitäten des Unternehmens nicht unter Kaufdruck setzen lässt (HABISCH/WEGNER 2004, S. 40). Darüber hinaus erkannte das Bundesverfassungsgericht den Unternehmen ein Recht auf Meinungsfreiheit zu (BVerfG, 1 BvR 952/90 und BvR 2151/96 vom 06.02.2002). Aufbauend auf diesen Entwicklungen hat das Urteil des Bundesgerichtshofes die Werbung mit sozialen Motiven explizit erlaubt (BGH Az. I ZR 55/02 vom 22.09.2005).
Im Einklang mit der gestiegenen Anwendung von CrM gaben hierzulande 62% der Unternehmen an, dass ihre letzte CrM-Kampagne insgesamt zufriedenstellend war (OLOKO 2008). Bezugnehmend auf die vier Entwicklungsstufen nach DAW (2006, S. 41 ff.), befindet sich CrM hierzulande in der Sales-Phase, da es hauptsächlich zur Verkaufsförderung eingesetzt wird (siehe Tab. 4).
Auch bei den Konsumenten ist trotz des kritischen Medienechos von einer grundsätzlichen Akzeptanz dieses Marketinginstruments auszugehen. BLUMBERG und CONRAD (2006) messen für CrM eine Zustimmung in den Top-2-Werten von 72% im Jahr 2006.10
2.2.3 Weltweit
Die Forschung zu CrM befindet sich noch im Anfangsstadium, weshalb es sich als schwierig gestaltet, einen fundierten Überblick über die weltweite Verbreitung und Entwicklung von CrM zu erhalten. Tab. 5 liefert daher nur eine grobe Zusammenfassung internationaler Beobachtungen und Erkenntnisse zu CrM.
Tabelle 5: CrM im internationalen Kontext
(Quelle: Eigene Recherche)
2.3 Konzeptionelle Einordnung
2.3.1 Perspektive des Unternehmens
2.3.1.1 Kommunikationspolitik
Aus der Perspektive des Unternehmens betrachtet, lässt sich CrM konzeptionell innerhalb des Marketing-Mixes der Kommunikationspolitik zuordnen (siehe Abb. 6). In seiner ursprünglichen Form funktioniert CrM ähnlich wie ein Instrument der Verkaufsförderung, indem es die Kaufbereitschaft der Konsumenten stimuliert (ADKINS 1999, S. 116 ff.; WESTBERG 2004, S. 28 ff.). BRUHN definiert Verkaufsförderung wie folgt:
Def.: „Verkaufsförderung bedeutet die Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle meist zeitlich befristeter Maßnahmen mit Aktionscharakter, die das Ziel verfolgen, auf nachgelagerten Vertriebsstufen durch zusätzliche Anreize Kommunikations- und Vertriebsziele eines Unternehmens zu erreichen.“ (BRUHN 2005, S. 343).
Da auch CrM „meist zeitlich befristet“ ist und durch einen „zusätzlichen Anreiz“ das „Vertriebsziel“ unterstützt, kann es im Grunde genommen als eine besondere Form der Verkaufsförderung verstanden werden. Diese Einschätzung verfolgte auch VARADARAJAN (1986), der CrM zunächst als horizontale, kooperative Verkaufsförderung einstufte, bevor VARADARAJAN und MENON (1988) es später als eigenständiges Marketinginstrument abgrenzten. Im Gegensatz zur klassischen Verkaufsförderung, bei der dem Konsumenten ein finanzieller Nutzen in Form eines Preisnachlasses bei gleicher Leistung, oder einer Leistungssteigerung bei gleichem Preis angeboten wird, geht CrM mit seinem „moralischen Zusatznutzen“ darüber hinaus. STRAHILEVITZ und MYERS argumentieren: „In fact, while monetary incentives can only offer value to the individuals who receive them, altruistic incentives can simultaneously add value to the sellers, buyers, and end consumers, not to mention the good causes that are being supported.“ (Ebd. 1998, S. 445). Sowohl die Zahl der Nutzenempfänger als auch die Art des Nutzens unterscheiden CrM deutlich von der klassischen Verkaufsförderung und rechtfertigen den Anspruch der konzeptionellen Eigenständigkeit.
Auch zum Sponsoring besteht eine gewisse Nähe (KELLER et al. 2008, S. 268). BRUHN definiert dieses Instrument wie folgt:
Def.: „Sponsoring bedeutet die Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten, die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, Dienstleistungen oder Know-How durch Unternehmen und Institutionen zur Förderung von Personen und/oder Organisationen in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Umwelt und/oder den Medien verbunden sind, um damit gleichzeitig kommunikative Ziele des Unternehmens zu erreichen.“ (BRUHN 2005, S. 387).
Analog zu CrM erfolgt die Leistung eines Sponsorings im Austausch mit einer vertraglich geregelten Gegenleistung. Ebenfalls analog zu CrM sind die Leistungsempfänger beim Sponsoring – abgesehen von kulturellen, medialen oder sportlichen Einrichtungen – oftmals soziale oder ökologische Institutionen. HOMBURG und KROHMER (2009, S. 806) bezeichnen diese spezielle Form des Sponsorings als Sozial- und Umweltsponsoring. Zudem werden mit CrM durch die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung analog zum Sponsoring auch kommunikative Ziele verfolgt (POLONSKY/ SPEED 2001, S. 1365). Dennoch lässt sich ein zentraler Unterschied identifizieren, der im Einklang mit der engen Definition von CrM zu einer klaren Abgrenzung der beiden Instrumente führt: Die Höhe eines Sponsorings ist im Gegensatz zu CrM nicht vom Absatz abhängig, sondern wird unter Berücksichtigung zahlreicher Faktoren (Reichweite, Zielgruppenaffinität, Medieninteresse etc.) festgelegt (SVENSSON/WOOD 2006, S. 21; WESTBERG 2004, S. 36). POLONSKY und WOOD argumentieren übereinstimmend: „Thus, CRM is postpurchase giving (i.e., after the sale has been made), whereas sponsorship is given prepurchase (i.e. no sale is necessary for giving to take place […].” (Ebd. 2001, S. 11). Darüber hinaus bildet beim CrM häufig der temporäre Erwerb der Nutzungsrechte am Logo der NPO die Gegenleistung zum Ressourcentransfer, während es sich beim Sponsoring in der Regel um die temporäre Vergabe der Nutzungspflicht des Unternehmensoder Markenlogos auf sichtbaren und reichweitenstarken Medien (z.B. Trikots, Poster, Clubzeitschriften etc.) handelt. Ähnlich wie bei der Verkaufsförderung rechtfertigen die Unterschiede auch in diesem Fall den Anspruch der konzeptionellen Eigenständigkeit.
Abbildung 6: Konzeptionelle Einordnung von CrM in die Kommunikationspolitik
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an HOMBURG/KROHMER 2009, S. 765 ff.)
2.3.1.2 Produktpolitik
Innerhalb des Marketing-Mixes ist CrM nicht allein der Kommunikationspolitik zuzuordnen. Auch die Image fördernde Wirkung von CrM im Sinne des Markenmanagements muss berücksichtigt werden (siehe Abb. 7). Das Markenmanagement stellt neben dem Innovationsmanagement und dem Management bereits am Markt etablierter Produkte ein zentrales Entscheidungsfeld innerhalb der Produktpolitik dar (HOMBURG/KROHMER 2009, S. 541 f.). Die Image fördernde Wirkung lässt sich innerhalb des Markenmanagements dem Konzept der Markenemotionalisierung zuordnen, das FREUNDT wie folgt definiert als:
Def.: „[…] Ansatz der Markenführung mit der Zielsetzung, Marken in der Erfahrungs- und Erlebniswelt des Konsumenten mit einem positiven markenspezifischen Reaktionsmuster (,Gefühlsecho’) zu verankern und somit eine emotionale verhaltensmoderierende Bindung des Verbrauchers an die Marke zu erreichen.“ (FREUNDT 2006, S. 27).
Die (temporäre) Erweiterung des Markenversprechens erfolgt durch die CrM-Spende als „gute Tat“. Sie stellt eine Konsequenz prosozialen Verhaltens dar, wobei mit Blick auf die Attribution dieses Verhaltens zwei grundsätzliche Perspektiven unterschieden werden müssen: Betrachtet der Konsument das Unternehmen als prosozialen Akteur, weil es freiwillig einen Teil seines Umsatzes spendet, dann resultiert die positive Markenbewertung aus der Zustimmung des Konsumenten für das prosoziale Verhalten des Unternehmens. Betrachtet der Konsument sich selbst als prosozialen Akteur, weil die CrM-Spende nur aufgrund seines Kaufs ausgelöst wird, dann resultiert die positive Markenbewertung aus dem erfahrenen „moralischen Zusatznutzen“.
Einen weiteren Ansatzpunkt für die Zuordnung von CrM zum Markenmanagement bietet das Co-Branding (HAMLIN/WILSON 2004, S. 666; VOGEL/ HUBER 2007, S. 20). VOGEL und HUBER definieren diesen Ansatz wie folgt:
Def.: „Co-Branding beschreibt die Markierung einer Leistung mit mindestens zwei Markennamen im Rahmen einer kooperativen Markenpolitik, zu der sich alle involvierten Marken freiwillig und zielorientiert entschieden haben, wobei die Zusammenarbeit für den Konsumenten wahrnehmbar ist und die Marken ihre Souveränität aus Konsumentensicht behalten.“ (VOGEL/HUBER 2007, S. 11).
Im Rahmen des CrM werden die Marke des Unternehmens und die Marke der NPO für den Marktauftritt kombiniert, so dass sie sich gegenseitig stärken und neue Absatzpotenziale erschließen können. Parallel zu einem neuen Zielgruppenzugang – den Unterstützern der NPO – findet auch ein Imagetransfer statt, der die Marke des Unternehmens aufgrund der Assoziation mit der Marke der NPO positiv aufladen soll (HOEFFLER/KELLER 2002, S. 85; WERMTER 2007, S. 138; WYMER/SAMU 2009, S. 5).
Abbildung 7: Konzeptionelle Einordnung von CrM in die Produktpolitik
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an HOMBURG/KROHMER 2009, S. 541)
2.3.1.3 Corporate Citizenship
Eine singuläre Zuordnung von CrM zum Marketing-Mix ist jedoch insofern nicht sinnvoll, als dass CrM in seiner Funktionsweise nicht nur den Absatz steigern und das Markenimage verbessern, sondern auch Ausdruck und Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung sein kann. LEWIS argumentiert übereinstimmend: „It is the most visible way that a company can invest in society.“ (Ebd. 2006, S. 32). An dieser Stelle geht das Zielsystem von CrM über das Zielsystem eines reinen Marketinginstruments hinaus und CrM wird – bedingt durch die Begünstigung Dritter aus einem sozialökologischen Umfeld – zugleich auch ein Instrument des Corporate Citizenships (CC) (DAW 2006, S. 26; HABISCH/WEGNER 2004, S. 38 ff.; HABISCH et al. 2007, S. 20; LAFFERTY 2009, S. 360). Das häufig als unternehmerisches Bürgerengagement übersetzte CC wird von HABISCH definiert als:
Def.: „Aktivitäten, mit deren Hilfe Unternehmen selbst in ihr gesellschaftliches Umfeld investieren und ordnungspolitische Mitverantwortung übernehmen.“ (HABISCH 2003, S. 58).
Je nach Abgrenzung lässt sich CC dem Konzept der Corporate Social Responsibility (CSR) zuordnen, das in der Literatur entweder als Oberbegriff oder als Synonym für CC verwendet wird (HABISCH 2006, S. 36; HABISCH/ WEGNER 2004, S. 13; KIRCHHOFF 2006, S. 16). CARROLL definiert CSR wie folgt:
Def.: „The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at a given point of time.” (CARROLL 1979, S. 500).
Andere Forscher ordnen CrM direkt der CSR zu (z.B. KÖHLER/HADERLEIN 2007, S. 78; LAFFERTY/GOLDSMITH 2005, S. 423; PIRSCH et al. 2007, S. 126). Für die vorliegende Arbeit wird jedoch der Auffassung gefolgt, dass CC ein Teilbereich der CSR eines Unternehmens ist und CrM damit direkt zum CC und indirekt zur CSR gehört.
In Anlehnung an den klassischen Marketing-Mix beschreibt MÜNSTERMANN (2007, S. 13) einen Corporate-Citizenship-Mix und ordnet CrM in diesen Instrumente-Kanon ein (siehe Abb. 8). Die Aufteilung in neun Instrumente vertritt neben MÜNSTERMANN bspw. auch DRESEWSKI (2004). HABISCH und WEGNER (2004, S. 21 ff.) identifizieren sieben Instrumente, bei denen CrM ebenfalls ein eigenständiges Instrument darstellt. Für weiterführende Ansätze zur Einordnung und Abgrenzung von CrM im Vergleich zu anderen Instrumenten des CC-Mixes siehe AUSTIN 2003, S. 23 ff.; WYMER/SAMU 2003, S. 5 ff.
Abbildung 8: Konzeptionelle Einordnung von CrM in das Corporate Citizenship
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an MÜNSTERMANN 2007, S. 13)
Neben der Ähnlichkeit zum Sponsoring, die bereits in Abschnitt 2.3.1.1 thematisiert wurde, weist CrM auch Parallelen zur Unternehmensspende auf. HABISCH und WEGNER definieren das allgemeine Spendenkonzept wie folgt:
Def.: „Unter Spenden versteht man freiwillige Zuwendungen in Form von Geld oder Gütern, für die keine Gegenleistung erwartet wird. Spenden werden sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen geleistet. Sie werden als rein philanthropisches Instrument angesehen.“ (HABISCH/WEGNER 2004, S. 21).
Ähnlich wie beim CrM fließen auch bei der Unternehmensspende materielle und/oder immaterielle Ressourcen, die für einen wohltätigen Zweck eingesetzt werden. Allerdings existieren vier zentrale Punkte, die den Unterschied verdeutlichen:
Der Leistungstransfer einer Unternehmensspende erfolgt einseitig, während die CrM-Spende in der Regel auf einer Gegenleistung in Form von Lizenzverträgen beruht. Aufgrund der vertraglichen Gegenleistung ist eine CrM-Spende daher auch steuerrechtlich nicht abzugsfähig.Die Höhe einer Unternehmensspende ist im Gegensatz zu CrM nicht abhängig vom Absatz, weshalb der Kaufakt des Konsumenten keine determinierende Relevanz besitzt.Die Ressourcen für eine Unternehmensspende kommen in der Regel aus einem Budget für gesellschaftliches Engagement (CSR- oder CC-Budget), während die Ressourcen für CrM in der Regel aus dem Marketingbudget finanziert werden (ANDREASEN 1996, S. 48; GARCIA 2007, S. 19; KOTLER/LEE 2005, S. 82).Die Kommunikation einer Unternehmensspende erfolgt in der Regel durch Public Relations oder gar nicht. Demgegenüber bedient sich CrM häufig verschiedener Kommunikationsinstrumente und -kanäle (OLOKO 2008, S. 38 f.; WESTBERG 2004, S. 34).Trotz der Gemeinsamkeiten zwischen CrM und dem naheliegenden Konzept der Unternehmensspende, rechtfertigen diese vier Unterschiede den Anspruch der konzeptionellen Eigenständigkeit von CrM innerhalb des CC-Mixes.
2.3.2 Perspektive der Nonprofit Organisation
Während CrM aus Sicht der Unternehmen zu einem Teil im Marketing-Mix und zum anderen Teil im CC verankert ist, stellt es für NPO ein Instrument des Fundraisings dar (ADKINS 1999, S. 100; CHANEY/DOLLI 2000, S. 157; DAW 2006, S. XXX; DRESEWSKI/KOCH 2006, S. 196; FELBINGER 2005, S. 8; HELMIG/LAUPER 2007, S. 804). HAIBACH definiert Fundraising wie folgt:
Def.: „Fundraising wird verstanden als die umfassende Mittelbeschaffung einer Organisation. Dies umfasst Finanz- und Sachmittel, Rechte und Informationen, Arbeits- und Dienstleistungen, wobei der Schwerpunkt auf der Einwerbung finanzieller Mittel liegt.“ (HAIBACH 2006, S. 19).
Dieser Definition folgend, handelt es sich beim Fundraising um den Prozess der Mittelbeschaffung durch die NPO, der sich durch CrM umsetzen lässt. In Deutschland werben einige NPO offensiv mit den Möglichkeiten und Potenzialen von CrM. Einige NPO wie bspw. UNICEF und WWF stellen erfolgreiche CrM-Kampagnen auf ihrer Homepage vor. Andere NPO wie bspw. die Kindernothilfe oder auch das BergwaldProjekt erwähnen explizit den Fachbegriff CrM im Kontext der möglichen Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen.
2.4 Cause related Marketing im Zielsystem der Akteure
2.4.1 Triadisches Beziehungsgefüge
In jeglicher Ausgestaltung involviert CrM stets drei Akteure, die fester Bestandteil einer CrM-Kampagne sind und in ihrer Interaktion und Interdependenz ein triadisches Beziehungsgefüge konstituieren (siehe Abb. 9):
Das Unternehmen (bzw. das Produkt) als RessourcengeberDie NPO (bzw. der wohltätige Zweck) als RessourcenempfängerDer Konsument als RessourcentransferauslöserMit Bezug auf das Unternehmen als Ressourcengeber betonen ARORA und HENDERSON (2007, S. 258), dass es sich bei CrM um die Aktivität des Unternehmens handelt, wodurch beim Produkt ein „embedded premium“ entsteht. Insofern ist streng genommen das Unternehmen der Initiator des CrM und das Produkt das Bezugsobjekt des „moralischen Zusatznutzens“, wie es bspw. bei der CrM-Kampagne des Nahrungsmittelherstellers Danone als Unternehmen und Volvic als Produktmarke der Fall ist. Initiator und Bezugsobjekt fallen allerdings zusammen, wenn Produkt- und Unternehmensmarke identisch sind, wie es bspw. bei der CrM-Kampagne von Krombacher der Fall ist.
Mit Bezug auf die NPO als Ressourcenempfänger betont DAW den höheren Stellenwert des wohltätigen Zwecks im Vergleich zur NPO: „The cause is the overarching driver and the nonprofit organization the vehicle for support.“ (Ebd. 2006, S. 27). Streng genommen ist daher stets der wohltätige Zweck der finale Ressourcenempfänger, da eine NPO nicht zum Selbstzweck unterstützt wird. Aus pragmatischen Gründen wird dennoch weiterhin die NPO als Ressourcenempfänger dargestellt.
Abbildung 9: Triadisches Beziehungsgefüge von CrM
(Quelle: Eigene Darstellung)
Das verbindende Element – und damit gleichzeitig auch die entscheidende Abgrenzung zu anderen Instrumenten – ist die transaktionsbasierte CrMSpende, die für alle Akteure einen unterschiedlichen Nutzen stiftet und dem Konsumenten eine tragende Rolle zukommen lässt. Basierend auf dem triadischen Beziehungsgefüge werden im Folgenden sowohl Ziele als auch Risiken von CrM für Unternehmen, NPO und Konsumenten zusammengefasst.
2.4.2 Cause related Marketing im Zielsystem des Unternehmens
2.4.2.1 Mehrwert durch Konsumenten
Die Ziele, die ein Unternehmen im Rahmen einer CrM-Kampagne durch die Reaktion der Konsumenten erreichen kann, lassen sich in einen ökonomischen und einen psychografischen Mehrwert unterteilen (siehe Tab. 6).
Tabelle 6: Mehrwert von CrM für Unternehmen durch Konsumenten
(Quelle: Eigene Darstellung)