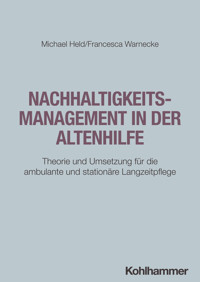
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt für die stationäre Langzeitpflege immer mehr an Bedeutung. Der Bedarf an adäquater pflegerischer Versorgung steigt bei zunehmend fehlendem Pflegepersonal. Gleichzeitig verschärfen sich die wirtschaftlichen und klimatischen Bedingungen. Extreme Wetterereignisse und Hitzewellen sind keine Seltenheit und beeinflussen sowohl die Gesundheit der Pflegekräfte als auch der pflegebedürftigen Personen. Das Praxisbuch betrachtet und beschreibt die bestehenden relevanten Gesetze sowie Richtlinien und zeigt auf, wie Einrichtungen zunehmend verpflichtet sind, umfassende Berichterstattungen zu liefern, unter der Einhaltung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der EU Taxonomie-Verordnung. Anhand zahlreicher praktischer Beispiele wird die Umsetzung eines nachhaltigen Managements, in den Einrichtungen beschrieben. Dabei werden die Finanzierungsmöglichkeiten durch Fördermittel erläutert. Dieses praxisorientierte Buch bietet einen umfassenden Überblick über die Grundlagen und Chancen, die sich aus der Schnittstelle von Pflege, Nachhaltigkeit und Klimawandel für ein nachhaltiges Management ergeben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor, die Autorin
Michael Held, B. A. Oecotrophologie, M. A. Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft, Quality Management & ESG Specialist, MEDIFOX DAN
Francesca Warnecke, Diplom Pflegewirtin (FH), Head of Quality Management & ESG, Care Specialist, MEDIFOX DAN
Unter Mitarbeit von
Matthias Appel, Partner Solidaris, Sustainability Auditor (IDW)
Wiebke Buchinger, Geschäftsführung und Heimleitung, Regensburg Seniorenstift gemeinnützige GmbH, Bürgerheim Kumpfmühl
Elke Damian, M. A. Soziologin, M. A. Diakoniemanagerin, Abteilungsleitung Fördermittelmanagement, Bergische Diakonie
Sarah Duttenhöfer, M. A. Erziehungswissenschaft: Bildung in Europa, EU-Projektmanagerin und Bildungsreferentin emcra – Co-shaping Europe
Meike Herrtwich, B. A. Betriebswirtschaftslehre, GuKP, QM-Beauftragte, Pflege im Quadrat GmbH
Michael Kraack, Heike Kraack-Tichy, Geschäftsführung emcra, emcra – Co-shaping Europe, Berlin
Panajotis Neuert, Geschäftsleitung, Pflege im Quadrat GmbH
Margarete Stöcker, M. A., M. sc., Inhaberin Fortbildungvorort-Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe
Christina Scheffczyk, Hauswirtschaftsleitung, Regensburg Seniorenstift gemeinnützige GmbH, Bürgerheim Kumpfmühl
Klaus Wessiepe, Dipl. Theologe, Dipl. Psychologe, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Bergische Diakonie
Daniel Zwick, Julia Zwick-Oppermann, Geschäftsleitung, Pflege- und Beratungszentrum Zwick
Michael Held/Francesca Warnecke
Nachhaltigkeitsmanagement in der Altenhilfe
Theorie und Umsetzung für die ambulante und stationäre Langzeitpflege
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
Bei den Abbildungen ohne Quellenangaben handelt es sich um eigene Darstellungen, welche im Auftrag der Autoren von der Grafikerin Maria Reichenauer erstellt wurden.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-044859-9
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-044860-5
epub: ISBN 978-3-17-044861-2
Danksagung
An dieser Stelle möchten wir, Michael Held und Francesca Warnecke, uns zuerst bei Margarete Stöcker, Matthias Appel und Sarah Duttenhöfer bedanken, für ihre Expertise, die Unterstützung und die zahlreichen fachlichen Gespräche während der Bucherstellung. Ohne Euch hätten wir nicht so schnell und fachlich fundiert das Buchprojekt auf die Beine stellen können. Ein weiterer Dank geht an Maria Reichenauer für die wunderbaren Grafiken. Wir danken Uwe Garbotz für die unzähligen Stunden in der Auseinandersetzung mit dem ESRS-Framework und der Wesentlichkeitsanalyse: wir stellen fest – alles ist subjektiv. Ein weiterer Dank geht an Dr. Dustin Feld von adiutaByte für die Bereitstellung der internen Daten. Zum Abschluss geht unser Dank an unsere Geschäftsführung der MEDIFOX DAN GmbH, die uns unser Herzensprojekt ermöglicht haben.
Abgrenzung und Begrifflichkeiten:
Um eine Abgrenzung zum allgemeinen Gesundheits- und Krankenhauswesen zu definieren, beziehen wir uns auf die Altenhilfe. In diesem Kontext meint die Altenhilfe alle professionell Pflegenden in ambulanten Pflegediensten und Einrichtungen in der stationären und teil-stationären Langzeitpflege.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht über das elektronische Zusatzmaterial
1 Einleitung und Ausgangslage
1.1 Nachhaltigkeit in der Altenhilfe steht noch am Anfang
1.2 Zielsetzung des Buchs
1.3 Unser Anliegen
2 Historischer Hintergrund und regionale Entwicklungen
2.1 Ursprung der Nachhaltigkeitsentwicklung
2.2 Club of Rome – die Geburtsstunde
2.3 Global bis Europa
2.4 Europa bis Deutschland
2.5 Deutschland und das Gesundheitswesen
3 Ein Blick auf die Regulatorik: Gesetze, Normen, Richt- und Leitlinien
3.1 Definition Nachhaltigkeit – Ein Wort – Eine Definition?
3.2 Abgrenzung Begrifflichkeit ESG und CSR – »same same but different«
3.3 Standards (Frameworks) zur Berichterstattung
3.4 Nachhaltigkeitsbezogene Normen für Managementsysteme
3.5 Nationale Gesetzgebung und EU-Direktive
4 Handlungsfelder des Nachhaltigkeitsmanagements
4.1 Ökologische Handlungsfelder
4.2 Soziale Handlungsfelder
4.3 Handlungsfelder auf Produktebene
4.4 Handlungsfeld Gesellschaftliches Engagement
5 CO
2
-Fußabdruck
6 Theoretische Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Pflegebranche
Matthias H. Appel
6.1 Ausgangslage
6.2 Organisatorische Herausforderungen
6.3 Risikomanagement gewinnt an Bedeutung
6.4 Ausgangspunkt Wesentlichkeitsanalyse
6.5 Schwerpunkt Pflegeimmobilie
6.6 Wirtschaftlicher Druck und Klimaschutzfahrplan
6.7 Nachhaltigkeitsberichterstattung – auch soziale Informationen gewinnen an Bedeutung
6.7.1 Soziale Risiken steuern – mit dem Fokus auf Mitarbeiter:innen
6.7.2 Offenlegungsanforderungen zur eigenen Belegschaft
6.7.3 Leistungsindikatoren zur eigenen Belegschaft
6.7.4 Soziale Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette
6.7.5 Auswirkungen auf das soziale Unternehmensumfeld
6.8 Nachhaltigkeitsbericht betrifft auch die Governance
6.8.1 Offenlegungsanforderungen zur Unternehmensführung
6.8.2 Verhinderung und Aufdeckung von Korruption oder Bestechung
7 Praktischer Teil – Aufbau und Implementierung eines integrativen Nachhaltigkeitsmanagement
7.1 Anforderungen und Chancen des Nachhaltigkeitsmanagements
7.2 Aufbau eines Integratives Nachhaltigkeitsmanagementsystem (INHMS)
7.3 Zyklus des integrativen Nachhaltigkeitsmanagements
7.3.1 Entscheidung und Initiierung des INHM
7.3.2 Bestandsaufnahme und Ist-Analyse
7.3.3 Interessengruppen/Stakeholder
7.3.4 Wesentlichkeitsanalyse
7.3.5 Strategie- und Zielformulierung
7.3.6 Maßnahmenentwicklung und -umsetzung
7.3.7 Evaluation
7.4 Nach dem Zyklus ist vor dem Zyklus: Korrekturmaßnahmen, Nachhaltigkeitsbericht und Start eines neuen Zyklus
8 Digitalisierung als Treiber für Nachhaltigkeit
9 Change-Management durch gelingende Kommunikation – Einführungskommunikation als Führungsaufgabe betrachten
Margarete Stöcker
9.1 Einführung
9.2 Change-Management
9.3 Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren von Change-Management Prozessen
9.3.1 Zielbestimmung und -konflikte
9.3.2 Anforderungen an Leitungspersonen
9.3.3 Entscheidungen abwägen und treffen
9.3.4 Sammeln Sie Ideen ihrer Mitarbeitenden
9.4 Führungsstil nach Reifegrad
9.5 Werte, Motive und Moral
9.6 Kommunikation zur gemeinsamen Verantwortung
9.6.1 Grundsätze der Kommunikation
9.6.2 Verbale und paraverbale Kommunikation
9.6.3 Nonverbale Körpersprache
9.6.4 Mimik
9.6.5 Körperhaltung und -bewegung
9.6.6 In Resonanz gehen
9.7 Persönlichkeitstypen
9.7.1 Gelingende Gesprächsführung
9.7.2 Fragen stellen
9.7.3 Aktives Zuhören
9.7.4 Paraphrasieren
9.7.5 Eigenes Verhalten reflektieren
9.8 Von der Theorie zur Praxis
9.9 Resümee
10 Fördermittelmanagement
Sarah Duttenhöfer, Michael Kraack, Heike Kraack-Tichy
10.1 Einleitung
10.2 Förderarten und Fördermittelempfänger
10.3 EU-Förderpolitik & Förderlandschaft in Deutschland im Kontext von Pflege und Nachhaltigkeit
10.3.1 EU-Förderpolitik – die Grundlagen
10.3.2 Nationale Förderpolitik in Deutschland – Überschneidungen mit dem EU-Fördersystem
10.3.3 Nationale Förderpolitik in Deutschland – Förderung von Bund, Ländern und Kommunen
10.4 Nachhaltigkeit in der Pflege – Förderpotentiale erkennen und nutzen
10.5 »Institutional Readiness« – ein funktionierendes Fördermittelmanagement aufbauen
10.6 Fazit
11 Fördergelder noch nicht ausgeschöpft – Förderung nach dem Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz (PpSG)
11.1 Fördermöglichkeiten nach PpSG
11.2 Projekt GAP – Gute Arbeitsbedingungen in der Pflege
12 Best Practice Ansätze – Erfahrungsberichte aus der Praxis
12.1 Erfahrungsbericht Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH, Bürgerheim Kumpfmühl
Wiebke Buchinger & Christina Scheffczyk
12.2 Erfahrungsbericht Pflege- und Beratungszentrum Zwick GmbH, Bargteheide
Julia Zwick-Oppermann & Daniel Zwick
12.3 Erfahrungsbericht Pflege im Quadrat GmbH
Panajotis Neuert & Meike Herrtwich
12.4 Erfahrungsbericht Bergische Diakonie
Elke Damian & Klaus Wessiepe
13 Fazit und Ausblick
14 Exkurs
14.1 Pariser Abkommen
14.2 Green Deal
14.3 Greenwashing
14.4 Pflege 4.0
15 Zusatzmaterial zum Download
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Übersicht über das elektronische Zusatzmaterial
Den Weblink, unter dem die Zusatzmaterialien zum Download verfügbar sind, finden Sie unter Kap. 15 Zusatzmaterial zum Download am Ende dieses Buches.
• Vorlage Checkliste: Bestandsanalyse einfach
• Vorlage Checkliste: Bestandsanalyse GRI/ESRS
• Vorlage Auswertungstabelle: einfache Wesentlichkeitsanalyse
• Vorlage Auswertungstabelle: doppelte Wesentlichkeitsanalyse
• Vorlage Zieldefinition
• Vorlage Maßnahmendefinition
• Vorlage Auditcheckliste: übergeordnete Themen
• Vorlage Auditcheckliste: wesentliche Themen
1 Einleitung und Ausgangslage
1.1 Nachhaltigkeit in der Altenhilfe steht noch am Anfang
Laut einer Studie des Umweltbundesamtes aus 2021 ist der allgemeine Gesundheitssektor mit 7,4 Millionen Beschäftigten einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren in Deutschland, was sich unter anderem signifikant auf den allgemeinen ökologischen Fußabdruck auswirkt. Dies hat das allgemeine Gesundheitswesen und vor allem das Krankenhauswesen erkannt und befindet sich bereits auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Zahlreiche Initiativen, Projekte und aktuelle Veröffentlichungen beschreiben Ansätze und Herangehensweisen nachhaltiger Maßnahmen im allgemeinen Gesundheitssektor.
Das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Managementsysteme gewinnt auch in den Einrichtungen der professionellen Langzeitpflege (ambulante Pflegedienste/stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Langzeitpflege) zunehmend an Bedeutung. Der demografische Wandel und die zahlreichen Folgen der Klimakrise und der Pandemie sind deutlich in den Einrichtungen spürbar. Immer mehr Menschen benötigen eine adäquate Versorgung bei fehlendem Pflegepersonal und veränderten wirtschaftlichen als auch klimatischen Bedingungen. Parallel sind die Unternehmen im Gesundheitswesen und in der Langzeitpflege mit den Herausforderungen des technischen Wandels und der digitalen Transformation Pflege 4.0 (Kap. 14) konfrontiert. Die Einrichtungen müssen sich mit neuen Technologien, künstlicher Intelligenz (KI) und zunehmenden digitalen Organisations- und Arbeitsprozessen auseinandersetzen. Zudem sind die Einrichtungen nicht nur durch die Pandemie mit aktuellen Herausforderungen wie den Energie- und Finanzkrisen oder verpflichtenden Tarifverträgen in der Pflege konfrontiert. Zahlreiche gesetzliche europäische Grundlagen werden zu nationalen Gesetzen, die für die Einrichtungen bindend sind. Durch das Hinweisgeberschutzgesetz (HinschG) und das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) sind die Einrichtungen der Langzeitpflege in einer Umsetzungsverantwortung. Dies führt unweigerlich zu veränderten Rahmenbedingungen und herausfordernden Anforderungen in den Organisationen, die es zu bewerkstelligen gilt. Um diesen komplexen Herausforderungen zu begegnen und sich zukunftssicher und wettbewerbsfähig aufzustellen, benötigt es ein handlungsleitendes, ganzheitliches und vor allem nachhaltiges Managementsystem. Der Megatrend Nachhaltigkeit ist somit im Bewusstsein der Langzeitpflege angekommen, steht jedoch noch am Anfang und kann als zartes Pflänzchen betrachtet werden (IPSOS CARE, 2022).
1.2 Zielsetzung des Buchs
Ziel dieser Veröffentlichung ist die Unterstützung ambulanter Pflegedienste und Einrichtungen der stationären Langzeitpflege bei der Erarbeitung und Implementierung eines ganzheitlichen und nachhaltigen Managementsystems. Das Buch richtet sich an alle Qualitätsmanagement-Enthusiasten und Führungskräfte, die mit der Einführung eines nachhaltigen Managementsystems betraut sind. Das Buch ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern verfolgt einen handlungsleitenden und praktischen Charakter.
Im ersten Teil werden die relevanten theoretischen (Kap. 2) und regulatorischen Grundlagen (Kap. 3) sowie die allgemeinen nachhaltigkeitsrelevanten Handlungsfelder (Kap. 4, Kap. 5) erläutert und eingeordnet.
Das Erstellen eines Nachhaltigkeitsberichts kann die Einrichtungen vor Herausforderungen stellen, insbesondere dann, wenn im Vorfeld erst die relevanten Daten zusammengestellt werden müssen. Daher wird auf die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts eingegangen und dieser erläutert (Kap. 6).
Der darauffolgende Teil bezieht sich auf die praktische Umsetzung und Einführung eines nachhaltigen Managements in Unternehmen der ambulanten Pflege und stationären Einrichtungen der Langzeitpflege (Kap. 7). Anhand geeigneter Vorlagen werden Umsetzungsmöglichkeiten exemplarisch aufgezeigt.
Die Digitalisierung als Treiber der Nachhaltigkeit wird mit seinen Kernthemen zusammenfassend dargestellt (Kap. 8).
Veränderungen bringen meist Sorgen und Ängste, aber auch Abwehr beim Personal und in den Organisationen mit sich – vor allem in den heutigen Zeiten der Krisen und des Fachkräftemangels. Gerade bei der Einführung von nachhaltigen Aspekten auf Managementebene ist eine gute Kommunikation und die Führung von Mitarbeiter:innen wichtig. Es bedarf eines guten Change-Managements. Das Kapitel Change-Management durch gelingende Kommunikation (Kap. 9) beschreibt die wichtigsten Ansatzpunkte und liefert zahlreiche Tipps und Tricks für die Praxis.
Mit nachhaltigen Systemen Krisen managen und die Zukunft sichern, kostet Geld. Doch lohnen sich die Investitionen gerade dann, wenn unter anderem Fördertöpfe zur Refinanzierung zur Verfügung stehen. Kap. 10 erläutert die Relevanz öffentlicher Fördermittel (national und europäisch) für den Pflegesektor. In Kap. 11 werden wertvolle Tipps und Tricks bei der Beantragung von Projekt- und Fördergeldern (beispielsweise nach dem Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz) vorgestellt.
Daran anschließend beschreiben Einrichtungen aus der Langzeitpflege ihre Erfahrungen bei der Einführung und Umsetzung nachhaltiger Strategien und Managementsysteme (Kap. 12).
In Kap. 13 wird ein Fazit gezogen und abschließend ein abrundender Exkurs dargestellt (Kap. 14).
1.3 Unser Anliegen
Als ausgebildete Auditor:innen, Prozess- und Qualitätsmanagemententhusiasten, CSR-Manager:innen (Corporate Social Responsibility) und Unternehmensgestalter:innen beschäftigen wir, Michael Held und Francesca Warnecke, uns bereits seit einigen Jahren mit den Trend- und Zukunftsthemen Nachhaltigkeit und Klimaschutz und dem Aufbau eines integrierten, nachhaltigen und zukunftsfähigen Qualitäts- und Managementsystems – sowohl bei unserem Arbeitgeber als auch in der Beratung von Einrichtungen in der Langzeitpflege. Uns ist es ein Anliegen unsere wertvollen praktischen Erfahrungen weiterzugeben, um die Zukunft der Pflege (mit-) zu gestalten.
2 Historischer Hintergrund und regionale Entwicklungen
Aller Anfang ist schwer, vor allem bei komplexen Themen wie der Entwicklung des Nachhaltigkeitsdiskurs und die sich daraus ergebenden Anforderungen an Unternehmen.
Zahlreiche Normen, Leit- und Richtlinien, Informationen und Systeme haben sich parallel zu den einzelnen Aspekten der Nachhaltigkeit wie Energiemanagement, Menschenrechte und menschenwürdige Arbeitsumgebung, Diversität, Umweltschutz oder Wohlergehen und Gesundheit sowie Klimaschutz oder eine nachhaltige Finanzwelt entwickelt. Diese Komplexität und die unterschiedlichen Entwicklungsströme gilt es zu verstehen und in Zusammenhang zu bringen. Die Auseinandersetzung erscheint wichtig, um ein einfaches praktikables und integriertes Nachhaltigkeitsmanagement in ambulanten Pflegediensten und stationären Einrichtungen der Langzeitpflege zu implementieren.
Für ein besseres Verständnis wird im ersten Teil des Buches die globale, europäische und nationale Nachhaltigkeitsentwicklung skizziert (Abb. 2.1). Im weiteren Verlauf werden die für die Altenhilfe relevanten und aktuellen Gesetze, Normen, Richtlinien und Standards verdeutlicht.
Der hier dargestellte theoretische Teil dient zur Orientierung und soll als Grundlage für den praktischen Teil, Aufbau eines integrierten Nachhaltigkeitsmanagementsystems (Kap. 7), dienen. Zudem kann der theoretische Teil als Nachschlagwerk genutzt werden.
Abb. 2.1: Übersicht Entwicklung der Nachhaltigkeitspolitik
2.1 Ursprung der Nachhaltigkeitsentwicklung
Der folgende Überblick über die Entstehung des Nachhaltigkeitsdiskurses verdeutlicht die unterschiedlichen Ansätze und Nachhaltigkeitsströme. Die Historie zeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit bereits seit Anfang der 1970er Jahren diskutiert wird, die Umsetzung konkreter nachhaltiger Maßnahmen jedoch erst heute Fahrt aufnimmt. Um die Relevanz für die Altenhilfe herausstellen zu können, ist es notwendig die zahlreichen globalen Vorgaben auf nationaler Ebene darzustellen und in einer Strategie für Unternehmen und Privatpersonen zu verankern.
2.2 Club of Rome – die Geburtsstunde
Blickt man auf die Historie der allgemeinen Entwicklung von Nachhaltigkeit zurück, so trifft man unweigerlich auf den Club of Rome. Bereits in den 1960er Jahren, beschäftigen sich der italienische Industrielle Aurelio Peccei und der schottische Wissenschaftler Alexander King mit der Zukunft der Menschheit und unserer Erde. Gemeinsam gründeten sie im Jahre 1968 den sogenannten Club of Rome. Im Auftrag des Club of Rome wurde 1972 eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht. Die Studie simuliert anhand eines computergestützten Rechenmodells das exponentielle Wachstum des Weltgeschehens und deren Folgen in der Zukunft. Die Berechnung bezieht sich auf den Zeitraum ab 1972 bis zum Jahr 2100 und belegt die Grenzen bis hin zu einem Weltzusammenbruch, wenn so weitergelebt würde wie im Jahr 1972.
Anhand dieses wissenschaftlichen Experimentes konnten bereits unterschiedliche Bedrohungen wie die Auswirkungen der Industrialisierung, Wachstum der Bevölkerung, Nutzung der allgemeinen Rohstoffreserven, Energiekrisen, Umweltkatastrophen und die Auswirkungen auf die Nahrungsmittelressourcen skizziert werden. Die Studie und die aufgezeigte Utopie zeigten Wirkung und erregten weltweit Aufmerksamkeit. Der Club of Rome forderte daraufhin ein radikales und nachhaltiges Umdenken. Noch im selben Jahr fand die erste Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Schweden statt, um sich mit den globalen Auswirkungen zu beschäftigen. Somit wurden die ersten Überlegungen einer internationalen Umweltpolitik auf den Weg gebracht und die Entstehung der Nachhaltigkeitsentwicklung war geboren.
Doch erst rund 15 Jahre später nahm die Diskussion um eine nachhaltige Umweltpolitik erneut Fahrt auf. 1987 veröffentlichte die UN-Kommission World Commission on Environment and Development (WCED) den sogenannten Brundtland Bericht »Our Common Future«. In diesem Bericht wurden zum ersten Mal, globale Ziele und Konzepte für die Entwicklung von Nachhaltigkeit (Sustainable Development) formuliert. Diese Definition und der Ansatz einer nachhaltigen Entwicklung gilt auch heute noch als internationaler Meilenstein, und als Auslöser für das moderne Verständnis von Nachhaltigkeit.
Auszug aus dem Brundtland-Bericht:
»[…] nachhaltige Entwicklung bezeichnet eine Entwicklung, welche den Bedürfnissen der heutigen Generationen entspricht, ohne die Möglichkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen« (Lexikon der Nachhaltigkeit, o. J.).
Ein weiterer und zentraler Meilenstein in der Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsdiskurs ist die UN-Klimakonferenz von 1992 in Rio de Janeiro. Beim sogenannten Erdgipfel oder der Konferenz für Umwelt und Entwicklung trafen sich Vertreter:innen aus 178 Staaten mit dem Ziel der Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes über die Umwelt und die weitere allgemeine Entwicklung im 21. Jahrhundert.
Erstmals wurde Nachhaltigkeit unter den Aspekten Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert und spiegelt sich in der konzeptionellen Ausgestaltung wider. Dabei sind insgesamt fünf Konzepte entstanden, die von den Ländern als Hauptabkommen oder als rechtlich bindende Konventionen unterzeichnet wurden. Neben der Biodiversitätskonvention und der Walddeklaration, werden die Deklaration für Umwelt und Entwicklung, die Klimaschutz-Konvention und die Agenda 21 definiert.
In der Deklaration über Umwelt und Entwicklung sind unter anderem 27 Prinzipien formuliert, die international auf das Recht einer nachhaltigen Entwicklung hinweisen und diese festschreiben. Die Klimaschutz Konventionen beschreiben die Reduzierung der Treibhausgase und dienen unter anderem als erste Grundlage für eine Klimaneutralität bzw. Reduzierung des Treibhausgases bis 2050. Als Schlüsselrolle und Ausgangslage für die weitere Entwicklung der Nachhaltigkeit, vor allem auch in Europa, wird unter anderem die Agenda 21 gesehen. In dieser Agenda verpflichten sich die beteiligten Staaten der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung auf nationaler Ebene.
Ausgehend von der Konferenz in Rio de Janeiro im Jahre 1992 folgen bis zum heutigen Datum weiterhin weltweit die UN-Klimakonferenzen unter Beteiligung zahlreicher Staaten, um die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Einen aktuellen und interessanten Überblick, über die einzelnen UN-Klimakonferenzen und Abkommen bietet die interaktive Zeittafel des Europaparlaments auf seiner Webseite, die URL ist im Anhang gelistet.
2.3 Global bis Europa
In den Jahren nach 1992 und der Agenda 21 sind weitere internationale Abkommen verabschiedet worden. Doch erst 2015 hat die Entwicklung der Nachhaltigkeit mit der Verabschiedung der Agenda 2030 mit den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) und dem Pariser Abkommen (Kap. 14) neuen Schwung bekommen und ein neues Zeitalter für Nachhaltigkeit und Klimaschutz hat begonnen.
Die Agenda 2030 versteht sich als globaler Plan zur Bekämpfung von Armut, Verbesserung der Gesundheit und Bildung sowie zur Reduzierung von Ungleichheiten und Stärkung des Wirtschaftswachstums bei gleichzeitigem Schutz der Umwelt. Zur Umsetzung dieses Leitbildes wurden die 17 SDGs formuliert. Die in den SGDs klar definierten Ziele bieten zum ersten Mal einen konkreten Handlungsrahmen und verdeutlichen die Verknüpfung und die Zusammenhänge der drei Aspekte Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft (Ökologie, Ökonomie und Soziales). Der Ansatz der 17 SDGs ist bis heute aktuell und prägte maßgeblich die Entwicklung der Nachhaltigkeit.
Auch, wenn die SGDs nicht bindend und eher an Regierungen als an Unternehmen gerichtet sind, können Organisationen diese als Arbeitshilfe zur Formulierung von eigenen Nachhaltigkeitszielen heranziehen und zur Identifizierung von Indikatoren für ein nachhaltiges Management und Kennzahlen nutzen.
In diesem Zusammenhang ist auch der UN Global Compact zu erwähnen. Initiiert durch die Vereinten Nationen und dem damaligen UN – Generalsekretär Kofi Anan ist der UN Global Compact ein weltweiter Zusammenschluss von Unternehmen, die sich für eine nachhaltige Entwicklung und ein nachhaltiges Management einsetzten. Rund 24.000 Unternehmen und Organisationen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft aus mehr als 170 Ländern gehören bereits zu diesem Zusammenschluss. Sie haben sich mit ihrem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit dazu verpflichtet, zehn Prinzipien zu den Themen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung umzusetzen. Die Prinzipien sind Grundlage verschiedener internationaler Arbeitsstandards.
Dabei ist es das erklärte Ziel des Global Compact, ökonomische Aktivitäten und soziale Ziele vereinbar zu gestalten, um ein nachhaltiges Wirtschaften zum Nutzen aller Menschen, Gemeinschaften und Märkte zu realisieren.
Der Global Compact versteht sich dabei nicht als zertifizierbarer Standard oder als Regulierungsinstrument. Die Prinzipien stellen Mindestanforderungen dar, welche von Organisationen in eigenen Vorgaben, Zielen etc. konkretisiert und in Ihre Arbeitsabläufe integrieren werden sollen. Die Initiative soll zudem als offenes Forum fungieren, konkrete Lösungsansätze und Verbesserungspotentiale zur Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals) im Rahmen nationaler Netzwerke entwickelt werden (UN GCD, o. J.; ICC Germany, 2023).
Auch für Europa war die Agenda 2030 ausschlaggebend den Fokus auf eine nachhaltige Entwicklung zu richten. Das Thema Nachhaltigkeit sollte zukünftig als »Kernprinzip und vorrangiges Ziel der EU-Innen- und Außenpolitik« verankert werden. Die EU hat sich zum Ziel gesetzt ein »ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept« unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele mit den Mitgliedern der EU umzusetzen (Europäische Kommission, o. J.).
Neben den Entwicklungsbestrebungen zum Thema Nachhaltigkeit wurde auch die Klimapolitik wichtiger Bestandteil der politischen Agenda. Das bereits erwähnte Pariser Abkommen legte unter anderem die Grundlagen für die Eindämmung des Klimawandels und eine klimafreundliche Weltwirtschaft. Um das Ziel der Klimaneutralität 2050 zu erreichen, wurde dazu 2019 in Europa der europäische Grüne Deal (European Green Deal) verabschiedet. Im European Green Deal (Kap. 14) sind erstmalig zahlreiche Maßnahmenpakte für die unterschiedlichen Sektoren der Wirtschaft und Industrie definiert, die zusätzlich ein nachhaltiges Finanzierungswesen unterstützen. Die Grundlagen dafür sind innerhalb des European Green Deals in den ESG-Kriterien (Environmental, Social,Governance bzw. deutsch: Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) verankert.
Zunächst gab es kein einheitliches Vorgehen für Unternehmen die einzelnen Maßnahmen in ihrer Strategie zu verankern. Die Unternehmen handelten somit aus einer freiwilligen Verpflichtung heraus, was zu kreativen Umsetzungsstrategien führte und einen großen Interpretationsspielraum zuließ. Einige bekannte Unternehmen, wie McDonalds, Lidl oder Coca-Cola, sind dadurch negativ in der Öffentlichkeit aufgefallen und haben die Diskussion bzgl. »Greenwashing« (Kap. 14) ins Rollen gebracht.
Um »Greenwashing« entgegenzuwirken und für ein einheitliches Verständnis und regulatorische Strukturen zu sorgen, hat die EU 2023 einen einheitlichen Rahmen (EU ESG-Legal / Finance Framework) beschlossen. Ein einheitliches Verständnis und Reporting soll für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit von Unternehmen sorgen und die Umsetzung der Klima- Energie und Nachhaltigkeitsziele beschleunigen. Diese Ziele können jedoch nur erreicht werden, wenn private Finanzströme zur Erreichung der umweltpolitischen Ziele eingesetzt werden (Sustainable Finance) (BMWK, 2020). Daher müssen geeignete Indikatoren bzw. Kennzahlen gefunden werden, mithilfe derer die nachhaltige Entwicklung einer Organisation bzw. die Zielerreichung in den betreffenden Bereichen gemessen werden und transparent dargestellt werden kann.
Der EU-ESG Framework unterscheidet zwischen kapitalmarktorientierten und nicht-kapitalmarktorientierten Unternehmen. Dies bedeutet, dass auch Unternehmen in der Altenhilfe, ambulante Pflegedienste oder Einrichtungen der stationären Langzeitpflege, entweder aufgrund der Größe (Anzahl der Mitarbeitenden) oder aufgrund ihres Jahresumsatzes betroffen sind. Diese Einrichtungen fallen unter die Regularien einer Nachhaltigkeitsberichterstattung, sowie dem Ableiten von Nachhaltigkeitsmaßnahmen und Integration in ein Managementsystem.
2.4 Europa bis Deutschland
Deutschland setzt sich ebenfalls für die Umsetzung der Agenda 2030 ein. Auf Basis der Agenda 2030 und den SDGs und des European Green Deals hat Deutschland eine Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) entwickelt. Zuletzt wurden am 10.03.2021 weitreichende Weiterentwicklungen der im Jahr 2002 erstmals eingeführten Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen. Es wurden neue Indikatoren aufgenommen (z. B. in Bezug auf die globale Pandemie-Prävention, Väterbeteiligung beim Elterngeld oder der Breitbandausbau), sodass die DNS nun 39 Bereiche mit insgesamt 75 Indikatoren und Zielen enthält (Bundesregierung, 2021).
Auf der Seite des statistischen Bundesamtes sind die einzelnen Indikatoren mit ihren Zielen abgebildet und einsehbar. Die Indikatoren orientieren sich an den übergeordneten 17 Zielen der SDGs und stellen die Verbindung zwischen Deutschland und Europa her. Regelmäßig werden entsprechende Indikatorenberichte erstellt und veröffentlicht. Darüber hinaus wurden zahlreiche Maßnahmen definiert sowie nationale Grundlagen und Richtlinien geschaffen. Die Bundesregierung hat zum Ziel, die DNS alle vier Jahre zu aktualisieren. Die aktuelle Fassung aus dem Jahr 2021 befindet sich bis Herbst 2024 in Aktualisierung. Bis Ende 2024 soll eine neue Fassung vorliegen. Die Bundesregierung hat dazu die Bürgerinnen und Bürger und Vertreter:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik aufgerufen, sich in einem Bürgerdialog an der Aktualisierung zu beteiligen.
Um den Nachhaltigkeitsgedanken weiter zu stärken wurden z. B. das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), das Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz (LkSG), Hinweisgeberschutzgesetz (HinschG) und diverse weitere Arbeits- und Umweltschutzgesetze eingeführt (Hinrichs, 2023).
2.5 Deutschland und das Gesundheitswesen
Inzwischen sind die Themen rund um Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch im allgemeinen Gesundheitssektor angekommen. Gleich doppelt ist der Gesundheitssektor mit den Themen konfrontiert. Der Gesundheitssektor zählt mit 7,4 Millionen beschäftigten Personen zu einem der wichtigsten Wirtschaftssektoren in Deutschland (Umweltbundesamt [UBA], 2021). Laut dem Health Care´s Climate Footprint Report aus 2019 ist der weltweite Gesundheitssektor für 4,4 % der globalen Nettoemission verantwortlich. In Deutschland fallen rund 5 % an Emissionen im Gesundheitssektor an, wobei ein Großteil unter anderem auf den Kliniksektor, Medizinprodukte und Hilfsmittel sowie den daraus resultierenden Lieferketten zurückzuführen ist. Der Gesundheitssektor hat somit signifikanten Auswirkungen auf den bundesweiten CO2-Fußabdruck und die Klimabilanz.
Des Weiteren ist das Personal in den Gesundheitsberufen mit den Auswirkungen der Pandemie, Klima und Energieriese sowie dem demographischen Wandel in der täglichen Arbeit konfrontiert. Immer mehr Menschen benötigen eine adäquate Versorgung bei Personalknappheit und veränderten wirtschaftlichen sowie klimatischen Bedingungen. Aufgrund der Agenda 2030 und der Verpflichtung der Bundesregierung zu Klimaneutralität bis 2050 ist der Gesundheitssektor ebenfalls in der Verantwortung sich mit nachhaltigen Maßnahmen auseinanderzusetzen (Abb. 2.2).
Insbesondere für den Krankenhaussektor, Krankenkassen, Arztpraxen, Apotheken und Unternehmen aus dem Heath Care Sektor gibt es bereits Projekte und Initiativen zu nachhaltigen Aspekten und Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Das Wuppertaler Institut und die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V. haben im Dezember 2022 eine Handlungsempfehlung für ein klimaneutrales Krankenhaus herausgegeben. In diesem Zielbild sind konkrete Handlungsempfehlungen für Krankenhäuser formuliert, die sich auf den Weg machen klimaneutral zu werden.
Die Initiative Klimaneutraler Gesundheitssektor 2023 hat sich zum Ziel gesetzt, Gesundheitseinrichtungen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu begleiten und zu motivieren. In einer Rahmenempfehlung beschreibt die Initiative die wichtigsten Handlungsfelder für den Transformationsprozess zu einem klimaneutralen Gesundheitssektor.
Bereits 2017 wurde ein Netzwerk aus allen Akteuren des Gesundheitsbereichs gegründet: Die deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz KLUG. Das Netzwerk möchte über die gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise aufklären. Durch unterschiedliche Projekte, wie Bildungsangebote und Öffentlichkeitsarbeit sollen die Gesundheitsberufe befähigt werden, die Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft umzusetzen.
Das Projekt Klimaretter – Lebensretter wurde mit Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz durch die Stiftung viamedica ins Leben gerufen. Ziel ist Klimaschutz im Gesundheitswesen nachhaltig zu verankern. Für das Projekt wurde ein Online Tool mit 26 bereits vordefinierten Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz entwickelt. Die Mitarbeiter:innen der teilnehmenden Einrichtungen führen die Aktionen durch und sehen die direkten Auswirkungen auf den CO2-Fußabdruck.
Eckhard von Hirschhausen unterstützt mit seiner Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen, gemeinsam mit der BARMER Krankenkasse, den »Deutschen Nachhaltigkeitspreis Gesundheit«. Bereits seit 2008 wird der deutsche Nachhaltigkeitspreis in Industrie und Wirtschaft vergeben. Ab 2024 wird dieser um die Kategorie Gesundheitswesen erweitert. Ziel ist die Förderung von Nachhaltigkeitskonzepten im Gesundheitswesen.
Abb. 2.2: Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die Gesundheit
Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) veröffentlicht im April 2023 das Positionspapier »Nachhaltiges Handeln in der Pflege ist nötig und möglich«. Der DBfK sieht die Pflegepersonen als größte Berufsgruppe des Gesundheitswesens ebenfalls in der Verantwortung in den unterschiedlichen Pflegesettings einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu leisten. Dabei bezieht sich der Berufsverband auf den International Council of Nurses (ICN)-Ethikkodex, der besagt:
»Pflegefachpersonen setzten sich gemeinsam dafür ein, die natürliche Umwelt zu erhalten, zu stärken und zu schützen. Sie sind sich der gesundheitlichen Folgen der Umweltzerstörung, z. B. aufgrund des Klimawandels bewusst. Sie treten für Initiativen ein, die umweltschädliche Praktiken reduzieren, um Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern« (DBfK, 2021).
Neben der klaren Position des DBfKs hat sich eine weitere Initiative auf den Weg gemacht, Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Gesundheitswesen zu verankern. Health for Future (H4F) ist ein Zusammenschluss von nachhaltig interessierten Personen aus dem Gesundheitswesen. Aus Selbstverständnis engagieren sie sich für ein klimaneutrales und resilientes Gesundheitswesen (H4F, 2022).
Insgesamt ist zu beobachten, dass der Krankenhaussektor sich durch unterschiedliche Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausemissionen auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft befindet. Auch scheinen die zahlreichen Initiativen und Projekte insgesamt zu einer positiven Entwicklung für das Bewusstsein von Nachhaltigkeit und Klimaschutz im allgemeinen Gesundheitswesen beizutragen. Im ambulanten Sektor und der stationären Langzeitpflege (Altenhilfe) hingegen erscheint das Thema Nachhaltigkeit noch als ein zartes Pflänzchen. Erst Anfang des Jahres 2023 und der gesetzlichen Verpflichtung zur Einführung eines Hinweisgeberschutzsystems und der Umsetzung des LkSGs ist das Thema Nachhaltigkeit präsenter im Altenhilfesektor. Dies spiegelt sich auch im Care Trendreport des Forschungsinstituts Ipsos CARE aus 2022 wider. Daraus geht hervor, dass das Thema Nachhaltigkeit im Pflegemarkt (Altenhilfe) als »omnipräsent und zukunftsrelevant und erfolgsentscheidender« Megatrend wahrgenommen wird, sich jedoch noch ganz am Anfang befindet (IPSOS CARE, 2022).
3 Ein Blick auf die Regulatorik: Gesetze, Normen, Richt- und Leitlinien
Der kurze Blick in die Historie der allgemeinen Entwicklung des Nachhaltigkeitsdiskurs verdeutlicht die Komplexität und die Vielfältigkeit. Mindestens genauso komplex und vielfältig sind die Gesetze, Normen, Richt- und Leitlinien, die aus den einzelnen Entwicklungsströmen hervorgegangen sind.
Um die Regulatorik besser verstehen und differenzieren zu können, bedarf es einer detaillierten Betrachtungsweise. Für das Verständnis wurden die relevanten Grundlagen analysiert und systematisiert. Daraus ergibt sich eine Einteilung in gesetzliche Grundlagen, Standards zur Berichterstattung und Normen, sowie die EU-Regulatorik, die auf nationaler Ebene bindend ist. Des Weiteren wird in diesem Kapitel auf zentrale Begriffsdefinitionen eingegangen.
3.1 Definition Nachhaltigkeit – Ein Wort – Eine Definition?
Das Wort Nachhaltigkeit ist derzeit in der Politik, Wirtschaft und im Gesundheitswesen präsent wie nie zuvor. Jedoch erscheinen eine einheitliche Definition und ein gemeinsames Verständnis nicht einfach. Die existierenden Definitionsansätze sind zahlreich und je nach Überlegung und Einfluss der unterschiedlichen Ideen und Entwicklungsströme unterscheiden sich die Schwerpunkte in der Definition, wobei die übergeordneten Themen Ökologie, Ökonomie und soziale Aspekte einbezogen werden.
Der bekannteste Ansatz Nachhaltigkeit zu definieren, stammt aus dem Brundlandt-Bericht (1987). Nachhaltigkeit wird dabei als eine Entwicklung verstanden, die es der heutigen (und späteren) Generation ermöglicht, ohne Gefährdung, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.
Eine weitere pragmatische Betrachtung von Nachhaltigkeit ist auf den ursprünglichen Gedanken von Hans Carl von Carlowitz zurückzuführen. Es sollte nicht mehr verbraucht werden als ursprünglich vorhanden. Mit diesem Ansatz revolutionierte von Carlowitz die Forstwirtschaft bereits im 18 Jahrhundert (Lexikon der Nachhaltigkeit, 2015).
Eine solitäre Betrachtung des Wortes Nachhaltigkeit erscheint somit für ein allgemeines Gesamtverständnis nicht auszureichen und vor allem zum heutigen Zeitpunkt, aufgrund der Entwicklung, nicht mehr sinnvoll. Die bisherige Betrachtungsweise könnte daran liegen, dass in der Vergangenheit ein nachhaltiges Handeln als Selbstverpflichtung von Einzelpersonen und Unternehmen gesehen wurde.
Der Begriff Nachhaltigkeit ist vielmehr die Summe aus Allem und sollte ganzheitlich betrachtet werden. Neben den drei übergeordneten Kernelementen, Ökologie, Ökonomie und soziale Aspekte, ist Nachhaltigkeit ein integratives Gesamtkonzept aus den unterschiedlichen Elementen, Entwicklungsströmen und Zielen, die in Wechselwirkung miteinander stehen.
In der bereits vorhandenen Literatur wird oftmals auf das »Nachhaltigkeits-Haus« hingewiesen. Die folgende Grafik stellt nun die Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffs als ein ganzheitliches Konzept dar (Abb. 3.1). Es zeigt die unterschiedlichen Ansätze mit ihren Wechselwirkungen.
Abb. 3.1: Gesamtkonzept Nachhaltigkeit
3.2 Abgrenzung Begrifflichkeit ESG und CSR – »same same but different«
Im Kontext von nachhaltigen Konzepten oder Systemen werden meist zwei Begrifflichkeiten genannt: CSR (Corporate Social Responsibility) und ESG (Environmental Social Governance).
Beim CSR-Ansatz integrieren Unternehmen soziale und ökologische Aspekte in ihre Unternehmenstätigkeit. Die dahingehenden Maßnahmen werden auf freiwilliger Basis durchgeführt und gehen über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus (Europäische Kommission, 2011). Der CSR- Ansatz legt den Fokus eher auf qualitative Anteile.
3.3 Standards (Frameworks) zur Berichterstattung
Standards oder Frameworks geben eine Orientierung vor, um ein Nachhaltigkeitsmanagement mit Berichtserstattung aufzubauen. Aufgrund eines ähnlichen Aufbaus und sich überschneidenden Inhalten wird Vergleichbarkeit und Transparenz hergestellt. Die bekannten Standards erleichtern somit den Einstieg und geben Sicherheit die relevanten Themen nicht zu vergessen.
Zu den bekanntesten Standards gehören:
• Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK)
• UN Global Compact
• Global Reporting Initiative (GRI)
• Sustainable Development Goals (SDG)
• Standard Nachhaltiger Wirtschaft des Zentrums für Nachhaltige Unternehmensführung (ZNU)
• Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)
Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK)
Der DNK soll Unternehmen aller Rechtsformen und Größen, als branchenübergreifender Standard, einen Leitfaden zur Berichterstattung bieten. 20 Kriterien und 28 Leistungsindikatoren zu den Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales konkretisieren den Nachhaltigkeitsbegriff und richten damit den Blick auf das Wesentliche.
Bei den Kriterien und Indikatoren handelt es sich um eine Auswahl aus den umfassenden Leitfragen der Global Reporting Initiative (GRI) und der European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS). Die Anwender:innen berichten in einer DNK-Erklärung, wie sie die Kriterien des Kodex erfüllen (comply) oder erörtern plausibel, warum ein Kriterium nicht berichtet werden kann (explain) (RNE 2020). Die 20 Kriterien sind in die vier Bereiche Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft untergliedert (Tab. 3.1).
Tab. 3.1: Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex
Dieser Standard eignet sich in der Anwendung für kleine - und mittelständigen Unternehmen und ist in Deutschland bisher einer der bekannten Standards.
UN Global Compact
Die Entstehung und der Ursprung des UN Global Compact wurde im Kap. 2.3 beschrieben. Die 10 Prinzipien des UN Global Compact (Tab. 3.2) basieren auf der Annahme, dass »unternehmerische Nachhaltigkeit mit einem Wertesystem im Unternehmen« beginnt und sich auf einen »prinzipiengestützten Geschäftsansatz« stützt (UN Global Compact, o. J.).
Als Grundlage für die 10 Prinzipien dienen:
• die allgemeine Erklärung der Menschenrechte
• die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit
• die RIO- Erklärung zur Umwelt und Entwicklung
• das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption
Tab. 3.2: Übersicht der 10 Prinzipien UN Global Compact (o. J.) den vier Grundlagenbereichen zugeordnet
Global Reporting Initiative (GRI)
Der international bekannteste und zeitgleich auch der umfassendste Standard ist die GRI.
Die GRI wurde 1997 in Boston (USA) durch einen Zusammenschluss der gemeinnützigen Organisation Coalition for Environmentally Responsible Economy (CERES) mit dem Tellus Institute und unter Beteiligung des United Nations Environment Programme (UNEP) gegründet und verlegte 2002 den Hauptsitz nach Amsterdam (Niederlande). Das Ziel der GRI war die Entwicklung eines ersten Rechenschaftsmechanismus, der die Unternehmen zu einer Verantwortungsübernahme im Umweltbereich bewegen sollte. Im Laufe der Zeit wurden soziale und ökonomische Themen hinzugefügt ebenso wie zum Thema Governance (GRI, 2023a).
Die erste Version der GRI-Richtlinien (G1) wurde im Jahr 2000 veröffentlicht und wurde bis 2013 dreimal erweitert und angepasst (G4). Seit 2016 stellt die GRI nicht mehr Richtlinien bereit, sondern legt die globalen Standards für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung fest. Die GRI-Standards (GRI, 2023a), untergliedern sich in drei universelle Standards sowie themenspezifische Standards (GRI, 2023b):
• In den Grundlagen (GRI 1) werden die Grundlagen der Berichterstattung und der Aufbau sowie die Anwendung der Standards beschrieben
• Die Standards 2 bis 3 thematisieren Governance-Themen wie z. B. Organisationsprofil, Strategien, Unternehmensführung, Einbindung von Stakeholdern, Wesentlichkeit der Themen, Ziele, Maßnahmen und der Beurteilung derer Wirksamkeit
• Die Themenstandards beinhalten Angaben zu Auswirkungen der Organisation in Bezug auf
– ökonomische Themen (GRI 200-Reihe)
– ökologische Themen (GRI 300-Reihe)
– soziale Themen (GRI 400-Reihe)
In Tab. 3.3 werden die einzelnen Themenfelder aufgeführt.





























