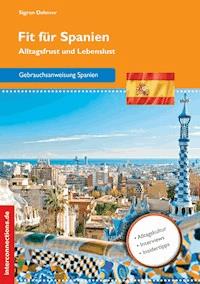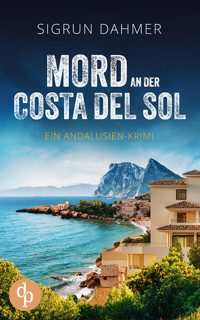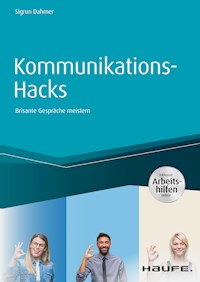5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Niemand schwört so einfach der Liebe ab …
Die gefühlvolle und romantische Komödie zum Lachen und Verlieben
Als die jazzbegeisterte Bea zufällig auf eine Kontaktanzeige stößt, die in ihrem Namen verfasst wurde, platzt ihr der Kragen. Ihre beste Freundin Emily steckt dahinter, obwohl sie wissen muss, dass Bea diese Verkupplungsversuche so satt hat! Als Angestellte bei einer Künstlervermittlung für Alleinunterhalter und Schlagersänger ist sie mehr als zufrieden. Da muss sie weder dem Mann hinterherweinen, der sie damals sitzen gelassen hat, noch Nachhilfe in Sachen Liebe nehmen, findet sie. Doch die Dating-Szene ist hart und gerade als Bea der Männerwelt wirklich für immer abschwören will, lernt sie den attraktiven und scharfzüngigen Karikaturisten Lars kennen. Der wiederum scheint jedoch nur Augen für ihre Freundin Emily zu haben …
Dies ist eine Neuauflage des bereits unter dem Pseudonym Liv Larson erschienenen Titels Wer zuletzt liebt… liebt am besten.
Erste Leser:innenstimmen
„Humorvoll, unterhaltsam, aber auch immer wieder tiefgründig!“
„Mit viel Wortwitz und Herz erzählt.“
„Aus dem Leben gegriffenes Liebeschaos – ein toller Liebesroman für den Frühling!“
„Charmante Charaktere, flüssiger Schreibstil und eine romantische Geschichte.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Kurz vorab
Willkommen zu deinem nächsten großen Leseabenteuer!
Wir freuen uns, dass du dieses Buch ausgewählt hast und hoffen, dass es dich auf eine wunderbare Reise mitnimmt.
Hast du Lust auf mehr? Trage dich in unseren Newsletter ein, um Updates zu neuen Veröffentlichungen und GRATIS Kindle-Angeboten zu erhalten!
[Klicke hier, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!]
Über dieses E-Book
Als die jazzbegeisterte Bea zufällig auf eine Kontaktanzeige stößt, die in ihrem Namen verfasst wurde, platzt ihr der Kragen. Ihre beste Freundin Emily steckt dahinter, obwohl sie wissen muss, dass Bea diese Verkupplungsversuche so satt hat! Als Angestellte bei einer Künstlervermittlung für Alleinunterhalter und Schlagersänger ist sie mehr als zufrieden. Da muss sie weder dem Mann hinterherweinen, der sie damals sitzen gelassen hat, noch Nachhilfe in Sachen Liebe nehmen, findet sie. Doch die Dating-Szene ist hart und gerade als Bea der Männerwelt wirklich für immer abschwören will, lernt sie den attraktiven und scharfzüngigen Karikaturisten Lars kennen. Der wiederum scheint jedoch nur Augen für ihre Freundin Emily zu haben …
Dies ist eine Neuauflage des bereits unter dem Pseudonym Liv Larson erschienenen Titels Wer zuletzt liebt… liebt am besten.
Impressum
Überarbeitete Neuausgabe März 2022
Copyright © 2025 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-98637-595-9 Taschenbuch-ISBN: 978-3-98637-607-9
Copyright © 2019, dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2019 bei dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH erschienenen Titels Wer zuletzt liebt… liebt am besten (ISBN: 978-3-96087-741-7).
Covergestaltung: Herzkontur – Buchcover & Mediendesign unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com: © Le Panda, © Julia August, © Iya Balushkina, © Nebula Cordata, © Reinke Fox, © flowerstock, © Vectorry Lektorat: Sofie Raff
E-Book-Version 05.06.2025, 10:04:33.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
TikTok
YouTube
Nachhilfe in Sachen Liebe
Kapitel eins: Schneekugel ohne Schnee
Das Problem: Ihr lebt in verschiedenen Städten.
Don't: Jammern! Fernbeziehungen sind trendy und sexy.
Do: Freu dich! Bei getrenntlebenden Paaren nutzt sich die Liebe nicht so schnell ab, vermutlich befeuert die Distanz sogar die Erotik zwischen euch!
(Mehr dazu im ultimativen Beziehungsguide: So optimierst du dein Liebesleben, 17,50 Euro)
Freitagabend … und schon flog Philips Seiden-Hängerchen, das er in seiner Berliner Lieblingsboutique für mich erstanden hatte, in den Schrank zurück.
Püppchen?
War ich ein Püppchen?
Nein. Mit neununddreißig Jahren fühlte ich mich zu alt für diese sauteuren Flatterfetzen. Vor allem im Winter und erst recht bei der so unvorteilhaft blass machenden LED-Weihnachts-Beleuchtung, mit der offenbar sämtliche Restaurantbesitzer Bochums neuerdings ihre Innenräume ausgestattet hatten. Aber das steife, langärmlige Etuikleid, das ich mir stattdessen vor die Brust hielt, konnte mich auch nicht so recht überzeugen. Meine Stirn legte sich beim Anblick meines Spiegelbildes in Falten. In diesem Outfit käme ich ähnlich charmant rüber wie Frau Merkel bei einer Gedenkminute im Bundestag. Unzufrieden klemmte ich mir eine meiner widerspenstigen Haarsträhnen hinter das Ohr. Also, ein wenig frecher dürfte das Outfit für unser romantisches Abendessen schon sein. Als wir uns kennengelernt hatten, hatte Philip mein Aussehen immerhin einmal mit dem der jungen Juliette Binoche verglichen. Sehr schmeichelhaft, zumal er dabei diskret über meine Riesennase hinweggesehen hatte. Er muss wirklich sehr verliebt gewesen sein, denn die einzigen drei Gemeinsamkeiten, die ich zwischen ihr und mir sehen konnte, waren:
Wir stammten beide aus Frankreich
Genau wie Binoches berühmteste Filmrolle hatte ich ein Faible für Schokolade (nicht, dass das unter Frauen ein Alleinstellungsmerkmal wäre).
Wir waren beide brünett.
Doch das war dann auch schon alles. Nervös schaute ich zum wiederholten Male auf den Wecker. Eine Armbanduhr trug ich aus Prinzip nicht, wobei ich zugeben muss, dass sich mein Ansatz vor allem bei der Arbeit nicht wirklich als praktikabel erwies. Zum Glück hatten sich die anderen Kollegen mittlerweile an meinen Spleen gewöhnt. Judith, unsere Sekretärin, nannte meinen Stil sogar anerkennend „Old School“, während Moritz, der Jüngste in unserem Team, schon längst der Ära der Armbanduhren entwachsen war und automatisch sein Handy zückte, wenn er nach der Uhrzeit gefragt wurde. Insgesamt fielen meine kleinen Macken in meinem Arbeitsumfeld nicht weiter ins Gewicht.
In der Künstlervermittlung, in der ich angestellt war, gab es nämlich noch weit schrägere Typen als mich. „Applaus“ gehörte meinem Onkel Pièrre. Wir betreuten hauptsächlich Alleinunterhalter und Schlagersänger, eine Musikrichtung, die zwar privat nicht zu meinen Favoriten gehörte, die dafür aber umso mehr dem Geschmack meines Onkels entsprach. Als gewitztem Inhaber und leutseligem Chef in Personalunion ging Pièrre ein gutes Arbeitsklima über alles. Er würde niemandem unnötige Steine in den Weg legen. Dementsprechend fand er meinen Versuch, ohne das Diktat der Uhr leben zu wollen, auch „nonchalant“, wohingegen Philip die Idee als einfach nur kindisch abtat.
Schon zehn nach sieben! Die Zeit, die mir für meinen Kampf mit dem Kleiderschrank blieb, wurde langsam knapp. Es war einfach unfair: Gestandene Männer in unserem Alter hatten es in puncto Kleidung so viel leichter als wir Frauen. Eine gut geschnittene Hose, ein schickes Hemd und fertig. Herrenkonfektionsgrößen mussten nicht einmal anprobiert werden: Auswählen, Etikett lesen und ab zur Kasse. Philips Hemden saßen jedenfalls immer perfekt. Meine Freundin Emily hatte letztens, nachdem sie ihm zufällig am Bahnhof begegnet war, von ihm als einer „sexy Schnitte“ gesprochen. Mir blieb es ein Rätsel, wie er es schaffte, dass seine Kleidung nach der langen Fahrt von Berlin bis ins Ruhrgebiet niemals auch nur den kleinsten Kaffeeflecken oder die winzigste Falte aufwies. „Das ziemt sich so für einen wertebewussten Politiker“, klärte er mich auf. „Ein tadelloses Äußeres und ein angemessenes Gefühlsmanagement gehören eben zu den ungeschriebenen Spielregeln.“ Seine Einstellung trug nicht gerade dazu bei, dass ich mich bei meiner Kleidungswahl entspannte.
Unmotiviert probierte ich eine beige Hose an. Nude look, total in, top modern. Aber dazu passte nur die knallrote Bluse hinten links und die war ein echtes No-Go für Philip, wenigstens in der Öffentlichkeit. Privat hatte er gegen gewagte Kleidung nichts einzuwenden. Im Gegenteil … Aber nein, keine rote Bluse.
Mein Handy piepste. Langsam begann ich panisch zu werden. Eine Nachricht von Emily. Eigentlich meldete sie sich selten per Handy, doch leider hatte sie die Whats-App-Funktion „Medieninhalte verschicken“ neu für sich entdeckt. Seitdem schickte mir das verrückte Huhn ständig Ratschläge aus ihrer „Bibel“, irgend so einem völlig überbewerteten Beziehungsratgeber. Ich warf einen kurzen Blick aufs Display. Was sollte das? Die Gute sollte mich mal lieber mit passenden Klamottentipps versorgen, denn ich begann langsam zu verzweifeln. Es war wie verhext. Als hätte sich die gesamte Modewelt gegen mich verschworen! Warum konnte ich mich ausgerechnet heute nicht entscheiden?
Seit Philip sein Kommen angekündigt hatte, wurde ich das Gefühl nicht los, dass er mir endlich ganz offiziell einen Antrag machen wollte. Schließlich waren wir schon gut zwei Jahre zusammen. Kennengelernt hatten wir uns damals auf einem Straßenfest. Ich betreute dort zwei unserer Künstler namens „Das Malle-Duo“. Die beiden gehörten zu unseren beliebtesten Stimmungskanonen und mussten entsprechend hofiert werden.
Philip hatte nach der Schließung der Opelwerke beruflich in Bochum zu tun. Auf dem Fest sprach er mich unter dem Vorwand an, unser Duo engagieren zu wollen. Ich verwies ihn souverän an Pièrre, der ihn gleich überredete, seine PR von unserem Familienunternehmen machen zu lassen. Ich belauschte fassungslos die Schacherei am Telefon, während mir mein Onkel verschwörerisch zuzwinkerte. Erst als Pièrre, Philip und ich uns in den darauffolgenden Tagen mehrmals zusammensetzten, um die Details zu besprechen, ging mir auf, wie perfide mein Onkel vorgegangen war. Es kam, wie es kommen musste, und nach der dritten Besprechung verabschiedete Philip sich mit einem langen Kuss von mir. So hatten wir uns kennengelernt. Na, wenn das keine gute Story für unsere Kinder war!
Obwohl meine Vorahnung mich schon den ganzen Tag über in einen freudigen Erregungstaumel versetzt hatte, gestattete ich es mir dennoch nicht, mir die romantischen Details des Antrags auszumalen. Dazu war ich zu misstrauisch, eindeutig ein Erbe meiner verstorbenen Mutter. Was hätte ich dafür gegeben, ihr Philip noch vorstellen zu können! Als gebürtige Südfranzösin wäre sie begeistert von seinem Charme und seiner Eleganz gewesen. Doch leider war maman bereits einige Monate, bevor Philip und ich uns auf besagtem Straßenfest kennengelernt hatten, gestorben. An Krebs. Ich hatte lange um maman getrauert, wenn ich ehrlich war, tat ich es eigentlich noch heute. Aber gleichzeitig wusste ich ganz genau, dass sie unsere Hochzeit vom Himmel aus nicht nur gutheißen, sondern sie auch überglücklich mitfeiern würde. Lächelnd zog ich mir erneut das Etuikleid à la Merkel an und stellte mir meine stolze maman mit Petrus in einer schwungvollen Walzerdrehung vor. Doch in diesem Moment beendete das Klingeln meines Festnetztelefons abrupt alle weiteren Träumereien. Mist, bitte keine Anrufe! Nicht jetzt! Ich musste mich doch noch schminken und überhaupt …
Meinem Apparat war das völlig egal. Unbeeindruckt von meiner Zeitnot klingelte er erneut. Das nervte. Wo hatte ich den dummen Hörer denn nur hingelegt? Während ich hektisch das Regal absuchte, breitete sich einen Moment lang Stille aus, bis der Anrufbeantworter schließlich mit einem lauten Klick ansprang. Eine tiefe Männerstimme räusperte sich umständlich … Philip.
Ob sein Zug Verspätung hatte? Jetzt sah ich, dass der Hörer unter dem Stuhl lag. Ich war kurz davor, ihn aufzuheben und dranzugehen, als mich Philips seltsam belegter Tonfall davon abhielt.
„Ähm, tut mir leid, Béatrice, wenn du schon zu unserem Treffen unterwegs sein solltest. Ähm, was ich …“ Komisch, mein eloquenter Geliebter mied normalerweise ein „ähm“ ebenso konsequent wie ein Veganer das Steakhaus.
„Also, was ich dir sagen wollte. So leid es mir auch tut, aber aus unserer Verabredung wird nichts.“ Wie um die abgehackte Sprechweise vom Anfang des Telefonats wettzumachen, sprach Philip jetzt so schnell, dass die Silben Purzelbäume zu schlagen drohten.
„Du hast das sicherlich schon selbst gemerkt. Das mit uns passt nicht. Bochum und Berlin, das konnte auf lange Sicht nicht gut gehen. Schon gar nicht mit meinen Verpflichtungen. Ich habe einfach keine Zeit für dich. Weder jetzt noch in Zukunft. Tut mir leid. Du musst mich übrigens auch nicht zurückrufen. Bin die nächsten drei Wochen nicht in Berlin. Nur im Umland. Wahlkampf, du weißt schon. Also, noch alles Gute für dein weiteres Leben. Vielleicht …“
Ein durchdringender Piepton erklang, Philips Sprechzeit war abgelaufen.
Merkwürdig distanziert, wie in einem Film, hatte ich sein Gestotter über mich ergehen lassen. Es fühlte sich so an, als würde mich das Ganze gar nicht selbst betreffen. Ich war lediglich eine unbeteiligte Zuschauerin einer fremden Liebestragödie, wohnte in einer weihnachtlichen Schneekugel, die jemand zu wild geschüttelt hatte. Mit einem Mal kam ich mir seltsam leer und verbraucht vor. Eine Schneekugel ohne Flocken. Die Welt um mich herum erschien mir unwirklich, irgendwie gedämpft. Als befände ich mich hoch oben über den Wolken oder tief unten auf dem Meeresgrund. In Slow Motion näherte ich mich dem Telefonhörer, hob ihn auf und rief Philip zurück. „Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Versuchen Sie es später noch einmal.“ Erschöpft setzte ich mich kurz auf den Rand des frisch bezogenen Bettes. Danach stand ich wieder auf und begann, mich kraftlos aus dem Etuikleid zu pellen. Anschließend schlüpfte ich in meine bequeme geblümte Pyjamahose. Die Kleidungsfrage jedenfalls hatte sich geklärt.
Kapitel zwei: Todesspritze und Rettungsring
Das Problem: Dein Schatz meldet sich nicht zum vereinbarten Zeitpunkt.
Don't: Vorschnelle Schlüsse ziehen! Besser ist es, deine Gefühle zu unterdrücken
Do: Höchstwahrscheinlich gibt es eine einfache Erklärung. Bleib geduldig und positiv: Männer sind eher Schweiger als Redner. Sie brauchen Anerkennung und Loyalität, geben dir aber im Gegenzug Sicherheit und Vertrauen.
(Mehr dazu im ultimativen Beziehungsguide: So optimierst du dein Liebesleben, 17.50 Euro)
Warum hatte Philip seinen letzten Satz nur mit vielleicht begonnen? Die ganze lange schlaflose Nacht hindurch zerbrach ich mir den Kopf über dieses eine Wort. Nachdem ich mich Ewigkeiten im Bett hin- und her gewälzt hatte, kam ich zu dem Schluss, dass es noch Hoffnung für uns gab. War es denn nicht durchaus möglich, dass Philip das Gesagte noch hatte zurücknehmen wollen? Seine Wiedergutmachung war vielleicht einfach nur der kurzen Aufnahmezeit zum Opfer gefallen. Schicksal! Nichts als ein großes technikbedingtes Missverständnis! Diese Überlegung tröstete mich immerhin so weit, dass ich in den frühen Morgenstunden noch ein wenig Schlaf finden konnte.
Als mein Wecker am Samstagmorgen klingelte, war ich sofort hellwach. Neuer Morgen, neue Hoffnung, Bea, sprach ich mir Mut zu. Mit etwas Glück gewinnst du ihn zurück. Ich atmete einmal tief durch. Als ich die Vorhänge aufriss, erwartete mich ein weiterer hässlich trüber, verregneter Wintertag. Wie sollte es auch anders sein? So war Deutschland eben im Dezember. Ich ging entschlossen in die Küche. Bevor ich zur Tat schritt, wollte ich mich erst einmal stärken. „Essen fassen“, befahl ich mir und stopfte gleich darauf hemmungslos einen halben Schokonikolaus und ein Marzipanbrot als Frühstück in mich hinein. Zum Abschluss vernichtete ich noch die Tüte Lebkuchenherzen, die ich Montag eigentlich mit in die Künstleragentur hatte nehmen wollen. Jetzt war das nötige Zuckerlevel erreicht, um meinen Plan, Philip anzurufen, in die Tat umzusetzen. Tapfer nahm ich den Hörer von der Station.
Mit zitternden Fingern tippte ich auf die eingespeicherte Nummer. Beim ersten Mal erwischte ich den falschen Eintrag, beim zweiten Mal legte ich auf, sobald das erste Tuten ertönte. Beim dritten Mal jedoch hielt ich heldenhaft durch bis ich mit dem Anrufbeantworter verbunden wurde. Sonst nichts. Philip ging einfach nicht ran. Okay, nicht aufgeben! Ein Schlachtplan musste her! Ich würde jetzt systematisch wie ein Kriegsminister vorgehen! Und so setzte ich den ganzen Tag hindurch immer zur vollen Stunde einen Anruf ab. Ohne Erfolg! Mein Wecker zeigte bereits Mitternacht, als ich wie in der Nacht zuvor völlig frustriert ins Bett ging.
Sonntagmorgen. Ich stand sofort auf und versuchte es erneut. Diesmal auf nüchternen Magen, noch halb im Schlaf, vor der ersten Tasse Kaffee. Vielleicht wäre ich ohne meine übliche Dosis Koffein ruhiger, könnte meine Verhandlungen so friedvoll wie Mutter Teresa führen. Doch wieder nahm niemand ab. Nicht einmal Philips Anrufbeantworter ließ sich dazu herab, mit mir zu sprechen. Er war voll.
Ich war verzweifelt. In mir war eine große Leere. Wie sollte ich diesen Tag nur überleben? Ich legte mich wieder ins Bett, zog die Knie ans Kinn und ließ den Kopf hängen. Doch statt mich zu beruhigen, durchrollte mich eine Welle heißer Wut. Was für ein Schwein! Was fiel ihm ein, mich so zu behandeln? Er hatte noch nicht einmal den Anstand zu einer Aussprache von Angesicht zu Angesicht besessen. Ich griff nach der roten Bluse, die noch über dem Stuhl hing, knüllte sie zusammen und warf sie zornig in die Ecke. War das zu fassen, dass Philip mich nach zwei Jahren einfach so abservierte? Per Anrufbeantworter! Ging’s noch mieser? Ich sprang auf und lief nervös auf und ab. Mein Gott, wir wollten doch zusammenziehen, suchten bereits seit einem Jahr eine passende Wohnung in Berlin! Ohne Ankündigung fingen meine Knie zu zittern an, mein Magen krampfte sich zusammen und mein Herz schlug so heftig, dass mein Brustkorb zu platzen drohte. Bevor ich völlig zusammenbrach, hatte ich Erbarmen mit mir selbst: Ich nahm mehrere Schlaftabletten auf einmal und ließ mich erneut auf das Bett fallen.
Als ich am Montagmorgen mit einem dumpfen Schädel aufwachte, fühlte ich mich noch immer wie gerädert, obwohl mein Wecker mir unmissverständlich anzeigte, dass ich den ganzen restlichen Sonntag und die Nacht auf Montag durchgeschlafen hatte. Glückwunsch: Ich hatte das erste Wochenende ohne Phil überlebt. Plötzlich hatte ich einen Geistesblitz. Es war zehn Uhr am Montagmorgen, ein stinknormaler Arbeitstag hatte begonnen. Ich arbeitete Gleitzeit und musste mich zum Glück nicht hetzen. Warum versuchte ich nicht einfach, Philip im Büro der Berliner Parteizentrale an den Apparat zu bekommen?
„Parteizentrale Berlin, Kriener am Apparat“. Hut ab. Die Sekretärin rasselte den ganzen Spruch herunter, ohne auch nur einmal Luft zu holen.
„Guten Tag, Frau Kriener. Hier Béatrice Dupont. Könnten Sie mich bitte mit Philip Schatta verbinden?“ Ich klopfte mir innerlich auf die Schulter. Ich klang den Umständen entsprechend professionell.
„Einen Moment bitte.“ Angespannt lauschte ich Frau Krieners Atem. Mein Herz fing erwartungsvoll an, schneller zu schlagen.
„Hören Sie? Herr Schatta befindet sich für unbestimmte Zeit auf Dienstreise. Auf Wiederhören.“
Das durfte nicht wahr sein! Selbst die Sekretärin hatte mich abserviert. Eiskalt! Und jetzt? Wo sollte ich nur hin mit meinem Liebeskummer? Das ganze Wochenende lang hatte ich mich gegen das Schicksal aufgebäumt, hatte versucht, das Missverständnis zu klären. Doch mittlerweile musste ich mir eingestehen, dass sein Schlussmachen kein „unglücklicher Zufall“ gewesen war. Philip hatte ganz bewusst jeglichen Kontakt unterbunden und eine einseitige Entscheidung getroffen, die ich akzeptieren musste. Meine Schonfrist war abgelaufen. Jetzt galt es, der Welt mitzuteilen, dass Philip und ich Geschichte waren.
Und dann meldete sich noch eine andere Stimme in meinem Kopf. Sie sprach Französisch und zischelte mir ins Ohr, mit neununddreißig sei es allerhöchste Zeit, endlich unter die Haube zu kommen. In dem heiseren Tonfall, der typisch für maman war, fügte sie hinzu: „insbesondere, wenn du noch ein gesundes Kind in die Welt zu setzen gedenkst.“ Wie konnte es angehen, dass die beschränkte Weltsicht meiner Mutter noch immer einen derart großen Einfluss auf mein Leben ausübte, obwohl ich mittlerweile schon selbst eine gestandene Frau war? Ich wollte das nicht hinnehmen und kämpfte dagegen an, diesen fürchterlichen Glaubenssätzen aus meiner Kindheit Macht über mich zu geben. Stattdessen zwang ich mich, das Ganze weiterhin logisch anzugehen. Es stand viel Arbeit an, jetzt, da ich mein Leben ohne Philip neu ordnen musste. Am liebsten hätte ich mich sofort bei ‚Applaus‘ krankgemeldet. Da ich sonst nie fehlte und noch einen Haufen Überstunden abzufeiern hatte, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Allerdings wusste ich selbst nicht, wie ich dann die liegengebliebenen Jobs am nächsten Tag noch on top bewältigen sollte. Auf keinen Fall wollte ich sie unserer Sekretärin Judith aufhalsen. Okay, beschloss ich zähneknirschend, ich werde jetzt meine Gefühle gut wegsperren und in den normalen Alltag zurückkehren.
Ich schluckte. Würde ich ihn nie mehr wiedersehen, nie mehr seine Haut auf meiner spüren? Ja, ich befahl mir, der hässlichen Wahrheit ins Gesicht zu blicken: Genau das bedeutete es!
Flucht in die Arbeit war zwar nicht gerade eine originelle Strategie zur Bewältigung von Liebeskummer, aber akzeptabel, solange sie funktionierte. Ich gab mir noch eine Stunde, um in einen halbwegs arbeitsfähigen Modus umzuschalten. Tränen schossen mir in die Augen. Ich kam mir unendlich klein und hilflos vor. Warum nahm mich jetzt niemand in den Arm?Wieso kam keiner vorbei und überraschte mich mit einer Flasche Rotwein und einer lustigen DVD? – Ganz einfach, meldete sich mein Verstand voller Selbstmitleid: Weil keiner da ist! Und es stimmte tatsächlich: Niemand meiner Freunde war dem grönemeyerschen Lokalpatriotismus gefolgt und unsere Heimatstadt treu geblieben. Außer mir waren alle, die mir etwas bedeuteten und mich jetzt hätten stützen können, Hals über Kopf aus 4630 Bochum geflohen. Meinen Bruder Fred hatte es seit seinem Medizinstudium nach „Kölle am Rhing“ verschlagen und meine alte Schulfreundin Em hatte ihr Glück nicht tief im Westen, sondern im tiefen Süden, im malerischen Überlingen am Bodensee gefunden. Mir wurde schlecht vor Sehnsucht nach Em und meinem dreijährigen Patensohn Lenny. Dennoch konnte ich mich nicht überwinden, noch einmal zu telefonieren. Zum Glück gab es ja auch noch Internet.
Doch zu früh gefreut: Fünf Minuten, nachdem ich Em mein Leid gemailt hatte, rief sie mich auf dem Festnetz an. Klar, das war typisch für sie. Em besaß zwar ein Handy, aber sie benutzte es nur selten (hauptsächlich, wie gesagt, um mich mit klugen Sprüchen zu nerven). Meist lag es dekorativ mit leerem Akku auf ihrem wackeligen Beistelltisch herum. Eigentlich misstraute sie Whats App und Co. E–Mails schreiben war schon mehr ihr Ding, aber am allerliebsten nutzte sie nach wie vor das Festnetz. Ich zögerte kurz, ging dann aber doch dran. Schon seltsam: Mal war das Telefon eine Todesspritze, mal ein Rettungsring.
„Hallo“, meldete ich mich tonlos.
„Oh nein, Liebes, was muss ich da lesen?“
Ich brachte sie knapp auf den neuesten Stand und fing zwischendurch immer wieder an zu weinen. Überrascht nahm ich wahr, dass Em am anderen Ende ebenfalls laut seufzte. Fassungslos stammelte sie immer wieder, was für ein schönes Paar wir gewesen waren. Sie wirkte, als habe man ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. Die Situation war regelrecht absurd! Mitgefühl unter Freundinnen sollte eine Selbstverständlichkeit sein und so war es auch zwischen uns, aber dass meine Trennung Emily dermaßen aus dem Konzept brachte, verunsicherte mich dann doch etwas.
„Ich hätte es besser wissen müssen“, beschuldigte sie sich selbst. „Politiker sind Schlangen und Philip ist da mit Sicherheit keine Ausnahme. Das Leben ist so ungerecht. Wie soll es jetzt nur weitergehen?“ Mir kamen schon wieder die Tränen. Gleichzeitig befremdete mich Ems melodramatischer Tonfall. Hallo? Das war mein Liebeskummer! Doch meine Freundin ließ sich nicht unterbrechen. Sie hatte sich in Fahrt geredet.
„Wie kann er dir das antun und deine gesamte, sorgfältig geplante Zukunft innerhalb von zwei Minuten in den Mülleimer kippen? Du hättest alles für ihn aufgegeben, wärst für ihn sogar nach Berlin gezogen!“
„Ja, das stimmt. Ich hatte das schon alles mit Pièrre geklärt.“ Nervös lief ich mit dem Hörer durch das Zimmer und erinnerte mich an das Gespräch mit meinem Onkel. „Wir haben vereinbart, dass ich per Home-Office von Berlin aus arbeiten und nur alle zwei, drei Monate für wichtige Geschäftsgespräche nach Bochum pendeln würde.“ Ich machte eine Pause und ließ mich aufs Bett plumpsen. Dann holte ich tief Luft: „Weißt du, mir war schließlich von Anfang an klar, dass ich, wenn ich mit Philip zusammenleben will, nach Berlin umziehen muss. Als Politiker muss er im Zentrum des Geschehens sein. Und der Ort, an dem die große Politik gemacht wurde, heißt eindeutig nicht Bochum.“
Meine Freundin lachte höflich.
„Ach, Em, es hätte durchaus funktionieren können!“ Ich sah mich vor meinem inneren Auge auf einer bunten Krabbeldecke in unserer großzügig geschnittenen Altbauwohnung sitzen und geduldig mit unseren Kindern spielen. Em schien ähnlichen Fantasien nachzuhängen.
„Ihr habt ja bereits nach einer gemeinsamen Wohnung gesucht“, stimmte sie mir zu.
„Wäre, hätte, Fahrradkette.“ Ich lachte bitter auf. „Jetzt verstehe ich auch, warum die besichtigten Apartments nicht gut genug für Philip waren. Keine Wohnung hatte eine echte Chance …“
„Denn dein angeblicher Zukünftiger wollte sich in Wahrheit gar nicht binden“, führte Em meinen schmerzhaften Gedanken zu Ende. Die Tränen liefen mir die Wangen herunter.
„Zumindest nicht an mich“, schniefte ich. „Verdammte Scheiße. Ich war für ihn nur so eine Art Stolperstein in seiner Karriere. Zu wenig vorzeigbar, nicht repräsentativ genug.“
„Ach, Unsinn. Der sollte sich geschmeichelt fühlen, dass ihm eine so tolle Frau wie du überhaupt eine Chance gegeben hat.“ Ihr Lob tat mir gut.
„Was machst du denn während der Weihnachtstage?“ Em ging meine Probleme jetzt mit ruhigem Pragmatismus an. Ich war ihr dafür überaus dankbar, denn ich selbst konnte kaum einen klaren Gedanken fassen.
„Ähm, Philips Eltern haben mich letzten Sommer bei unserer ersten Begegnung eingeladen, die Weihnachtstage mit ihnen in ihrem Wintergarten zu verbringen.“ Damals hatte ich bei diesen Worten einen inneren Freudentanz hingelegt. Während ich meinen Erinnerungen nachhing, hörte ich durch das Telefon eine Ladenklingel läuten.
„Sorry“, erklärte Em. „Kundschaft. Ich muss Schluss machen. Aber du hörst von mir. Weihnachten feierst du bei uns und dann fängst du Neujahr nochmal ganz von vorne an. Und ich verspreche dir: Wenn ich dich wieder aufgepäppelt habe, wirst du durchstarten wie eine Rakete … Ja, ja, ich komme schon … Kopf hoch, meine Schöne!“
„Danke“, sagte ich mit zittriger Stimme. Emily war großartig. Es hatte mir richtig gutgetan, mit ihr zu reden. Mir ging es bereits viel besser. Wie gut, dass ich eine Freundin wie sie hatte. Sie war wirklich die beste, netteste Freundin, die man sich vorstellen konnte. Unkompliziert und ein bisschen verrückt. Ich hatte tatsächlich große Lust, sie zu besuchen. Wir hatten immer so viel Spaß zusammen. Und ich war eine der wenigen, die auch um ihre dunkle Seite wusste. Em hatte eine düstere Familiengeschichte als Adoptivkind hinter sich, über die sie fast nie sprach, obwohl sie sie sehr geprägt hatte. Ich lehnte mich nachdenklich mit dem noch immer warmen Hörer in der Hand zurück.
Em war etwas Besonderes, stets auf Hochtouren und dabei nah dem Abgrund. Wir hatten uns bereits in der Grundschule kennengelernt. Obwohl sie zwei Jahre älter war als ich, waren wir immer in dieselbe Klasse gegangen. Das hing wohl damit zusammen, dass sie durch ihr soziales Umfeld entwicklungsverzögert war und erst später eingeschult wurde. Mir war das damals völlig egal, als Kind merkt man nicht, wenn bei den Klassenkameraden etwas schiefläuft. Allerdings fiel mir später als Teenie schon auf, dass Emily seltsam verquere Vorstellungen von der Liebe hegte. Für mich malte sie sich, wie auch heute bei unserem Telefonat, eine perfekte Bilderbuch-Zukunft aus. Für sich selbst sah sie schwarz und hatte dann auch tatsächlich eine Serie glückloser Beziehungen mit den seltsamsten Typen. Aus einer ihrer zahlreichen Affären resultierte mein Patensohn Lenny. Ich wusste bis heute nicht, aus welcher. Da Em sehr attraktiv war, mangelte es nie an interessierten Männern. Eine Blondine nach der sich jeder, egal ob Mann oder Frau, umdrehte. Früher war ich manchmal eifersüchtig gewesen, doch mittlerweile glaubte ich, dass ihre Attraktivität für sie eher ein Fluch und nicht gerade hilfreich für ihr verkorkstes Liebesleben war. Mit Erik zum Beispiel, ihrer jüngsten Eroberung, hatte sie sich wieder mal so einen typischen Blender angelacht. Das Schlimmste war, dass er meine Freundin nicht wertschätzte. Dabei war Emily ihm zuliebe sogar nach Überlingen gezogen, obwohl sie sich mit dem provinziellen Leben in der badischen Kleinstadt oft schwertat. Bei dem Gedanken an meine Besuche bei ihr in Süddeutschland musste ich unvermittelt grinsen. Zum Glück hatte sie sich bislang wenigstens noch nicht diesen gewöhnungsbedürftigen Dialekt angeeignet: „adele“ und „sodele“. Ich schmunzelte und hatte plötzlich große Lust, sie in ihrem „Lädele“ zu besuchen und Weihnachten am Bodensee zu verbringen.
Halbwegs aufgeräumt machte ich mich gegen elf Uhr auf den Weg zu unserem Unternehmen. Ich setzte mich an meinem vertrauten Schreibtisch an den Computer und machte mich an die Arbeit. Alle paar Minuten erreichten mich per E-Mail mehr oder weniger originelle Sprüche von Em. Natürlich fehlte weder der von den anderen Müttern, die ebenfalls schöne Söhne haben, noch ein weiteres überflüssiges Zitat aus ihrer BB, ihrer heiligen Beziehungsbibel. Im Grunde genommen war meine Freundin trotz all ihrer Macken ein echter Schatz. Zu schade, dass sie schlappe 600 Kilometer von Bochum entfernt wohnte. Digitale Medien konnten zwar viel, aber Händchenhalten und eine Schulter zum Ausweinen gehörten nicht dazu.
Ich öffnete eine längere E-Mail von Em, in der sie mir in höchsten Tönen von Weihnachten vorschwärmte. Ich überflog ihre Zeilen: Schubkarren voller Schnee, kaum Touristen. Ein Weihnachtsbaum im Blumentopf geschmückt mit Lennys Bastelarbeiten. Kakao ohne Ende für meinen Patensohn und jede Menge Rotwein für uns. Wir würden es uns so richtig gemütlich machen, versprach sie. Es klang wirklich verlockend. Alles war besser, als während der Feiertage allein mit Liebeskummer herumzuhängen und Trübsal zu blasen. Ich hätte mich natürlich auch bei meinem Bruder Fred in Köln blicken lassen können, aber der war mit seiner ruhigen Art nicht gerade eine Stimmungskanone. Die wilde, chaotische Em würde da die bessere Medizin für mich und mein angeschlagenes Selbstbewusstsein sein. Und mein Patensohn Lenny erst recht. Der forderte hundert Prozent Aufmerksamkeit ein, ihm war es egal, ob das Schicksal mich gerade k.o. geschlagen hatte. Doch bevor ich meine Zelte im Ruhrpott abbrechen und die mit Erinnerungen übersättigten Orte für ein paar Tage hinter mir lassen konnte, musste ich in unserem Familienunternehmen erst noch einmal ordentlich ranklotzen. Das war ich meinem Onkel schuldig. Ich wollte Pièrre unter gar keinen Umständen hängen lassen. Schließlich war im Dezember in der Welt des Marketings Hochsaison: Friede, Freude, Kundenbindung hieß die Devise. Vor Weihnachten war es immer besonders anstrengend. Doch das kam mir nun gerade recht. In der Hektik vor den Feiertagen würde ich vielleicht ab und zu mein gebrochenes Herz vergessen können.
Kapitel drei: Pflichtbesuche
Das Problem: Er hat dich sitzengelassen.
Don't: Grübeln!
Do: Lenk dich ab, kümmere dich um deinen beruflichen Erfolg und zeig dich offen für Überraschungen!
(Mehr dazu im ultimativen Beziehungsguide: So optimierst du dein Liebesleben, 17.50 Euro)
In den folgenden Tagen bemühte ich mich mit aller Kraft, unsere Kunden beim Warten auf das Christkind zu unterstützen. Meine Strategie funktionierte. Ich funktionierte. Durch meine vollgestopften Arbeitstage überlebte ich die erste Woche nach der Trennung erstaunlich gut. Als ich abends Ems Beziehungs-Bibelzitat, diesmal als E-MailAnhang, las, grinste ich. Ach nee! Auf den Trick, bei Liebeskummer härter zu arbeiten, war ich ganz von allein gekommen. Mir blieb auch nichts anderes übrig, denn unser Nikolaussack quoll vor Arbeit nur so über. Die Kunden wollten mit persönlichen Weihnachtskarten und kleinen Präsenten umworben werden. Großkunden forderten unsere beliebtesten Showacts für ihre Firmenfeiern an, die merkwürdigerweise alle auf dasselbe Datum zu fallen schienen.
Ein weiterer, allgemein verhasster Termin stand bereits für das kommende zweite Adventswochenende auf der Agenda: Der Förderverein des Bertolt-Brecht-Gymnasiums hatte zu seiner traditionellen Weihnachtsfeier im Brauhaus geladen. Da „Applaus“ das fünfzigjährige Schuljubiläum inklusive Hüpfburg, Tombola und Schlager zum Mitgrölen organisierte, mussten wir uns bei der feuchtfröhlichen Feier selbstverständlich blicken lassen. Die Frage war nur, wer von uns verpflichtet werden würde, am Samstag den Kopf hinzuhalten. Natürlich würde mein Onkel Pièrre als Inhaber unseres Familienunternehmens hingehen und eigentlich wäre Moritz dieses Jahr an der Reihe gewesen, ihn zu begleiten – schließlich war er neben mir und unserer Sekretärin Judith der einzige Festangestellte in unserem kleinen Team. Doch leider hatte Moritz rechtzeitig vorgebaut und sich unter einem fadenscheinigen Vorwand vom Acker gemacht. Typisch! Die freien Mitarbeiter, erklärte mir mein Onkel am Freitagvormittag geduldig, wolle er mit solchen unangenehmen Zusatzaufgaben gar nicht erst behelligen. Ich war genervt, dass schon wieder Überstunden auf mich zukommen sollten. Erst vor zwei Monaten hatte ich meinen Ersten-Hilfe-Schein für die Agentur aufgefrischt. Ich ahnte Böses und sollte Recht behalten. Kurz vor Feierabend tauchte Pièrre erneut neben meinem Arbeitsplatz auf. „Béatrice, ich befürchte, dass es uns beide trifft. Judith kann uns auch nicht begleiten. Wir werden morgen Abend in der Brauerei die Fahne hochhalten müssen.“
Ich drehte mich zu ihm um. Ich mochte Pièrre, nicht nur, weil der ältere Bruder meiner Mutter fast zu einem Vaterersatz für meinen Bruder und mich geworden war. Er war derjenige, der uns alle damals, nachdem unser leiblicher papa unsere kleine Familie in Marseille hatte sitzen lassen, kurzerhand mit sich nach Deutschland genommen hat. Ich war damals gerade fünf Jahre alt und wurde in Deutschland eingeschult, während Fred mit neun bereits in Frankreich zur Schule gegangen war. Eine Zeit, die er nicht vermisste.
Hätte Pièrre uns nicht unterstützt, wäre unsere ledige, alleinerziehende Mutter in Frankreich mit Sicherheit verzweifelt. Mein Bruder würde Pièrre für diese Entscheidung ewig dankbar sein. Frédéric hatte nie viel für sein französisches Erbe übrig gehabt und war in Deutschland dann auch flugs zu „Fred“ mutiert. Ich selbst sah das alles etwas anders. Doch ganz abgesehen von unserer privaten Familiengeschichte, bewunderte ich meinen Onkel auch in seiner Funktion als Chef. Er war gerecht und verzichtete weitgehend auf Machtspielchen. Meistens jedenfalls.
„Sorry, Bea, aber du hast keine Wahl. Der Vorsitzende des Fördervereins, Herr Steinkötter, hat bereits deine erste Fassung des Bühnenprogramms gelesen und die Liederauswahl in höchsten Tönen gelobt. Er besteht darauf, auf dem Fest mit dir persönlich anzustoßen. Ich weiß, du hast es nicht so mit Smalltalk, aber …“
Ganz besonders nicht, nachdem ich gerade von meinem Zukünftigen sitzen gelassen worden bin, fügte ich in Gedanken hinzu, widersprach Pièrre jedoch nicht.
„… aber du weißt ja: Übung macht den Meister. Oder wie die Amerikaner sagen: Fake it till you make it.“
So gut Pièrre auch Deutsch und Französisch sprach, sein Englisch hörte sich schauderhaft an und war wegen seines starken Akzents kaum zu verstehen. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, immer mal wieder ein paar englische Wörter einzuflechten.
„Jedenfalls“, nahm er den Faden wieder auf, „ist es ungeheuer wichtig, dass du deine gesellschaftlichen Umgangsformen erweiterst!“ Ich schaute ihn fragend an, doch mein Onkel vermied den Augenkontakt. Er schien sich unwohl zu fühlen. „Für die Zukunft, glaub mir. Sieh den Abend einfach als Training an! Du kannst jetzt übrigens auch Schluss machen.“ Und weg war er.
Kurz darauf, als ich das Büro ebenfalls verlassen wollte, nahm mich Judith, unsere elegante Sekretärin, etwa zehn Jahre jünger als mein Onkel, zur Seite. „Es tut mir leid, dass ich euch nicht begleiten kann“, entschuldigte sie sich. „Aber als eine Art Entschädigung könnte ich dir nächste Woche ein bisschen Gesangstraining anbieten. Erinnerst du dich, du hattest mich doch mal um eine Stunde gebeten?“
Ich schaute sie verwirrt an. Hatte ich das? Obwohl mir die Schlager, mit denen ich beruflich zu tun hatte, nicht gefielen, liebte ich Musik. Die französischen Chansons von Piaf, Kaas, Zaz ebenso wie die alten Jazzstandards, aber … Dann fiel mir ein, warum Judith mich auf eine Gesangsstunde ansprach: Ich hatte meiner Mutter als Geburtstagsüberraschung kurz vor ihrem Tod einen ihrer Lieblingschansons vortragen wollen und Judith um ein paar Gesangstipps gebeten. Doch dann ging es mit maman schneller als erwartet bergab und mein Plan hatte sich zerschlagen. Mein Gott, das war schon ewig her!
Ich schüttelte den Kopf. „Aber nein, Judith. Danke für das Angebot. Deine Unterstützung wäre zwar schön gewesen, aber wir stemmen das auch ohne dich. Und natürlich bist du mir nichts schuldig. Weißt du, für Musik habe ich im Moment überhaupt keinen Sinn.“
Judith musterte mich, als warte sie darauf, ob ich noch fortfahren wollte. Ich schwieg. Was gab es sonst noch dazu zu sagen? „Okay“, setzte sie langsam an und wählte ihre Worte mit Bedacht. „Also, mir würde es schon Spaß machen, mal ein Stündchen zusammen mit dir zu singen. Unser kleiner Chorauftritt bei der Weihnachtsfeier letztes Jahr hat dir damals doch gut gefallen oder täusche ich mich? “
Ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, denn ich hatte bei dem Fest, wie ich mir peinlicherweise eingestehen musste, ein paar Gläschen Sekt zu viel genossen. Eigentlich ein Fauxpas, der besser zu einer unerfahrenen Praktikantin gepasst hätte, aber ich war gerade liebestrunken von einem romantischen Kurztrip aus Berlin zurückgekommen, sodass ich meine guten Manieren während der Feier ausnahmsweise unter den Tisch hatte fallen lassen. Nichts, an das ich erinnert werden wollte. Und schon gar nicht, nachdem Phil mich hatte sitzen lassen. Schnell unterbrach ich Judith. „Das können wir gerne machen, vielleicht nächstes Jahr, nach den Feiertagen, wenn sich der Stress gelegt hat.“
„Oh nein“, widersprach sie mir sanft. „Gerade jetzt, in Stresszeiten, ist das Singen umso wichtiger. Komm doch einfach übermorgen vorbei und berichte mir haarklein alles über die Weihnachtsfeier mit den Paukern. Ich würde ja zu gerne Mäuschen spielen, um zu sehen, ob die eine Neuauflage der Feuerzangenbowle im Brauhaus feiern.“
Pauker? Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann? Ab und zu merkte man Judith ihr Alter wirklich an.
„Du kannst meine neuste Plätzchenkreation ausprobieren, ich mache uns einen schönen starken Milchkaffee und zwischendurch schmettern wir ein Liedchen.“
Das Telefon läutete. Judith legte die Hand auf den Hörer und sah mich fragend an. Mit einem Mal hatte ich Mitleid mit ihr. Vielleicht hatte unsere Sekretärin einfach Sehnsucht nach Gesellschaft. Bevor ich es mir anders überlegen konnte, nickte ich. Sie hob den Daumen nach oben und nahm das Gespräch an, während ich nach Hause ging.
Und so kam es, dass ich den Vorabend des zweiten Advents in einem Bochumer Brauhaus und den Adventssonntag bei unserer Sekretärin verbringen sollte. Dumm gelaufen!
Was soll's, sprach ich mir halblaut Mut zu, als ich pflichtbewusst am Samstagabend um Punkt zwanzig Uhr vor dem Brauhaus stand. Ich kämpfte tapfer meine Fluchtinstinkte nieder und trat ein. Die Bedienung war schlecht gelaunt und grüßte nicht zurück. Der Gerechtigkeit halber musste ich jedoch auch zugeben, dass ich für nichts in der Welt mit ihr hätte tauschen wollen, denn das Fachwerkhaus war vollständig mit Betriebsfeiern belegt.
Konnte es etwas Unangenehmeres geben als von der Chefetage aufgezwungene Geselligkeit? Unwillig betrat ich einen der reservierten Säle. Mir schlug eine Mischung aus Essensduft, vorwiegend Rotkohl, Nikotin und Schweiß entgegen. Der Lärmpegel war ähnlich wie auf einem Flughafen und das Gedränge fast noch schlimmer. Überall lange Tische und gekünsteltes Lachen – ich wäre am liebsten sofort wieder gegangen. Meine Partystrategie „Wo ist hier eigentlich das Klo?“ würde ich an diesem Abend auch nicht überstrapazieren dürfen. Denn selbst wenn es einen anderen Anschein hatte: Das hier war ein ernstzunehmender Geschäftstermin zum Zweck der Beziehungspflege. Ich schaute mich gründlich in Saal eins um. Kein einziges bekanntes Gesicht, ich konnte weder den Vorsitzenden des Fördervereins, Herrn Steinkötter, noch Pièrre ausmachen. Ich fing schon an, mich zu freuen, als mir der Wirt erbarmungslos mitteilte: „Oben gibt es auch noch eine Etage.“
Ich quälte mich die Treppen hinauf und dann sah ich auch schon die drei Tischreihen, die von der Bertolt–Brecht–Schule reserviert worden waren. Blitzschnell sondierte ich die Lage. Sollte ich mich neben die blutjunge magersüchtige Referendarin mit modischer Skinny Jeans setzen? Oder neben die in Würde ergraute Gemeinschaftskundelehrerin, die mindestens zehn Jahre mehr als ich auf dem Buckel hatte? Außerdem gab es noch einen freien Stuhl an der Seite eines vollbärtigen, dicken Mathelehrers, der schon demonstrativ gutmütig auf den Platz neben sich klopfte: „Grüß Gott!“
„Hallo“, flüstere ich höflich, während ich neben ihn rückte. Dann schob ich noch dynamisch ein: „Alles gut?“ nach. Ob man mir meinen Beruf auch so ansah? Eher nicht. Was man den Lehrern zu viel, sah man mir zu wenig an. Ich verhielt mich so unbeholfen, dass mir niemand zutrauen würde, dass ich Schlagersänger promoten und Events organisieren konnte. Doch das konnte ich. Und zwar gut! Egal, im Moment reichte es, überhaupt hier zu sein und gesehen zu werden. Schon das fiel mir schwer, schließlich hatte maman ihrem Töchterchen immer gepredigt, es solle sich stets im Hintergrund halten. Ihr im Befehlston geflüstertes „tais-toi“, schweig still, hatte mich meine ganze Kindheit hindurch begleitet. Es klang für mich wie das gefährliche Zischeln einer Schlange. Doch spätestens seit der Grundschule wollte ich statt unsichtbar und still lieber so beliebt, unbefangen und natürlich wie Em sein. Diese Brauhaus-Situation etwa würde Emily zweifellos spielend bewältigen. Sie würde leicht wie ein Schmetterling von Tisch zu Tisch fliegen und den Abend in vollen Zügen genießen. Ich hingegen tat mich mit der ganzen angeschickerten Heiterkeit um mich herum fürchterlich schwer.
In diesem Augenblick erhob sich ein kleiner, dicklicher Mann mit beginnender Rundglatze und winkte mir stürmisch zu. Das war wohl der Vorsitzende des Fördervereins. Sein Fuchteln wurde immer hektischer. Sollte das heißen: „Hauen Sie bloß ab!“ oder, was wahrscheinlicher war: „Bitte, setzen Sie sich doch neben mich“? Nichts lieber als das, signalisierte ich ihm mit einem schiefen Lächeln, ergab mich in mein Schicksal und wechselte den Platz.
„Herr Steinkötter! Ich bin Béatrice Dupont. Schön, dass wir uns jetzt persönlich kennenlernen.“ Pièrre zwinkerte mir zu. Er hatte sich strategisch geschickt einen Stuhl mit vielen offenen Fluchtwegen am Kopfende des Tisches gesichert. Wann konnte ich diesen Ort des Schreckens frühestens verlassen? Mein Geist fiel in eine Art Winterschlaf, meine social skills jedoch arbeiteten im Turbo-Modus, während die Stunden sich unerbittlich in die Länge zogen.
Das Gespräch verlief jedoch erträglich. Herr Steinkötter stellte die erwarteten Fragen zu den geplanten Jubiläumsvorbereitungen, ich gab ihm die erwarteten Antworten. Meine Nick- und Lachfrequenz war dabei so hoch, dass meine Gesichtsmuskulatur bereits Rheuma bekam. Doch mein Einsatz lohnte sich. Sie haben Ihr Ziel erreicht, lobte ich mich in Gedanken. Herr Steinkötter schien zufrieden zu sein und leitete endlich den amüsanten Teil des Abends ein.
Ich versuchte einen unauffälligen Blick auf Pièrres Armbanduhr zu erhaschen, als er aufstand – wahrscheinlich, um auf die Toilette zu gehen. Um ein Haar hätte ich mir bei diesem Manöver den Hals verrenkt! Ich wartete und wartete, aber Pièrre kam nicht mehr zurück. War eigentlich untypisch für ihn, dass er ging, ohne sich zu verabschieden. Wie sollte ich mich denn jetzt ohne ihn verdünnisieren? Dann war es endlich viertel nach zehn, falls ich die Digitalanzeige am Handgelenk des Kellners richtig entschlüsselt hatte. Was machten Schönheitsköniginnen in kritischen Situationen? Sie befreiten sich elegant, indem sie salbungsvoll einen universalen Segensspruch von sich gaben: „Ich liebe euch alle und wünsche mir Frieden auf Erden.“ Ich beschloss, es ihnen gleich zu tun, stand auf und rief etwas zu laut und fröhlich in die Runde: „Irgendwer muss ja den Anfang machen. Noch einen schönen Abend!“ Und dann geschah das Unvermeidliche: Als ich mich schwungvoll umdrehte, riss ich meinen Stuhl mit, der polternd zu Boden fiel. Typisch! Mit hochrotem Gesicht verdrückte ich mich und bezahlte meine Getränke. Dabei sah ich, dass auch Pièrres Anteil an der Tischrechnung noch ausstand. Seltsam. Verwundert beglich ich auch seine Rechnung. Zu Hause schrieb ich Herrn Steinkötter eine Dankesmail, in der ich ihn wissen ließ, wie sehr mir der nette Abend im Brauhaus gefallen habe. Ich speicherte die Nachricht ab, um sie gleich am nächsten Morgen verschicken zu können.
Der zweite Pflichttermin, den ich wahrnahm, bevor ich mich nach Süddeutschland abseilte, war mein Besuch bei Judith. Zaghaft drückte ich am nächsten Tag auf ihre Klingel. Bis jetzt war ich noch nie bei ihr gewesen. Sie öffnete mir die Tür mit einem so strahlenden Lächeln, dass ich fast schon ein schlechtes Gewissen bekam, nicht schon früher einmal vorbeigekommen zu sein. Sie trat zur Seite und ich schob mich inklusive meiner Jacke und meinem aufwendig in Folie verpackten Christstern vorsichtig durch den schmalen Türrahmen. Ich erwartete, dass Judith mir alles abnehmen würde, um es dann tantchenmäßig der Garderobe anzuvertrauen. Doch anstatt mich höflich zu bedienen, ging Judith selbstbewusst ins Wohnzimmer voraus. Ich folgte ihr und wunderte mich über den modernen Einrichtungsstil. Ein paar Teelichter, ein wenig Adventsschmuck, aber alles sehr zurückhaltend. Apart. Unauffällig sah ich mich genauer um: Helles Holz, Grünpflanzen, nur in der Ecke stand ein altes Klavier aus braunem Holz. Neben dem Klavier lehnte ein Notenständer an einem Bücherregal. Wir machten etwas gezwungen Konversation, während Judith mir Kaffee einschenkte und Plätzchen anbot. Hauptsächlich um peinlichen Gesprächspausen vorzubeugen, erzählte ich ihr ausführlicher als geplant von den Lehrern im Brauhaus. Doch erstaunlicherweise erwies sich unsere Sekretärin als dankbare Zuhörerin. Sie lachte immer wieder herzhaft über meine Schilderungen, wodurch sich die anfangs recht förmliche Stimmung zwischen uns schnell entspannte.
„So“, schritt sie etwas später zielstrebig zur Tat. „Jetzt haben wir uns körperlich gestärkt und nun sollten wir auch etwas für die Seele tun.“ Ich hatte bis zuletzt gehofft, mein Schicksal noch abwenden zu können und suchte dringend nach einer glaubwürdigen Ausrede. „Tut mir leid, Judith, aber …“
„Als Erstes wärmen wir die Stimme auf“, unterband sie meine Ausflüchte.
Schnell schaute ich demonstrativ auf ihre Wanduhr. „Meinetwegen, aber ich habe nur noch eine knappe halbe Stunde Zeit.“
„Kräusel die Lippen und sage mmmhhh!“
„Oh, das ist einfach“, ergab ich mich Judiths Hartnäckigkeit. „Da muss ich nur an deine leckeren Plätzchen denken.“
„Etwas leiser und genussvoller. Jaaa, genau, so ist es richtig.“ Judith machte mir Lockerungsübungen für die Gesichtsmuskulatur vor, die ich so gut ich konnte brav imitierte. Nach ein paar Minuten jedoch kam ich mir wie eine grasende Kuh vor und begann, meine Mimik zu übertreiben, um die absurde Lächerlichkeit der Übung zu unterstreichen.
„Wunderbar, genau so!“, ermutigte mich unsere Sekretärin und überging meine Clownereien. „Reiß die Augen weit auf, dadurch öffnest du die Resonanzräume im Kopf.“
Ich starrte Judith an. Ich suchte Anzeichen von Ironie in ihrem Blick, aber sie meinte es völlig ernst. Das perfekte Jurymitglied von „Deutschland sucht den Superstar“.
„Okay“, fragte sie mich. „Was wollen wir denn heute singen?“
„Alles außer Weihnachtslieder.“
„Keine Jingle Bells oder Alle Jahre wieder?“
„Nur, wenn du sichergehen willst, dass ich nie wieder einen Schritt in deine Wohnung setzen werde.“
Judith kicherte. „Heißt das, dass du nächste Woche wiederkommst?“
Ich ignorierte ihr Angebot. „Blues. Etwas Trauriges“, schlug ich stattdessen vor.
„Oh“, murmelte sie in neutralem Tonfall und wich meinem Blick diskret aus.
„Etwas über verlogene Männer, die Frauen sitzen lassen.“ Meine Stimme klang aggressiver als gewollt. Judith beugte sich unbeeindruckt über einen Stapel Noten, der auf dem Klavier lag. „Er will sich nicht binden und sie heult sich die Augen aus?“, vergewisserte sie sich mit sachlicher Stimme.
„Exakt!“
Dann schlug ich mir die Hand für den Mund. Meine Antwort war mir einfach so herausgerutscht. Wieso wusste Judith über Philip Bescheid? Ich hatte nur Pièrre kurz darüber informiert, dass meine Umzugspläne nicht länger aktuell wären. Hatte sie etwa bei einem meiner Telefonate mit Em gelauscht? Aber eingentlich konnte ich mir so ein verqueres Verhalten bei ihr nicht vorstellen. Judith merkte meinen skeptischen Blick, legte ihre Stirn in Falten, leckte sich über die Lippen und zog ein Blatt aus dem Noten-Turm.
„Kennst du Cry Me A River? “
„Das von Justin Timberlake?”
„Den kenne ich nicht. Warte, mein Song ist von …“ Judith setzte sich ihre Lesebrille auf. „Words and Music by Arthur Hamilton.”
„Sagt mir nichts.”
„Ähm, mir ehrlich gesagt auch nicht, aber ich summ dir die Melodie einmal vor. Vielleicht hast du sie ja doch schon einmal gehört, von diesem Timberling oder so …“
Eine helle, klare, aber dennoch zerbrechliche Stimme füllte den Raum. Ich konnte gar nicht glauben, dass sie aus Judiths Mund kam. Mittlerweile summte sie nicht mehr, sondern sang den Text. Ich verstand nicht viel, nur, dass die Sängerin einen Fluss Tränen für ihren Liebsten geweint hatte. Das Bild gefiel mir. „Guter Song“, bestätigte ich Judith, als sie fertig war. „Du hast ja eine Wahnsinnsstimme. Leicht und elfenhaft. Für mich ist das viel zu hoch. War aber schön, dir zuzuhören.“
„Och.“ Judith gab sich unbeschwert und setzte sich ans Klavier. „Das kann man ändern.“
„Wie meinst du das? Willst du mich zum Eunuchen machen?“
„Komm doch mal her und leg dir den Text auf den Notenständer.“ Unsicher nahm ich das silbrige Gestell vor dem Buchregal in die Hand. Es erwies sich schwieriger als erwartet, das Monstrum aufzuklappen. Judith wartete geduldig, bis ich fertig war und sang mir dann noch einmal den Anfang vor. Ich krächzte ein paar Takte hinter ihr her. Judith zeigte kein Mitleid. Mein Hals tat schon jetzt weh. „Hmmm, versuchen wir es eine Terz tiefer.“ Judith spielte weiter unten auf dem Klavier und ich bekam zumindest den ersten Ton hin, ohne mir sofort eine Tüte Ricola einwerfen zu müssen.
„Schon besser“, merkte auch meine Lehrerin an. „Und so?“ Sie sang noch ein wenig tiefer, doch diesmal scheiterte ich am Ende von Now you say you're lonely. Jetzt konnte ich zwar das erste Wort mit Schmackes schmettern, landete bei lonely aber so tief im Keller, dass ich befürchtete, mir würde die Brustbehaarung eines Gorillas wachsen.
„Also, ich glaube, im Moment bleiben wir auf „fis“ als Ausgangston und dein zweiter Ton ist dann das „e“. Mir sagte das alles nicht viel, aber wenn sie meinte, dann sollte es so sein. Judiths Finger drückten auf schwarze und weiße Tasten und ich versuchte die Töne zu imitieren, die sie sang. Wir gingen das Lied dreimal durch, bis sie mich bat, es allein zu versuchen.
„Oh, nein, das kann ich nicht. Gib mir Grammatik oder Zahlen, aber sag nicht, dass ich irgendetwas nach Gehör machen soll.“ Ich merkte, dass ich stark schwitzte. Mit einem Schlag war es mir sehr unangenehm, so nahe neben Judith zu stehen.
„Du kannst keine Noten lesen?“
„Ähm“. Ich wurde rot und stotterte. „Meine letzte Begegnung mit Noten liegt schon etwas länger zurück. Blockflötespielen in der Grundschule? Jedenfalls habe ich keine Ahnung, wo welche Note liegt.“
„Ach, das ist im Moment auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, vorerst reicht die grobe Orientierung, ob die Melodie nach oben oder unten geht.“
„Oder gleich bleibt“, warf ich oberschlau ein.
Judith nickte unbeeindruckt. „Lass uns noch einmal den B-Teil versuchen: Told me love was too plebeian, told me you were thru with me.“
Während Judith die Stelle interpretierte, wurde mir erst so richtig bewusst, was sie da überhaupt sang. Das war nicht irgendein Lied. Es war unser Song! Es ging um Philip und mich! Darum, warum wir gescheitert waren. Er hatte mich verlassen, weil unsere Liebe zu plump, zu volksnah war, zu gewöhnlich. Ganz genau Philips Denke. Ich drehte mich voller Leidenschaft zu Judith um.
„Judith, du musst mir einfach beibringen, dieses Lied zu singen!“
Sie schien sich über meinen plötzlichen Gefühlsausbruch nicht weiter zu wundern.