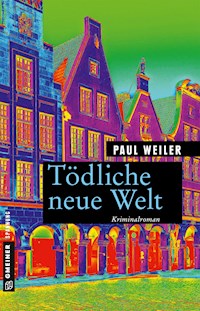4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Einem uralten Mythos zufolge erschuf Gott Brahma einst Frau Tod, um seiner vor Leben überquellenden Schöpfung Einhalt zu gebieten. Doch wenn das nur ein Mythos ist – noch dazu aus einer ihr völlig fremden Kultur –, warum wird die 20-jährige Olivia dann regelmäßig von Visionen von Frau Tod verfolgt? Und warum kreuzen sich ihre Wege beständig mit Menschen, die ihren ganz eigenen Umgang mit der Endlichkeit des Lebens pflegen? So wie Dr. Marty Farrell, der niemals sterben will und mit seiner Longevity-Stiftung Frau Tod den Kampf angesagt hat. Oder ihre Teamleiterin Nancy, deren Sohn an Kinderleukämie er-krankt ist und die ganz eigene Antworten auf die Frage findet, was das Beste für ihren Sohn ist. Am schwersten aber wiegt die Erfahrung mit ihrer Großmutter Abiola, deren unerschütterlicher Glaube an Natur- und Ahnengeis-ter sie in eine tiefe Krise stürzt. In ihrem eigenen Ringen um einen Platz im Leben beginnt Olivia zu begreifen, dass der Tod weitaus mehr ist als nur das Erleben von Verlust, Trauer und Schmerz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Paul Weiler
Nachricht von Frau Tod
Roman
Über den Autor
Paul Weiler wurde in Münster in Westfalen geboren und lebt auch heute noch dort. Wenn er gerade keine Romane schreibt (das vorliegende Werk Nachricht von Frau Tod ist seine fünfte Erzählung), arbeitet er für ein IT-Unternehmen, hält sich mit Karate fit und spielt Saxofon in einer Funkband.
Über das Buch
Einem uralten Mythos zufolge erschuf Gott Brahma einst Frau Tod, um seiner vor Leben überquellenden Schöpfung Einhalt zu gebieten. Doch wenn das nur ein Mythos ist – noch dazu aus einer ihr völlig fremden Kultur –, warum wird die 20-jährige Olivia dann regelmäßig von Visionen von Frau Tod verfolgt? Und warum kreuzen sich ihre Wege beständig mit Menschen, die ihren ganz eigenen Umgang mit der Endlichkeit des Lebens pflegen? So wie Dr. Marty Farrell, der niemals sterben will und mit seiner Longevity-Stiftung Frau Tod den Kampf angesagt hat. Oder ihre Teamleiterin Nancy, deren Sohn an Kinderleukämie erkrankt ist und die ganz eigene Antworten auf die Frage findet, was das Beste für ihren Sohn ist. Am schwersten aber wiegt die Erfahrung mit ihrer Großmutter Abiola, deren unerschütterlicher Glaube an Natur- und Ahnengeister sie in eine tiefe Krise stürzt.
In ihrem eigenen Ringen um einen Platz im Leben beginnt Olivia zu begreifen, dass der Tod weitaus mehr ist als nur das Erleben von Verlust, Trauer und Schmerz.
Impressum
Nachricht von Frau Tod
Copyright 2025 Paul Weiler
Alle Rechte vorbehalten.
1. Auflage Juli 2025
Covergestaltung:
Pixelcompetence, www.Fiverr.com,
unter Verwendung von Motiven von
SerenityArt und Syaibatulhamdi
über Pixabay
Lektorat:
Schoneburg. Literaturagentur und Autorenberatung.
Herausgeber:
Paul Weiler
c/o Autorenservices.de
Birkenallee 24
36037 Fulda
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Autors zulässig.
Inhalt
TEIL EINS
OLIVIA
MARTY
OLIVIA
CNN PODCAST
MARTY
OLIVIA
MARTY
OLIVIA
MARTY
OLIVIA
NANCY
MARTY
NANCY
TEIL ZWEI
TAUBE UND MÖNCHSVOGEL
OLIVIA
DAS CHAMÄLEON
OLIVIA
UNGEHORSAM UND STRAFE
OLIVIA
EINE LIST MIT FOLGEN
OLIVIA
TEIL DREI
NANCY
MARTY
OLIVIA
NANCY
MARTY
OLIVIA
NANCY
OLIVIA
MARTY
OLIVIA
MARTY
OLIVIA
NANCY
OLIVIA
MARTY
TEIL VIER
OLIVIA
NANCY
MARTY
NACHWORT
TEIL EINS
OLIVIA
Genau betrachtet war es nicht der Anruf ihrer Großmutter, der Olivias Leben von Grund auf veränderte. Auch nicht die sich daraus ergebende Reise von New York City, wo Olivia zu dieser Zeit mit ihrem Vater lebte, nach Namibia, die als großartiges Abenteuer beginnen und in einer fürchterlichen Katastrophe enden sollte.
Die ersten Anzeichen, dass für Olivia schon immer ein besonderer Weg vorbestimmt war, hatte es schon viel früher gegeben. Aber diese Hinweise waren von ihr geflissentlich ignoriert worden. Nach ihrer Namibiareise und dem Gespräch mit ihrer Großmutter hatte sie das allerdings nicht mehr gekonnt. Und voll und ganz schwenkte ihr Leben auf einen neuen Pfad, als sie den kauzigen Mr. Higgins kennenlernte. Das geschah nur wenige Wochen nach ihrer Rückkehr aus Afrika und unmittelbar vor einem weiteren einschneidenden Ereignis, über das noch zu berichten sein wird.
Doch beginnen wir ganz am Anfang, mit dem Anruf der Großmutter. Er erreichte Olivia an einem herrlich warmen Donnerstagabend Anfang Mai, einem jener Frühlingstage, die einen den Geruch von Sonnencreme in die Nase treiben und das Gefühl von feinem Sand auf der Haut in Erinnerung rufen. Sie hatte Essen vom Chinesen besorgt und war gerade dabei, den Inhalt der Pappschachteln auf zwei Teller zu befördern, als das Handy ihres Vaters läutete.
Ihr Vater nahm das Gespräch nach einem Blick auf das Display mit einem Stirnrunzeln entgegen. Zunächst war Olivia sicher, dass der Anrufer sich verwählt haben musste, da ihr Vater »Wer ist da bitte?« und »Können Sie das noch mal wiederholen?« fragte, um dann für eine Weile überhaupt nichts mehr zu sagen.
Sein letzter Kommentar jedoch, bevor er ihr das Handy reichte, ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass er den Anrufer gut kennen musste. »Du kannst dir sicher vorstellen, dass ich nach allem, was du getan hast, mehr als skeptisch bin. Aber letztlich wird es ihre Entscheidung sein.«
Olivia starrte verwirrt auf den ausgestreckten Arm ihres Vaters.
»Es ist für dich«, flüsterte er und machte eine nachdrückliche Geste, dass sie das Handy nehmen solle.
Zögernd tat sie wie geheißen.
»Ja bitte?«
»Olivia?«
»Wer spricht da?«
»Hier ist deine Großmutter.«
Ein Scherz, dachte Olivia.
Und ein schlechter dazu.
Die einzige Großmutter, die sie jemals gekannt hatte, war Oma Marianne gewesen, die vor zwei Jahren an Krebs verstorben war. Ihr Vater wusste genau, wie sehr sie Oma Manne – der Spitzname beruhte auf Olivias Unfähigkeit im Alter von drei Jahren, den Namen Marianne richtig auszusprechen – geliebt hatte. Dass er sich jetzt gemeinsam mit dieser Person am Telefon einen so geschmacklosen Streich erlaubte, war unfassbar.
Sie suchte den Blick ihres Vaters, aber der hatte sich abgewandt und stand reglos vor dem Küchenfenster, den Blick auf die gegenüberliegende Häuserfront gerichtet. Sie kannte diese Haltung nur zu gut: Das tat er immer, wenn er über etwas Wichtiges nachdachte. Bei dem Anblick wurde Olivia bewusst, wie absurd ihre Unterstellung war, er könne sich einen Spaß mit ihr erlaubt haben. Der Anruf hatte auch ihn überrascht, das war unverkennbar. Also …
»Bist du noch dran?«
Die Frage riss Olivia aus ihren Gedanken.
»Ich … Ich bin ein wenig verwirrt«, sagte sie schließlich geradeheraus.
»Das kann ich mir gut vorstellen«, antwortete die Stimme am anderen Ende der Leitung. »Vermutlich weißt du gar nicht, wer ich bin, oder?«
»Ehrlich gesagt, nein.«
Für einen Moment blieb es still. Dann: »Ich kann es deinem Vater nicht verdenken, sollte er mich niemals erwähnt haben. Aber ich hatte meine Gründe, mich aus deinem Leben herauszuhalten. Das musst du …«
»Oma Abiola?«, unterbrach Olivia.
Mit einem Mal war der Name wieder da, klar und präsent, als wäre er nie verschwunden gewesen.
Doch das war er, für lange Zeit.
Es tat gut, ihn jetzt wieder auszusprechen.
»Dann hast du also doch mit deinem Vater über mich geredet?«
Oma Abiolas Stimme klang jetzt neugierig, gemischt mit einem Hauch von Unsicherheit. Vermutlich befürchtete sie, dass der Inhalt dieser Gespräche wenig schmeichelhaft für sie gewesen sein könnte.
»Nicht viel«, gab Olivia zurück.
Was allerdings nur zum Teil der Wahrheit entsprach.
Die ganze Wahrheit sah indes so aus, dass es eine Phase in ihrem Leben gegeben hatte – damals war sie dreizehn oder vierzehn Jahre alt gewesen, so genau wusste sie das nicht mehr –, in der sie alles über Abiola und ihre weitere Familie mütterlicherseits hatte wissen wollen. Ihre afrikanische Mutter war gestorben, als sie noch keine drei Jahre alt gewesen war. Da ihr Vater nach diesem Schicksalsschlag jeden Kontakt zur mütterlichen Verwandtschaft abgebrochen hatte, kannte Olivia niemanden aus diesem Familienzweig. Und ihr Vater hatte sich strikt geweigert, etwas zu erzählen. Er könne und wolle nicht darüber reden. Punkt. Alles, was sie je von ihm erfahren hatte, war, dass es überhaupt eine Oma Abiola gab (und einen Opa Deon, den ihr Vater aber nie kennengelernt hatte, als er in den Neunzigerjahren für »Ärzte ohne Grenzen« in Namibia gearbeitet und sich dort Hals über Kopf in ihre Mutter verliebt hatte). So sehr sie damals auch geschrien und getobt, ihren Vater verflucht und geglaubt hatte, ohne ein Wissen über ihre Großeltern niemals herausfinden zu können, wer sie war, so wurde das Thema dann doch irgendwann von den zahlreichen anderen, näheren Sorgen und Nöten eines Teenagerlebens verdrängt. Abiola indes war für sie immer ein Geist geblieben – ein Wesen ohne Gesicht und ohne Gestalt, das nur als nebulöse Vorstellung existierte. Und wie alle Geister der Vergangenheit war auch Abiola irgendwann in Vergessenheit geraten.
Doch jetzt war der Geist zurückgekehrt, und er hatte sogar eine Stimme erhalten.
»Du wirst sicher viele Fragen haben«, fuhr dieser Geist nun fort. »Ich möchte dir alles erzählen. Aber nicht am Telefon. Leider ist es mir nicht mehr möglich, zu reisen. Ich würde dich daher gerne zu mir nach Namibia einladen – genauer gesagt nach Swakopmund, ein bezauberndes Städtchen direkt am Atlantik. Dort wohne ich und hier wurde auch deine Mutter geboren. Es wird dir sicher gefallen.«
Olivia war für einen Moment sprachlos.
Meint sie das wirklich ernst?
Das musste sie wohl, denn nur dann ergab die letzte Äußerung ihres Vaters, bevor er ihr das Telefon gereicht hatte, einen Sinn: Aber letztlich wird es ihre Entscheidung sein.
»Du wirst darüber nachdenken wollen, das ist mir schon klar«, schob ihre Großmutter nach, als hätte sie ihre Gedanken erraten. »Aber es wäre wichtig, dass du dich möglichst schnell entscheidest. Es bleibt mir vielleicht nicht mehr viel Zeit.«
»Geht es dir nicht gut?«, fragte Olivia ehrlich besorgt.
Erst später sollte ihr aufgehen, dass es zu diesem Zeitpunkt in Namibia bereits zwei Stunden nach Mitternacht und es nicht die erste Nacht war, in der ihre Großmutter, von starken Schmerzen geplagt, nicht einschlafen konnte. In gewisser Weise stimmte es daher, was sie über die drängende Zeit sagte – aber eben nur in gewisser Weise, und in diesem Fall machte das einen gewaltigen Unterschied. Aber auch das sollte Olivia erst später erfahren.
»Nicht sonderlich«, beantwortete Abiola die Frage nach ihrem Befinden und ließ wie zur Bestätigung ein heiseres Husten folgen. »Aber ich werde durchhalten. Das habe ich immer getan.«
Erneut folgte ein Husten. »Wirst du über mein Angebot nachdenken?«
»Natürlich«, entfuhr es Olivia, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres auf der Welt.
Eine andere Stimme in ihr, nicht die der Vernunft, sondern die des Herzens, wollte bereits in diesem Moment ohne jedes Zögern fest zusagen. Doch sie wusste nur zu gut, dass es zuvor – mal abgesehen von den organisatorischen Herausforderungen einer solchen Reise – eine nicht unwesentliche Hürde zu überwinden galt.
Ihr Blick glitt erneut zu ihrem Vater, der weiterhin abgewandt aus dem Fenster starrte, als ginge ihn das alles nichts an. Aber sie ahnte, dass er in Wahrheit jedes Wort von ihr genau registrierte.
»Gib mir doch deine Mailadresse, dann sende ich dir alles, was du an Informationen benötigst. Du brauchst mir nur zu schreiben, wann du kommen kannst. Ich werde die Flüge und alles andere für dich buchen. Ich betreibe eine kleine Touristenpension, musst du wissen, daher bin ich mit solchen Dingen vertraut.«
»In Ordnung«, sagte Olivia und nannte ihr ihre Kontaktdaten.
»Dann also hoffentlich bis bald«, verabschiedete sich Abiola und beendete das Gespräch.
≜
Olivia hätte gerne noch länger mit ihrer Großmutter telefoniert, aber sie glaubte, gegen Ende des Gesprächs an deren Tonfall herausgehört zu haben, dass sie das Telefonat zunehmend anstrengte. Außerdem fühlte Olivia sich unwohl bei dem Gedanken, dass ihr Vater jedes Wort mithören konnte. Selbst wenn sie nur wenig bis nichts über seine Beziehung zu Abiola wusste, eines hatte sie aus den Gesprächen mit ihm während ihrer Jugendzeit zumindest begriffen: Was immer zwischen den beiden vorgefallen war, musste ihren Vater zutiefst verletzt haben – so tief, dass er sie vollständig aus seinem und ihrem Leben zu verbannen versucht hatte. Daher erschien es ihr keineswegs ratsam, zu viel Freude über die unerwartete Kontaktaufnahme zu zeigen.
Dennoch war in ihr ein mächtiges Empfinden von gespannter Erwartung erwacht, das spürte Olivia in jeder Faser ihres Körpers. Endlich würde sie Antworten erhalten. Und mit diesen würde sie vielleicht endlich ein Gefühl besiegen können, das sie während ihrer Jugend fast in den Wahnsinn getrieben hatte und sie noch immer wie ein ungeliebter Gefährte begleitete: das Gefühl, dass ein Teil von ihr fehlte. Dass sie unvollständig war. Zwar hatte ihr Vater immer behauptet, jeder Mensch würde sich so fühlen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er eine eigene Familie gründete. Doch das hatte sie ihm schon damals nicht geglaubt und glaubte es auch heute nicht. Ihr fehlender Teil lag in Afrika, bei dem fehlenden Wissen um ihre afrikanischen Wurzeln. Sie hatte es immer gespürt.
Das mitgebrachte Essen vom Chinesen war mittlerweile kalt geworden. Sie griff nach den zwei Tellern auf dem Küchentisch und wollte sie gerade in die Mikrowelle schieben, als ihr Vater seinen Blick vom Fenster löste und sich zu ihr umdrehte.
»Lass gut sein. Ich habe keinen Hunger.«
Sein Gesicht war farblos, die ansonsten lebhaften braunen Augen starrten ausdruckslos durch sie hindurch. »Wenn es dir recht ist, gehe ich nach oben. Wir reden morgen.«
»Morgen?! Du willst mich den ganzen Abend hängen lassen? Außerdem weißt du genau, dass ich morgen Frühschicht habe und später mit Joana ins Kino will.«
Am liebsten hätte sie die Teller mit dem chinesischen Essen durch die Küche geschleudert, so wütend war sie. Wie damals, während ihrer Jugendzeit, fühlte sie sich von ihrem Vater nicht ernst genommen.
Sie hasste es.
Aber dieses Mal würde er nicht damit durchkommen. Schließlich war sie kein kleines Kind mehr, sondern bereits Anfang zwanzig. Und überhaupt – hatte Oma Abiola nicht gesagt, dass sie alles für die Reise buchen würde? Vermutlich bedeutete das auch, dass sie für die Kosten aufkommen wollte. Und selbst wenn nicht, ein bisschen hatte sie gespart, vielleicht reichte das ja. Oder sie würde sich Geld von ihren Freundinnen borgen und später ein paar bezahlte Extraschichten im Sheraton Times Square Hotel einschieben, wo sie derzeit ein sechsmonatiges Pflichtpraktikum für ihr Studium zur Hotelmanagerin absolvierte. Dort wurden immer Leute gebraucht. Irgendwie würde sie es schaffen, die Reise auch ohne Vaters Hilfe zu finanzieren, da war sie sich sicher. Wenn sie nach Afrika wollte, dann würde sie auch fahren. Ganz gleich, was ihr Vater davon hielt.
Sie warf ihm einen Blick voller Zorn zu.
»Liebes, bitte!« Ihr Vater stieß einen tiefen Seufzer aus. »Es ist kompliziert. Ich bin selbst vollkommen überrumpelt und weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich muss darüber nachdenken, bevor wir die Sache besprechen.«
»Wir müssen gar nichts besprechen«, giftete Olivia. »Wenn ich will, werde ich fahren!«
Zu ihrer Überraschung widersprach ihr Vater nicht, sondern nickte bedächtig.
»Ich weiß. Aber ich möchte dich zumindest auf das vorbereiten, was dich erwarten könnte.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, wandte ihr Vater sich ab und verließ mit schweren Schritten die Küche.
Olivias Blick folgte ihm die Treppe hinauf ins Obergeschoss. Bestimmt, so dachte sie, würde er sich jetzt für den Rest des Abends in sein Arbeitszimmer verkriechen und erst wieder herauskommen, wenn sie bereits schlief.
Ihr erster Impuls bestand darin, ihm nachzulaufen und ihn zur Rede zu stellen. So leicht wollte sie ihn nicht davonkommen lassen.
Doch dann hielt sie das doch für keine gute Idee. Olivia kannte ihren Vater gut genug, um zu wissen, wie er reagieren würde: Er würde wütend werden. Wie ein Tier, das man in die Enge trieb. Und wenn es ganz schlimm kam, würde er sogar sein Versprechen wieder zurücknehmen, morgen endlich mit ihr über alles zu reden. Das wollte sie auf keinen Fall riskieren. Immerhin konnte sie ihn jetzt auf dieses Versprechen festnageln – und das war weit mehr, als sie in den vergangenen Jahren jemals bei ihm erreicht hatte.
Sie wandte sich wieder den zwei Tellern mit chinesischen Nudeln zu. Ihre eigene Portion schob sie in die Mikrowelle, die zweite löffelte sie in eine Vorratsdose und stellte sie in den Kühlschrank. Vielleicht würde ihr Vater später noch Hunger bekommen. Dann hatte er etwas, worüber er sich hermachen konnte.
Während sie ihr Abendessen aß, drehten sich ihre Gedanken weiter um Oma Abiola und die unerwartete Einladung. Tausend Fragen schossen ihr durch den Kopf, die vorwiegend praktischer Natur waren: Wie schnell konnte sie zum Beispiel ein oder zwei Wochen während ihres laufenden Praktikums frei bekommen, ohne dass die Personalmanagerin sie für unzuverlässig befand und ihr womöglich ein negatives Praktikumszeugnis ausstellte? Das wollte sie auf keinen Fall riskieren, womit sie auf eine einvernehmliche Lösung angewiesen war. Und dann waren da noch die Themen Visum und Impfungen. Sie würde sich informieren müssen, welche Voraussetzungen für eine Einreise nach Namibia galten und wie schnell sie diese erfüllen konnte. Außerdem wusste sie nicht, mit welchen klimatischen Verhältnissen sie es zu tun bekam. Konnte sie zum Beispiel mitten in eine Trockenzeit hinein bei Tagestemperaturen von vielleicht über vierzig Grad Celsius dorthin reisen? Oder besser gefragt, wollte sie das?
So ging es weiter mit ihren Gedanken. Die Fragen türmten sich unversehens zu einem riesigen Haufen.
Doch das störte sie nicht im Geringsten.
Unwissenheit ist die Mutter aller Abenteuer.
Diesen Spruch hatte sie einmal irgendwo gelesen. Er entsprach exakt dem, was sie im Moment empfand. Man konnte nicht alles im Voraus planen. Sie würde sich schon irgendwie durchwurschteln. Das hatte sie bisher immer getan und mit dieser Strategie hatte sie bisher alles erreicht, was sie sich vorgenommen hatte. Da würde eine Reise auf den afrikanischen Kontinent keine Ausnahme darstellen.
Olivia löschte das Licht in der Küche und ging hinauf in ihr Schlafzimmer. Im Vorbeigehen lauschte sie an der Tür des Arbeitszimmers, in dem ihr Vater sich aller Wahrscheinlichkeit nach verkrochen hatte. Kein Mucks war zu hören, aber sie sah im Türspalt Licht. Also hatte sie mit ihrer Vermutung recht behalten. Bestimmt saß er hinter seinem Schreibtisch und grübelte, den Kopf auf einen Arm gestützt, so wie sie ihn schon oft dort hatte sitzen sehen.
Morgen würde sie erfahren, wohin ihn dieses Grübeln geführt hatte. Auch wenn es ihr immer noch unsäglich schwerfiel, aber bis dahin würde sie sich gedulden müssen. Jetzt kam es erst einmal darauf an, dass sie noch ein wenig Schlaf bekam. Auch Abiolas Anruf änderte schließlich nichts daran, dass sie Frühschicht hatte – und die trug ihren Namen nicht ohne Grund.
≜
Auf der Vanderbilt Street in Windsor Terrace, in der Olivia mit ihrem Vater wohnte, herrschte selbst am helllichten Tag nie viel Verkehr. Und jetzt, um 4 Uhr in der Früh, als sie mit noch halb geschlossenen Augen die Haustür hinter sich zuzog und sich in Richtung Fort Hamilton Parkway Metrostation zu ihrer Arbeit aufmachte, war außer ihr weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Überhaupt war dieser Stadtteil von Brooklyn der anschaulichste Beweis dafür, dass Frank Sinatra grandios übertrieben hatte, als er für ganz New York die Zeile »The City That Never Sleeps« intonierte.
Windsor Terrace war nicht nur verschlafen, dieser Bezirk war der Inbegriff der Verschlafenheit schlechthin.
Wer sich hierher verirrte (oder ganz gezielt die kleinstädtische Seite von Brooklyn kennenlernen wollte), brauchte sich um Parkplatzprobleme keine Sorgen zu machen. Auch bestand nicht die geringste Gefahr, auf den breiten Gehwegen von irgendjemandem angerempelt zu werden, so wie es auf den menschenüberfluteten Straßen von Manhattan regelmäßig geschah. Das Viertel beherbergte gut situierte Familien, Geschäftsleute und betagte Witwen, die in gepflegten ein- oder zweistöckigen Backsteingebäuden lebten. Man kannte seine Nachbarn, man grüßte sich und passte aufeinander auf.
Ihr Vater hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er genau dieses behütete Umfeld für sie gesucht hatte, als er vor sechzehn Jahren frisch verwitwet und mit ihr als knapp dreijährigem Kind im Schlepptau zurück in die Staaten gekommen war.
Wobei, genau dieses Umfeld traf es nicht exakt.
Wäre es ausschließlich nach seinen Wünschen gegangen, wäre Olivia keineswegs in New York City, sondern in Ithaca, einer beschaulichen Kleinstadt an den Finger Lakes rund dreihundertfünfzig Kilometer westlich des Atlantiks, aufgewachsen. Dort, so behauptete ihr Vater, der ein paar Semester seines Medizinstudiums an der dortigen Cornell University absolviert hatte, konnte ein hilfloses und schutzbedürftiges junges Mädchen wie sie jeden Winkel der Stadt und meilenweit das Umland erkunden, ohne sich mit den vielfältigen Gefahren des Straßenverkehrs oder gar Kriminalität auseinandersetzen zu müssen. In Windsor Terrace hingegen beschränkten sich diese Vorteile auf die wenigen Straßenzüge ihres Viertels und schon ein paar Blocks weiter war Schluss mit der kleinstädtischen Idylle, sowohl was den Verkehr als auch die Kriminalität betraf.
Dennoch war ihr Vater damals zu diesem Kompromiss bereit gewesen. Die Geschichte, wie es dazu gekommen war, kannte Olivia nur zu gut. Ganz im Gegensatz zu seiner Auskunftsbereitschaft über ihre Großmutter Abiola hatte er ihr diese Episode ihres gemeinsamen Lebens bestimmt schon hundert Mal erzählt. Die Erzählungen gehörten zu den schönsten Erinnerungen, die Olivia in sich trug.
Nach dem Abschluss seines Medizinstudiums wollte ihr Vater zunächst etwas von der Welt sehen, bevor er sich in die von einem permanenten Kosten- und Leistungsdruck angetriebene Maschinerie des amerikanischen Gesundheitssystems begab. Kurzentschlossen schickte er seine Unterlagen an Ärzte ohne Grenzen, und tatsächlich fand er sich wenig später in einem Kinderhospital in Windhuk wieder, der Landeshauptstadt von Namibia. Dort lernte er dann Olivias Mutter kennen.
»Sie war so schön. Mein Gott, so wunderschön. Ich habe mich sofort in sie verliebt, schon als ich sie das erste Mal gesehen habe. Sie war Kinderkrankenschwester in dem gleichen Hospital, in dem ich damals gearbeitet habe. Aber sie hat zunächst nichts von mir wissen wollen.«
Ihr Vater erzählte das immer genau so, immer die gleichen Worte, immer der gleiche versonnene Tonfall. Anschließend lachte er sein immer gleiches Lachen und sagte voller Stolz: »Aber am Ende habe ich sie dann doch überzeugt. Ich habe nicht aufgegeben, bis sie endlich mit mir ausgehen wollte.«
Was sein Urteil über die Schönheit ihrer Mutter betraf, konnte Olivia ihrem Vater nur zustimmen. Sie besaß ein Fotoalbum, das er für seine Tochter zusammengestellt hatte. Die darin enthaltenen Fotos stammten allesamt aus einer Zeit, bevor es Photoshop, VSCO oder YouCam Makeup gab. Trotzdem hätte jedes Bild ihrer Mutter aus diesem Album problemlos das Cover der VOGUE oder eines anderen Modemagazins schmücken können.
Leider war unverkennbar, dass sie selbst nicht viel von dieser sagenhaften Schönheit geerbt hatte. Insbesondere während ihrer Zeit als Teenager, als Olivia sich hässlich und krumm und schief vorgekommen war, hatte sie sogar so etwas wie Neid empfunden. Ihr eigenes Haar kräuselte sich blassbraun mit einem Stich ins Rötliche, während das lange glatte Haar ihrer Mutter auf allen Aufnahmen tief dunkel wie das samtige Fell eines schwarzen Leoparden glänzte. Auch die Form ihrer Lippen war anders. Olivias zogen sich schmal und ohne klare Konturen durchs Gesicht (nur im Alter zwischen vierzehn und siebzehn wirkten sie durch das Tragen einer Zahnspange voluminöser, als sie in Wirklichkeit waren). Die Lippen ihrer Mutter hingegen glichen auch ohne fünffachen Lippenstiftauftrag dem verführerischen Kussmund von Marilyn Monroe, ohne übertrieben voll zu wirken. Und dann war da noch die makellose, ebenholzfarbene Haut ihrer Mutter, gegen die sich ihr eigener olivfarbener Teint allenfalls als leicht exotisch beschreiben ließ.
Der für Olivia schmerzlichste Unterschied aber bestand in der Augenpartie. Sagte man denn nicht, dass sich Familienähnlichkeiten dort am deutlichsten zeigten? Wenn dem so war, mussten ihre Eltern sie zweifellos irgendwo auf der Straße aufgelesen haben. Sie besaß weder die nahezu perfekt mandelförmigen Augen ihrer Mutter – angeblich das Erbe einer Liebesbeziehung eines ihrer Ahnen mit der Tochter eines indischen Einwanderers, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts wie Mahatma Gandhi und viele andere Landsleute nach Südafrika gekommen war – noch die großen, intelligenten Augen ihres Vaters. In ihrem Spiegelbild zeigten sich lediglich zwei schmale Sehschlitze in der typischen europäischen Form mit leicht nach oben gezogenen Augenwinkeln.
Was jedoch ihren Charakter betraf, schien sie tatsächlich einiges von ihrer Mutter geerbt zu haben. Natürlich konnte Olivia in diesem Punkt nur spekulieren, aber es gab Hinweise, die darauf schließen ließen. Zum Beispiel die Tatsache, dass ihre Mutter sich von ihrem Vater nicht so leicht um den Finger hatte wickeln lassen. Olivia war ebenfalls nur schwer für die Männerwelt zu begeistern – was wohl mit ein Grund dafür war, dass sie noch immer keinen festen Freund hatte. Auch was den Drang ihrer Mutter nach Selbstständigkeit anging, fand sie sich in den Erzählungen ihres Vaters wieder.
»Als endlich klar war, dass wir zusammenleben wollten, bestand deine Mutter unbedingt auf einem gleichberechtigten Start. Keiner von uns sollte einen Heimvorteil haben – als ob eine Ehe ein Footballspiel wäre. Aber so war sie nun einmal.«
Auch das sagte ihr Vater stets mit einem versonnenen Lächeln auf dem Gesicht.
»Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind zusammen von Namibia nach Hamburg gezogen. Du weißt, dass ich schon als Kind ein wenig Deutsch gelernt habe, weil mein Opa aus Deutschland stammt. Und deine Mutter beherrschte die Sprache ebenfalls. Namibia ist eine ehemalige deutsche Kolonie, musst du wissen, früher hieß das Land Deutsch-Südwestafrika. Bis 1919 war Deutsch dort die einzige Amtssprache. Vor allem in Windhuk und der Geburtsstadt deiner Mutter Swakopmund ist die Sprache noch heute überall präsent. Straßenschilder, die Namen von Hotels und Gaststätten, sogar die Speisekarten gleichen denen in Deutschland. Wir haben uns schnell heimisch gefühlt. Wie schon in Windhuk arbeiteten wir beide wieder im selben Krankenhaus, eine nette kleine Kinderklinik am Rande von Hamburg. Dann kamst du, und unser Leben war perfekt.«
Auch diesen Satz formulierte ihr Vater in seinen Erzählungen immer gleich. Jedes Mal, wenn er das tat, wurde ihr ganz warm ums Herz, obwohl sie genau wusste, was danach folgte …
Danach kam der Tod.
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
Das Einzige und wohl auch Sinnvollste, was ihm damals eingefallen war, war ein Hilferuf an seine Mutter Marianne. Als sie im fernen New York die Nachricht über den plötzlichen Tod ihre Schwiegertochter erhielt, hatte sie sich, ohne zu zögern, dazu bereit erklärt, zumindest vorübergehend die Rolle der Ersatzmutter für ihre Enkelin zu spielen – vorausgesetzt, ihr Sohn würde in die Staaten zurückkehren. Ein Leben im Ausland könne sie sich keinesfalls vorstellen, sagte sie.
Was Olivias Vater damals nicht ahnte, war, dass Oma Manne mit einem Leben im Ausland eigentlich jeden Ort meinte, der sich außerhalb von New York City befand.
»Dann wirst du dir wohl doch eine Nanny suchen müssen«, hatte sie auf seinen Vorschlag, nach Ithaca zu ziehen, entgegnet und den Kopf in den Nacken geworfen. »Als du in die Welt gezogen bist und dein Vater sich kurz darauf von mir getrennt hat, hatte ich weiß Gott keine einfache Zeit. Jetzt habe ich hier wenigstens ein paar gute Freundinnen, mit denen ich Bridge spielen und ins Theater gehen kann. Ich fange nicht noch einmal von vorn an, noch dazu irgendwo am Arsch der Welt.«
Damit war das Thema Ithaca abgehakt, und Vater hatte sich fügen müssen. Immerhin war sie dazu bereit gewesen, ihre kleine Zweizimmerwohnung in Lower Manhattan aufzugeben und in das kleine Häuschen in Windsor Terrace in Brooklyn zu ziehen, in dem sie noch immer wohnten. Mehr hatte er nicht verlangen können.
Wenn Olivia heute darüber nachdachte, hielt sie die damaligen Entscheidungen ihres Vaters für goldrichtig. Gewiss, sie war in Deutschland geboren und ein Land zu verlassen, in dem man seine ersten Worte gelernt und die ersten Spielkameraden gefunden hatte, mochte schmerzhaft sein. Und natürlich schmerzte sie der Tod ihrer Mutter. Aber wenn das alles geschah, bevor man seinen dritten Geburtstag erlebt hatte und wenn man anstelle von stetig wechselnden Tagesmüttern von einer liebevollen und warmherzigen Bezugsperson großgezogen wurde, die noch dazu zur Familie gehörte, dann hielt sich der tatsächlich erlebte Kummer in Grenzen.
Zumindest war es das, was sie heute empfand.
≜
Ganz in diesen Gedanken versunken schlenderte Olivia weiter entlang der menschenleeren Vanderbilt Street in Richtung Fort Hamilton Parkway Metrostation. Da sie ausnahmsweise viel zu früh dran war, verspürte sie keine Eile. Die Metro fuhr alle paar Minuten rauf nach Manhattan, und ganz gleich, welchen Zug sie nahm, sie würde immer noch rechtzeitig zu ihrer Frühschicht im Sheraton ankommen.
Natürlich hatte sie in dieser Nacht entgegen allen guten Vorsätzen und Ermahnungen an sich selbst doch nicht schlafen können. Sie hatte es mit der 4-7-8-Atemmethode versucht (einatmen durch die Nase und bis vier zählen, Atem anhalten und bis sieben zählen, dann über den Mund ausatmen und bis acht zählen, anschließend das Ganze mehrmals wiederholen), war gegen 2 Uhr noch mal aufgestanden, um sich eine warme Milch zu machen, und hatte es schließlich gegen halb vier aufgegeben und sich angezogen.
Doch trotz des Schlafmangels fühlte Olivia sich hellwach und voller Energie. Natürlich war sie das, schließlich bekam man nicht alle Tage einen Anruf von einem längst verloren geglaubten Teil seiner Vergangenheit. Ihre Freude über diese unerwartete Wendung würde sie sich keinesfalls durch das Jammern über eine schlaflose Nacht verderben.
Während der Fahrt mit der Metro zur 7th Avenue in Manhattan spekulierte Olivia über die Frage, was wohl Oma Abiola damals davon gehalten hatte, ihre einzige Tochter an einen jungen amerikanischen Arzt zu verlieren. Hatte sie sich über das Liebesglück der beiden gefreut? Oder hatte sie dem jungen Paar Steine, wenn nicht sogar gigantische Felsbrocken in den Weg gelegt? Vermutlich Letzteres, denn warum sonst sollte Vater sich mit ihr zerstritten haben? Auch fragte Olivia sich, ob Abiola ihre Tochter während der Zeit in Deutschland jemals besucht hatte. Zumindest zu ihrer Beerdigung musste sie doch angereist sein, oder etwa nicht? Und was war eigentlich mit Opa Deon? Welche Rolle hatte er während der ganzen Zeit gespielt?
Olivia konnte über all diese Dinge nur rätseln. Nichts davon war jemals über die Lippen ihres Vaters gekommen. Selbst seiner eigenen Mutter gegenüber hatte er sich verschlossen, was diese Dinge betraf. Wenigstens hatte Oma Manne das immer behauptet. Ob das der Wahrheit entsprach oder ob die beiden diesbezüglich einen Pakt des Schweigens vereinbart hatten, wusste sie nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Aber ihr Gefühl sagte Olivia, dass Oma Manne sie niemals über all die Jahre hinweg angelogen hätte.
Es würde also ein langes Gespräch werden, das sie mit ihrem Vater zu führen hatte. Und sollte er sich diesmal erneut hinter einer Mauer des Schweigens verbarrikadieren, würde sie ihre Fragen eben Oma Abiola stellen.
So oder so – endlich würde sie Antworten erhalten.
≜
Um 04:50 Uhr und damit vierzig Minuten vor ihrem Schichtbeginn durchschritt Olivia die Eingangstür zum Sheraton New York Hotel in Manhattan. Da sie nicht wusste, wohin sie sonst sollte, begab sie sich direkt zu dem ihr zugeteilten Aufenthaltsraum für das Hotelpersonal – ein karges, ungemütliches Zimmer ohne Fenster am Ende eines Flurs, das früher womöglich einmal als Wäschekammer gedient hatte. Die spartanische Einrichtung des Raums bestand aus nicht mehr als ein paar Stahlspinden mit Vorhängeschlössern, einem vermakelten Tisch mit Stühlen und einer kleinen Spülküche. Dieser Ort passte nicht in die ansonsten so imposante und stilvolle Atmosphäre des Hotels. Aber hierher kamen auch keine zahlenden Gäste.
Sie setzte sich auf einen der Stühle, kramte ihr Handy hervor und schrieb ihrer Freundin Joana eine WhatsApp-Nachricht.
Olivia: Hey, wo steckst du?
Joana: Na wo wohl? In der Metro.
Olivia: Ich bin schon im Hotel (Daumen hoch).
Joana: Was??? Streber. Bist du aus dem Bett gefallen?
Olivia: Konnte nicht schlafen. Wann kommst du?
Joana: Dauert noch. Kurz vor knapp, wie immer.
Olivia: Mist. Ich muss unbedingt mit dir reden. Welche Schicht?
Joana: Rezeption. Und du?
Olivia: Konferenzetage. In der Pause draußen?
Joana: Okay. Was ist denn los? Nervt wer?
Olivia: Nein. Im Gegenteil (drei Smileys).
Joana: Sag schon.
Olivia: Später. Sei nicht so neugierig!
Joana: Sagt die, die immer alles sofort wissen will.
Olivia hielt kurz inne und überlegte, ob sie Joanas Nummer wählen sollte. Doch eigentlich wollte sie das nicht, sondern ihr Gesicht sehen, wenn Olivia ihrer Freundin die Neuigkeit von Oma Abiolas Anruf erzählte. Außerdem …
Eine neue Nachricht erschien auf dem Display.
Joana: Keine Zeit mehr, muss jetzt umsteigen. Wir sehen uns.
Olivia seufzte und legte das Handy zur Seite.
Wieso, dachte sie jetzt, war sie eigentlich nicht auf die Idee gekommen, heute Morgen runter zur Beverley Road Station zu laufen, an der Joana immer in die Metro stieg? Die Station lag in Flatbush, ein Stadtviertel Brooklyns südlich von Windsor Terrace, und war nur einen Spaziergang von zwanzig Minuten entfernt. Zeit genug hätte sie gehabt. Dort hätte sie dann auf Joana warten und ihr während der gemeinsamen Fahrt alles erzählen können.
Doch eigentlich wusste Olivia nur zu gut, warum sie diese Möglichkeit nicht in Betracht gezogen hatte. Gänzlich neu war die Idee nämlich nicht. Aber als ihr Vater von dem Plan erfuhr, dass sie und Joana immer dann gemeinsam eine Metro nehmen wollten, wenn ihre Schichtpläne im Hotel sich zeitlich deckten, war er förmlich an die Decke gegangen.
Noch heute konnte sie sich seine Standpauke fast wortwörtlich ins Gedächtnis rufen:
»Jetzt reicht es mir aber endgültig mit euch! Ihr habt die ganze Highschool hindurch die Köpfe zusammengesteckt. Dann, o Wunder, entscheidet ihr euch beide für die St. John’s University, wählt den gleichen Studiengang Hotelmanagement und irgendwie habt ihr es jetzt auch noch geschafft, im selben Hotel einen Platz für euer Pflichtpraktikum zu ergattern. Du weißt, ich mag Joana. Und tagsüber könnt ihr euch Treffen, wo und sooft ihr wollt. Aber wenn du glaubst, dass ich seelenruhig dabei zusehe, wie meine Tochter mitten in der Nacht vor ihrer Frühschicht oder nach der Spätschicht zu Fuß durch halb Brooklyn läuft, nur um noch ein paar Minuten länger mit ihrer Freundin quatschen zu können, dann hast du dich geschnitten! Ende der Durchsage.«
Olivia hatte sofort begriffen, dass jeder Widerspruch zwecklos war – zumal sie genau wusste, welche Rädchen sich da im Kopf ihres Vaters wie drehten.
Eigentlich zählte sie ihren Vater in die Kategorie der vernunftbegabten Wesen. Als studierter Mediziner war er ein Mann der Wissenschaft, der Daten und Fakten normalerweise nicht ohne guten Grund beiseite wischte. Doch wenn es um ihre Sicherheit ging, konnten Mythen und aufgebauschte Geschichten blitzschnell die Oberhand gewinnen.
So war es auch mit seiner Meinung über Joanas Wohnviertel Flatbush. In der Biografie von Mike Tyson (die ihr Vater aus irgendeinem unerfindlichen Grund nahezu verschlungen hatte, obwohl er sich nicht sonderlich für den Boxsport interessierte) beschreibt der Profisportler, wie er in Brownsville und East Flatbush aufgewachsen und bereits im Alter von fünf Jahren mit einer Waffe durch die Gegend gezogen war.
East Flatbush – Flatbush.
Allein diese Namensverwandtschaft genügte, um in Vaters Kopf Alarmglocken schrillen zu lassen. Seither hatte sie nie den Weg zu Joana im Dunkeln allein beschreiten dürfen. Dass East Flatbush und Flatbush in Wahrheit kaum etwas gemein hatten und selbst East Flatbush (im Gegensatz zu Brownsville) kaum in der New Yorker Kriminalitätsstatik hervorstach, blockierte sein Verstand vollkommen – ebenso wenig wie er niemals verstehen würde, wie viele wichtige Dinge Frauen nun mal jeden Tag zu bereden hatten.
Nun würde Olivia wohl oder übel bis zur Schichtpause um 09:30 Uhr warten müssen, bis sie Joana von ihren aufregenden Neuigkeiten berichten konnte. Zum Glück stand für heute eine Großveranstaltung mit über tausend Gästen im Konferenzbereich auf dem Programm, sodass ihr die Zeit bis dahin nicht langweilig werden würde.
Sie öffnete ihren Spind und zog sich die Hoteluniform an, die aus einer weißen Bluse, einer kaffeebraunen Stoffhose und einer Serviceweste im gleichen Farbton bestand. Ihre Haare band sie zu einem Zopf. Anschließend schlüpfte sie in die bequemen schwarzen Arbeitsschuhe mit Gummisohle und machte sich auf den Weg zu ihrem Einsatzbereich.
Mittlerweile war es bereits 05:15 Uhr, sodass sie auch nicht mehr allzu früh dran war.
≜
Endlich sprang die Uhr auf halb zehn.
Olivia eilte hinaus zum Haupteingang, wo Joana bereits auf sie wartete. Ihre Freundin trug die gleiche Hoteluniform und hatte die Haare genau wie Olivia zu einem Zopf gebunden. Da Joana ebenfalls einer gemischten Ehe entstammte – ihr Vater Argentinier, ihre Mutter Amerikanerin mit italienischen Vorfahren –, hatte auch sie einen südländischen Einschlag mit dunklen Augen und dunklen Haaren. Bei den Gesichtszügen bestand zwischen ihnen jedoch nicht die geringste Ähnlichkeit. Olivias Gesicht wies eher rundliche und weiche Züge auf, während Joana markante Wangenknochen und einen ausgeprägten Nasenrücken besaß. Dennoch kam es manchmal vor, dass sie für Schwestern gehalten wurden. Dann lachten sie und stellten sich vor, es wäre tatsächlich so. Beide waren sie Einzelkinder und beide hatten sie sich immer eine Schwester gewünscht.
»Und, wie läufts im Konferenzbereich?«, fragte Olivias Wunschschwester zur Begrüßung.
Obwohl Olivia es kaum abwarten konnte, Joana von Abiolas Anruf zu erzählen, musste sie vorher noch etwas anderes loswerden. »Ihr müsst aufpassen. Wir haben im Metropolitan Ballroom eine riesengroße Veranstaltung mit über tausend Gästen.«
Joana verdrehte die Augen. »Glaubst du, das weiß ich nicht? Die sind bereits alle bei uns an der Rezeption vorbeigekommen. Trotz der Ausschilderung habe ich bestimmt schon hundert von denen persönlich in die zweite Etage begleiten müssen.«
»Was du aber noch nicht weißt, ist, dass der eigentliche Eröffnungsredner der Veranstaltung noch irgendwo im Verkehr feststeckt. Wir waren gerade mit dem Eindecken des Saals fertig, als die Nachricht eintraf und plötzlich alle hektisch wurden. Zum Glück gab es noch einen anderen Redner, den haben die dann auf die Bühne geschickt.«
Olivia deutete auf die schmale Parkbucht vor dem Haupteingang. »Also: Wenn da nachher jemand aus dem Taxi springt und bei euch an der Rezeption aufschlägt, dann solltet ihr ihn so schnell wie möglich hochbringen. Mach keinen dummen Spruch über die bereits begonnene Tagung. Der Mann ist bestimmt schon genervt genug und irgendeine wichtige Nummer.«
»Alles klar. Ich begleite ihn persönlich zu euch hoch. Ist ja nicht der Erste heute. Wie heißt er?«
»Dr. Marty Farrell.«
»Okay. Sonst noch was?«
Olivia schüttelte den Kopf. »Und bei dir?«
»Nichts, was wichtig wäre. Jetzt erzähl schon, warum du heute schon so früh hier warst.«
Das war das Stichwort, auf das Olivia gewartet hatte.
≜
In der nächsten Viertelstunde redete Olivia ohne Punkt und Komma. Da Joana die Phase miterlebt hatte, in der sie während ihrer Teenagerzeit ergebnislos nach ihren afrikanischen Wurzeln geforscht hatte, brauchte sie nicht lange zu erklären, wer Abiola überhaupt war. Sie begann daher direkt mit dem unerwarteten Anruf, erzählte dann von der Einladung nach Namibia und der hinhaltenden Reaktion ihres Vaters. Ihr atemloser Bericht endete schließlich damit, dass sie heute leider die geplante Kinoverabredung absagen müsse, weil sie noch dringend mit ihrem Vater zu reden habe. Außerdem müsse sie noch ins Personalbüro, um ihre Chancen auszuloten, kurzfristig ein paar Tage freizubekommen.
Olivia wusste nicht, welche Reaktion sie erwartet hatte, aber bestimmt nicht diese.
»Bist du ganz sicher, dass du das wirklich willst?« Joana musterte sie mit hochgezogenen Brauen.
»Was ist denn das für eine Frage?«, entgegnete sie unsicher.
Sie kannte diesen Blick ihrer Freundin. Er verhieß für gewöhnlich nichts Gutes.
»Diese Frage ist die Wichtigste von allen«, beharrte Joana.
»Natürlich will ich Abiola kennenlernen. Du weißt doch genau, wie viel mir das bedeutet.«
»Das ist ja genau das Problem!«
Joana ergriff ihre Hand.
»Überleg doch mal: So wie ich dich kenne, wirst du alles an Abiola toll finden – mit Sicherheit sogar. Und sei es nur deshalb, weil dein Vater sie offenbar nicht mag. Du wirst ihm beweisen wollen, wie idiotisch er ist. So bist du nun mal. Du wirst deine neu gewonnene Großmutter im Nullkommanichts in dein Herz schließen. Und wenn du aus Namibia zurück bist, wird das Nächste, was du von ihr hörst, eine Einladung zu ihrer Beerdigung sein.«
»Was?« Olivia starrte Joana fassungslos an.
»Du hast selbst gesagt, dass sie schwer krank ist.«
»Ja, aber …«
»Aber was? Warum solltest du dich noch mal schnell entscheiden? Weil ihr nicht mehr viel Zeit bleibt. Das hat sie doch gesagt, oder?«
»Schon. Aber sie hat auch gesagt …«
»Dass sie durchhalten wird«, ergänzte Joanna den Satz. »Durchhalten! Ein paar Wochen oder Monate. Höchstens. Zumindest hört sich das für mich so an. Dass ihr Wunsch nach deinem Besuch sozusagen ihr letzter Wille ist, ist dir doch klar, oder?«
»Wie kannst du so etwas sagen?«, fauchte Olivia und entzog sich Joanas Hand. »Das ist so gemein!«
»Ich weiß. Aber noch mal so eine Zeit wie vor drei Jahren, als deine Oma Manne gestorben ist, möchte ich ehrlich gesagt nicht miterleben. Und du willst das auch nicht.«
Olivia senkte den Blick.
Joana schwieg für eine Weile, dann breitete sie die Arme aus. »Komm her.«
Olivia ließ ihre Umarmung zu.
Eine Zeit lang standen sie so schweigend da. Dann löste sich Joana von Olivia und sah ihr direkt ins Gesicht.
»Hör zu: Ich möchte, dass du dir die Sache noch einmal gründlich durch den Kopf gehen lässt. Sprich noch nicht mit der Personalabteilung. Rede erst mit deinem Vater. Und wenn du dann immer noch nach Namibia willst, werde ich dir helfen. Ich könnte ein paar Doppelschichten schieben, damit du frei bekommst. Sag denen das. Aber denk erst in Ruhe darüber nach, was du wirklich willst und welche Konsequenzen das für dich haben könnte. Okay?«
Olivia nickte.
Joana warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Verdammt! Schon so spät. Wir müssen zurück.«
»Joana?«
Jetzt war es Olivia, die nach der Hand ihrer Freundin griff.
»Ja?«
»Danke! Auch wenn du mir den ganzen Tag versaut hast.«
»Dafür sind beste Freundinnen schließlich da«, sagte Joana grinsend. »Irgendjemand muss ja auf dich aufpassen. Erzähl mir morgen alles, was dein Vater über Abiola gesagt hat.«
»Das überlege ich mir noch«, sagte Olivia augenzwinkernd und zog ihre Freundin in Richtung Eingangstür.
MARTY
Wer in seinem Leben das Glück hatte, Marty Farrell persönlich kennenzulernen, hätte ihn als einen ruhigen, besonnenen Zeitgenossen charakterisiert, den nichts so leicht aus der Fassung brachte. Er begegnete den meisten Menschen mit Respekt, war höflich und humorvoll und verlor selten ein böses Wort. Es sei denn, er bekam es im Übermaß mit dem zu tun, was Farrell am meisten verachtete: Engstirnigkeit.
Doch das war nicht der Grund, warum Marty Farrell die einzig greifbare Person, die ihm gerade zur Verfügung stand, einen übergewichtigen Taxifahrer mit dem faltigen Gesicht einer Bordeaux-Dogge, am liebsten lautstark zur Schnecke gemacht hätte. Er hatte während der Fahrt kaum ein Wort mit dem Mann gewechselt und wusste daher nicht im Geringsten, ob dieser nun engstirnig oder ein weltoffener Freigeist so wie er selbst war. Es war ihm auch einerlei. Er brauchte dringend einen Blitzableiter, irgendein Ventil für seine immer stärker werdende Unruhe und angestaute Aggression.
Trotz der Fahrgeräusche im Inneren des Wagens konnte Farrell hören, wie ihm das Blut in den Ohren rauschte. Sein Herz schlug ungewöhnlich schnell, sein Atem ging flach und unregelmäßig. Die Finger seiner linken Hand trommelten schon seit geraumer Zeit unablässig auf den rissigen Ledersitz des Taxis, in dem er nun schon seit mehr als zwei Stunden festsaß, und es gelang ihm einfach nicht, damit aufzuhören. Ebenso wenig wie es ihm gelang, den miefigen Geruchscocktail von sich langsam zersetzendem Plastik, Parfümresten, Hundehaaren und was auch immer zu ignorieren, der im Innenraum des Taxis hing.
Farrell kurbelte zum wiederholten Male die Fensterscheibe herunter, um den modrigen Kellergeruch zu vertreiben. Aber das machte es auch nicht besser. Der Luftaustausch versorgte ihn nur mit den Abgasen anderer Fahrzeuge, die sich ebenfalls auf der New York State Route 9A Richtung Süden quälten. Außerdem ertrug er den Lärm des Straßenverkehrs nicht, wenn das Fenster geöffnet war.
Verfluchter Bockmist!, dachte Farrell, und schlug mit der Faust gegen das Fenster der hinteren Beifahrerseite.
Der Taxifahrer quittierte die Aktion mit einem tadelnden Blick in den Rückspiegel. »Reißen Sie sich noch zehn Minuten zusammen. Dann haben Sie es geschafft.«
Notgedrungen zwang Farrell sich zur Ruhe. Der Mann hatte ja recht. Sein Wutausbruch würde ihn weder schneller ans Ziel bringen noch würde er die anderen Fahrzeuge in die Flucht treiben, die sich vor und neben ihm über den Asphalt quälten.
Er konzentrierte sich darauf, an etwas Positives zu denken, etwa sein heutiges fünfundvierzigminütiges Laufpensum um 5 Uhr, mit dem er den Tag begonnen hatte. Farrell stellte sich vor, wie die frische und klare Luft des noch jungen Tages erneut in seine Lungen strömte, frei von Mief und Gestank, wohltuend wie eine kalte Dusche.
Es half tatsächlich. Roch es jetzt nicht schon ein bisschen weniger nach miefigem, feuchtem Keller als noch wenige Sekunden zuvor?
Als Nächstes visualisierte Farrell die Anzeige seiner Apple-Watch, die er beim Joggen stets im Blick hatte. Sie zeigte den seiner Meinung nach für das Lebensalter von fünfundfünfzig Jahren idealen Belastungspuls von hundertfünfunddreißig Schlägen pro Minute. Und sobald er am Ende seiner Runde die Haustür seiner Wohnung in Scarsdale, einer ruhigen Kleinstadt etwa fünfundzwanzig Meilen nördlich von Manhattan, erreicht hatte, beruhigte sich sein Puls fast augenblicklich wieder auf unter fünfzig Schläge.
Er stellte sich den stetig sinkenden Anzeigewert bildlich vor und warf dann einen Blick auf den aktuellen Messwert seiner Apple-Watch. Er zeigte nun halbwegs normale zweiundsechzig Schläge pro Minute an. Farrell konnte spüren, wie seine körperliche Unruhe wich.
Zum Schluss seiner inneren Bilderreise rief er sich – mit einem schuldbewussten Blick auf den faltigen Hinterkopf seines Fahrers – die Szene ins Gedächtnis, wie das von ihm georderte Taxi pünktlich zur bestellten Zeit vorgefahren war, der Mann am Steuer ihn freundlich begrüßt hatte und wie es nach dem ersten Kilometer der Strecke von Scarsdale nach Manhattan so ausgesehen hatte, als würde alles nach Plan verlaufen. Zu dieser Zeit, also bis etwa 08:10 Uhr, war die Welt noch in Ordnung gewesen.
Doch dann hatte ein schwerer Unfall mit zeitweiser Vollsperrung auf der New York State Route 9A ihm einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie steckten fest, die nächste Abfahrt war noch Meilen entfernt. Nach zwanzig Minuten Stop-and-Go hatte Farrell sich eingestehen müssen, dass er es niemals rechtzeitig zum New York Sheraton Hotel in Manhattan schaffen würde. Notgedrungen hatte er die Organisatoren der heutigen Konferenz über seine Situation informiert und sie gebeten, seinen für 9 Uhr im Programmheft aufgeführten Vortrag auf die zweite Rednersession um 10:45 Uhr zu verlegen.
Diese unerwartete Planänderung war aber nicht der einzige Grund für seine sich rapide verschlechternde Laune gewesen. Hinzu kam, dass er sich im Verlauf der letzten Stunde und gefangen auf der Rückbank des Taxis immer mehr in den Gedanken hineingesteigert hatte, aus irgendeinem Grund während seines heutigen Vortrags zu versagen. Er fürchtete, dass es ihm nicht gelingen würde, die rund tausend Teilnehmer der medizinischen Jahrestagung im Sheraton auf seine Seite zu ziehen.
Solche Versagensängste waren ihm normalerweise fremd. Er begriff gar nicht, wie sie sich in seinen Kopf hatten einnisten können. Dennoch hatte er kurz die Angst gespürt, böse und vernichtend wie das Wissen um ein Krebsgeschwür, das sich in seinem Körper eingenistet hatte.
Zum Glück ging es ihm jetzt wieder besser. Außerdem hatte der Wagen in diesem Moment sein Fahrziel erreicht, was Farrell mit einem erleichterten Seufzer quittierte. Er bezahlte den Taxifahrer, beruhigte sein schlechtes Gewissen über den erfolgten Wutausbruch mit einem ordentlichen Trinkgeld und nahm im Laufschritt die wenigen Stufen zum Eingang des Sheraton New York. An der Rezeption empfing ihn eine junge Angestellte in Hoteluniform, die über sein Erwarten bereits informiert war. Sie begleitete ihn unverzüglich in die Konferenzetage und übergab ihn dort an einen erleichtert dreinblickenden Mittvierziger.
»Dr. Farrell, endlich. Es ist mir eine persönliche Ehre. Ich bin Marc Miller, wir haben vorhin telefoniert.«
Er schüttelte die ihm entgegengestreckte Hand.
»Ihr Vortrag ist wie besprochen umgeplant worden. Um das neue Zeitfenster zu halten, bleiben Ihnen noch etwa fünf Minuten. Die Präsentation, die Sie uns geschickt haben, müsste bereits hochgefahren sein. Der Techniker sitzt links von Ihrem Rednerpult, von ihm erhalten Sie Ihr Headset. Können wir?«
Farrell nickte und folgte Miller quer durch den mit Stehtischen vollgestopften Vorraum des Metropolitan Ballroom, um die sich die Teilnehmer der heutigen medizinischen Jahrestagung nach dem ersten Vortrag zur Kaffeepause versammelt hatten. Nicht wenige Blicke folgten ihm. Man kannte sein Gesicht, seinen Namen. Natürlich taten sie das. Nicht wenige waren schließlich nur seinetwegen hierhergekommen.
Er betrat die Bühne, sprach mit dem Techniker und ließ sich von ihm in die Bedienung des Headsets einweisen. Zur Probe sprach er ein paar Worte. Der in den riesigen Raum übertragene Ton war klar und rauschfrei, wie Farrell zufrieden feststellte. Hinter ihm leuchtete auf einer überdimensionalen Leinwand die Titelfolie seines heutigen Vortrags. Er probierte die Fernbedienung für den Beamer, spielte zwei Folien vor, dann wieder zurück auf die Titelfolie. Schließlich hob er den Daumen, verließ die Bühne, schüttelte die Arme aus und machte sich locker. Von seinen Versagensängsten spürte er in diesem Moment nichts mehr.
Ein Klingelzeichen rief in diesem Moment die Teilnehmer in den Sitzungsraum. Die Tischreihen füllten sich, bald kehrte Ruhe ein. Die Tür zum Sitzungssaal wurde geschlossen.
Blicke voller Erwartung waren nun nach vorn auf die noch leere Bühne gerichtet. Und Farrell ließ sie warten. Eine Minute. Und noch eine. Dann trat er mit dynamischen Schritten an das Rednerpult, die Arme weit ausgebreitet und bereit, seinen Begrüßungsapplaus zu empfangen.
OLIVIA
»Jetzt höre sich das einer an. Der Typ ist ja völlig durchgeknallt.«
Olivia schnappte die Worte nur zufällig auf, da sie gerade in der Nähe von Nancy Williams stand, die ihr Handy an das Ohr presste, als würde sie telefonieren. Aber offenbar tat sie das nicht, denn wieso würde man zu einem Anrufer sagen, dass man sich das einmal anhören solle, was ein gewisser Typ zu sagen habe? Außerdem ließ ihre Teamleiterin nun kopfschüttelnd das Handy sinken und steckte es ohne ein weiteres Wort in ihre Hosentasche.
Olivia war gerade damit beschäftig, das benutzte Geschirr aus der Kaffeepause abzuräumen, aber besondere Eile hatte das nicht. Die eben erst geschlossene Tür zum Sitzungssaal würde sich erst in über einer Stunde wieder öffnen. Bis dahin würde es hier im Vorraum relativ ruhig bleiben.
Für jede Abwechslung von ihrer monotonen Arbeit dankbar fragte sie daher ihre Teamleiterin: »Wer ist völlig durchgeknallt?«
Nancy Williams deutete mit dem Kopf auf die geschlossene Tür des Konferenzsaals. »Der Typ, wegen dem heute Morgen so eine Hektik war und der jetzt gerade vorträgt. Einfach unglaublich, was der so von sich gibt. Macht den Leuten Hoffnung und lügt das Blaue vom Himmel herunter.«
»Woher wissen Sie das?«, fragte Olivia verwundert. »Man hört hier draußen doch gar nichts.«