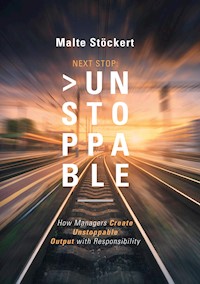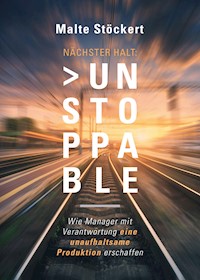
14,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Malte Stöckert nimmt den Leser mit auf die Reise zu den täglichen Herausforderungen eines mittleren Managers und seines Teams in einem produzierenden Unternehmen. Sie lernen Thomas auf dieser Reise kennen. Er steht vor scheinbar unlösbaren Aufgaben und fühlt sich in einem Wertekonflikt, der ihn immer wieder an sich selbst und an der Aufgabe zweifeln lässt. Begleiten Sie Thomas auf dem Weg das eigene Weltbild zu prüfen und zu reflektieren. Letztlich fragt sich Thomas immer wieder, was der Sinn hinter dem Ganzen ist. Eine Frage, die sich ganz offensichtlich in der deutschen mittelständischen Wirtschaft Menschen immer häufiger stellen. Die Relevanz dieses Werkes im unternehmerischen Kontext wird in diesen Passagen des Buches beeindruckend klar. Manager Thomas entwickelt im Verlauf sein eigenes Vorgehen. Er erlebt welche Dimensionen sein Handeln hat und begreift, was es wirklich bedeutet für sich selbst und für sein Team die Verantwortung zu übernehmen. Er lernt mit Konfliktsituationen umzugehen und begreift auch emotional, welche Aufgaben er lösen muss. Ein Muss für jeden mittleren Manager, der sich getrieben, gehetzt und manchmal gar überflüssig fühlt. Ein Appell und ein Aufruf für eine faktenbasierte Diskussion, eine tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst und der Annahme von Leadership. Dinge, die an unseren Bildungsstätten viel zu selten vermittelt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Malte Stöckert
NÄCHSTER HALT: UNSTOPPABLE
© 2021 Malte Stöckert
Umschlag, Illustration: Daniela Urban
Coverbild: shutterstock/Denis Belitsky
Lektorat, Korrektorat: Wolfgang Sand M.A.
Weitere Mitwirkende:
Markus Coenen – Autorencoaching
Wolfgang S. Becker – Händische Skizzierung, Grafik der Widmung
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-347-30395-9
Hardcover
978-3-347-30396-6
e-Book
978-3-347-30397-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
DIE EIGENTLICHE IDEE
Wirklich wichtig ist nur, was der Kunde sagt
Nur wenn der Kunde mein Produkt will, kann ich eine Organisation aufbauen
DIE SITUATION DIE HÖLLE – ALLES HAT KONSEQUENZEN
Situationen, die Sie sicher nicht kennen
Die Hölle mit der internen Brille betrachtet
Chaos und Aufgabenhaufen beim Manager
Die Sinnhaftigkeit der Aufgabe
Denken in Silos führt zu Handeln in Käfigen
Die meisten Qualitätsprobleme entstehen, weil das Risiko am Anfang nicht richtig eingeschätzt wird
DER ERSTE SCHRITT DU!
Die Definition eines Managers
Verantwortung fängt bei Selbstverantwortung an
Teil des Problems oder Teil der Lösung?
Eigeninvestition
Ich selbst bin die Änderung
Was ist denn wirklich meine größte Herausforderung?
Wer ist in deinem Zentrum?
Wer ist in deinem Umfeld?
Glaubenssätze
Vom seichten Bewusstsein zu einer verantwortungsvollen Position
Love it, change it or leave it
DER ZWEITE SCHRITT: ANALYSE
Transparenz – wertfreie Betrachtung, was Realität ist
Menschen sind erleichtert, wenn die „Leiche“ endlich ausgegraben wird
Analyse muss vor dem Lösungsvorschlag kommen
Im Heute, im Gestern, im Morgen
Erkenntnisse alleine ohne konkrete Maßnahmen sind sinnlos
100 % ist nicht 80 %
Nahezu alle Gründe, etwas nicht zu tun, sind falsch
Möglichkeiten und Risiken
Das ideale Bild
Wie soll‘s denn sein?
Abweichungsanalyse
Was kann jetzt in der Umsetzung passieren?
DER DRITTE SCHRITT: JUST DO IT
Wie kann ich Engagement wirklich erzeugen?
Empower dein Team
Vom Verweigerer zum Change Enabler
Teamführung, Delegation, Eskalation
Die Definition eines Teams
Teil des Problems oder Teil der Lösung im Team?
Mach deine Arbeit – RICHTIG
Grundsatz: FIRST TIME RIGHT – fasse alles nur einmal an
Erledigt ist es erst, wenn es getan ist
DER VIERTE SCHRITT: GIB DICH NICHT ZUFRIEDEN, DER KUNDE TUT ES AUCH NICHT!
Arbeit hört nie auf
Rahmen setzen
Näher an den Kunden kommen
Rückschlüsse ziehen
Kreislauf installieren
DIE EIGENTLICHE IDEE
Wirklich wichtig ist nur, was der Kunde sagt
Es lohnt sich nicht anzufangen, wenn du nicht genau weißt, was der Kunde will.
Ohne Kunden wird kein Geschäft erzeugt. Ohne Kunden, die sich für meine Produkt interessieren, gibt es keine Einnahmen. Ohne Kunden gibt es keine Firma. Ohne ein Produkt, das an einen Käufer verkauft werden kann, weil es ihm in irgendeinem Zusammenhang einen Mehrwert bietet, wird keine Firma existieren können.
Der Bauer bestellt das Feld und baut Getreide an. Dieses verkauft er an den Müller, der daraus Mehl mahlt und es an den Bäcker verkauft, der daraus Brot macht und dieses an seine Kunden verkauft. Der Mehrwert, den der Bäcker seinen Kunden bereitet, ist das Gefühl der Sättigung. Ohne uns als Kunden des Bäckers könnte dieser nicht existieren und damit könnte auch der Bauer nicht existieren.
Der Bauer, der Müller und der Bäcker müssen ihre Produkte so hochwertig erzeugen, dass sie von uns als Kunden abgenommen werden. Verschlechtert sich die Qualität des Brotes, gehen wir zu einem anderen Bäcker und kaufen dort das Brot. Wird das Brot bei Bäcker Nr. 1 für unser subjektives Empfinden zu teuer, dann gehen wir zu einem anderen Bäcker und kaufen uns das Brot dort.
Die Qualität der Ware und der Preis, den wir bereit sind zu zahlen, hängen irgendwie zusammen, aber es ist nicht mehr einfach so, dass das teuerste Produkt auch das qualitativ hochwertigste ist. Viele andere Empfindungen spielen beim Kauf von Produkten – und das gilt auch für Grundnahrungsmittel wie Brot – heute eine viel größere Rolle, als uns landläufig bewusst ist. Der ernährungsbewusste Käufer wird bereit sein, mehr Geld für ein hochwertiges Brot auszugeben, der an Nachhaltigkeit interessierte Käufer wird Biowaren kaufen wollen und ist wohl auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Wieder andere Käufer sind nur daran interessiert, dass das Brot preiswert ist.
Wie auch immer es uns gelingt den Preis zu gestalten, der Kunde hängt uns als Hersteller oder Erzeuger oder Anbieter einer Dienstleistung das Preisschild an.
Je günstiger es uns gelingt unser Produkt herzustellen, umso größer wird der Ertrag sein, den wir einnehmen können. Um effiziente Prozesse zu entwickeln und zu etablieren, hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr das Lean Management durchgesetzt. Je größer die Verwaltung, also der Aufwand ist, der nicht direkt mit der Erstellung des Produkts oder dem Fulfillment zu tun hat, umso geringer wird der Ertrag, den wir erwirtschaften können.
Die Qualität des Produktes oder der Dienstleistung, die wir erbringen, entscheidet heute maßgeblich darüber, ob ein Unternehmen konkurrenzfähig bleibt oder es seine Produkte so beim Kunden verkaufen kann, dass der Kunde immer wiederkommt.
Immer wieder dieselbe hohe Qualität zu liefern ist richtig, reicht aber heute nicht mehr aus. Die Qualität der Produkte, die das Unternehmen entwickelt, muss heute stetig wachsen, denn jeder Stillstand in der Entwicklung bedeutet gegenüber einer Konkurrenz zurückzufallen und in der Gunst der Kunden nicht mehr die erste Rolle zu spielen.
Es gibt unzählige Beispiele, wo die gleichbleibende Qualität des Produktes letztlich dazu geführt hat, dass Unternehmen vom Markt verschwunden sind. Nicht mal vermeintlich große Weltkonzerne werden davor verschont. Als Beispiel kann hier der Handy-Hersteller Nokia genannt werden, der heute faktisch nicht mehr als solcher existiert.
Beschäftigt sich ein Unternehmen zu sehr mit interner Verwaltung und wendet sich davon ab, den Kundenwunsch zu erfüllen, dann hat das letztlich einen ähnlichen Effekt. Langfristig werden meine Produkte zu teuer oder gehen nicht mehr auf den Kundenwunsch ein und das Unternehmen wird sich verkleinern müssen, schrumpfen oder gar gänzlich vom Markt verschwinden.
Konstant gute Qualität zu liefern ist nicht mehr nur ein Versprechen, das man dem Kunden geben muss, sondern es ist eine Voraussetzung, um erfolgreich im Markt bestehen zu können.
Das mittlere Management in vielen produzierenden und dienstleistenden Betrieben steht genau in diesem Konflikt aus effizienten Prozessen, auf die Kosten achten und gleichzeitig für hohe Qualität sorgen zu müssen. Dazu kommen dann noch Themen der Teamführung und immer wieder das Reporting an höhere Stellen mit der Rechtfertigung, warum wie viele Ressourcen wo eingesetzt werden müssen – unter dem permanenten Druck Kosten sparen zu sollen.
Kein Wunder, dass der Bezug zum Produkt und damit zum Kunden in den Hintergrund gerät, weil der Manager damit beschäftigt ist, die neuesten Datenerhebungen bereitzustellen und gleichzeitig rechtfertigen zu müssen, warum die Zahlen nicht so gut sind, wie vorher prognostiziert bzw. gefordert von der obersten Ebene.
Ich nenne das die Distanz zum Kunden, die immer größer wird. Viele Manager machen sich heute nur sehr selten Gedanken darüber, was ihr Produkt beim Endkunden auslöst oder wie sich der Kunde fühlt, wenn er das Produkt der eigenen Firma in den Händen hält. Wenn dieser Bezug zum Kunden nicht mehr gegeben ist, so wie ich es in den letzten Jahren immer wieder gesehen und erlebt habe in vielen großen und mittelständischen Unternehmen, dann gerät die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit in den Hintergrund. Wenn der Kunde nicht mehr der direkte Ansprechpartner ist, dann ist die Gefahr groß, dass derjenige, der an der Erstellung des Produktes oder der Dienstleistung tätig ist, den Bezug zu der Größe Qualität verliert und sich schlicht nicht in den Kunden hineinversetzt oder hineinversetzen will.
Was bedeutet denn nun eigentlich Qualität? Wenn man sich in ein Hotel eingebucht hat, das vier Sterne hat, dann hat man eine gewisse Erwartungshaltung an die Qualität der Dienstleistung, die man geboten bekommt. Saubere Zimmer, sehr gutes Essen setzt man genauso voraus wie einen zuvorkommenden Service. Häufig geschieht es aber, selbst in den besten Häusern, dass am Empfang ungelernte oder unerfahrene Angestellte tätig sind. Nichts erbost den von der Reise erschöpften Gast mehr als ein unfreundlicher Empfang oder ein ineffizienter Prozess beim Einchecken. Obwohl jedem bekannt sein dürfte, dass der erste Eindruck zählt, gibt es viele Hotels, die auf einen freundlichen und zuvorkommenden Empfang nicht den Wert legen, der notwendig ist. Es hört sich so einfach an und doch scheint es sehr kompliziert zu sein, am Empfang eines Hotels eine konstant hervorragende Qualität der Dienstleistung zu bieten.
Wenn mir also als Manager des Hotels dieser Transfer nicht gelingt, sich nämlich in den Kunden hineinversetzen zu können, dann werde ich die Gäste nicht an mich binden können. Wenn ich im produzierenden Betrieb diesen Transfer nicht hinbekomme, dann erscheint die Kundenmeinung gänzlich egal zu sein. Die Distanz zum Kunden ist dann unendlich, in einer anderen Dimension. In vielen Gesprächen mit Produktteams, in denen es um die Neuentwicklung von Produkten im hochpreisigen Bereich ging, habe ich immer wieder die Behauptung vernommen: „Das will der Kunde nicht.“ Ohne jede faktische Grundlage oder ohne dass der „Kunde“ befragt wurde.
Die Distanz zum Kunden, ob bewusst nicht gesucht, weil es ja einfacher ist, den gewohnten Weg zu gehen, oder weil scheinbar nicht möglich, weil die täglichen Herausforderungen so vielfältig sind und es häufig um Rechtfertigung geht, sorgt langfristig dafür, dass die Erfüllung der Dienstleistung oder die Qualität des Produktes leiden wird.
Schlimmer noch, der Manager, der bestimmt mit guten Vorsätzen an den Job herangegangen ist, verliert den Bezug zu der Sinnhaftigkeit seiner Aufgabe und damit jede tiefere Erfüllung in seinem Tun. Ohne diesen tieferen Bezug wird er seine Aufgabe nur so gut erfüllen, dass er die minimalen Anforderungen an seinen Job erfüllt, weil er permanent darüber nachdenkt, dass dies eigentlich nicht die Aufgabe ist, die er gesucht hat. Damit sorgt er aktiv für die Verschlechterung der Qualität des Produktes oder der Dienstleistung, obwohl er das ursprünglich gar nicht gewollt hat. Er sucht sich permanent Ablenkung im Außen, sei es, dass er über einen Jobwechsel nachdenkt oder sei es, wie und wo er seinen nächsten Urlaub verbringen will.
Um noch einmal den Bezug zum Hotel zu bemühen. Ich habe in meinem Leben bestimmt schon weit mehr als hundert Bewertungen und Kritiken in Hotels hinterlassen, ich habe genau EINE Antwort auf meine Kritiken bekommen. Was sollen dann also die Vordrucke in den Hotelzimmern, auf denen man sich über die Qualität des Service oder die Sauberkeit des Zimmers äußern soll. Als Kunde werde ich offensichtlich nicht ernst genommen, wie sonst kann man die 99 % erklären, die kein Feedback auf die Kritik gegeben haben. Andererseits: Wie EINFACH ist es in diesem Zusammenhang, die Meinung des Kunden zu respektieren und damit die Qualität der Dienstleistung zu erhöhen – und sei es nur durch diesen einen Anruf aus dem Hotel, der sich für die Abgabe der Kritik bedankt. Immer wieder lese ich von den Wohlfühlhotels, die damit werben, dass man sich bei ihnen am besten entspannen kann. Ernsthaft? Genau für diese Hotels bietet es sich an, die Kritik ihrer Kunden wirklich zu verstehen.
Für den Job des Managers bedeutet das, die Kundenorientierung bewusst zu suchen und sich auszumalen, was der Kunde fühlt, denkt oder erlebt, wenn er das Produkt, an dessen Entstehung der Manager mitwirkt, erstmalig in Händen hält.
Nur wenn der Kunde mein Produkt will, kann ich eine Organisation aufbauen
Es lohnt sich erst eine Organisation aufzubauen, wenn ich genau weiß, was der Kunde will.
Um dem Kunden ein komplexes Produkt oder eine Dienstleistung anbieten zu können, muss der Unternehmer eine Organisation aufbauen, die ihm bei der Ausführung dieses Vorhabens hilft. Je besser die Menschen in der Organisation verstehen, was der Kunde wirklich fühlt und denkt, je besser also antizipiert werden kann, was der Kunde will, desto besser kann die Umsetzung in eine wertvolle Dienstleistung oder in ein tolles Produkt gelingen.
Schaut man sich heute Organisationen an, so darf vermutet werden, dass bei vielen Menschen keinerlei Interesse daran besteht, was ihr Kunde wirklich will. Nehmen wir den Einzelhandel. Hier besteht ein stetig schlechter werdendes Umfeld, weil die meisten Konsumenten ihre Dinge gezielt im Internet bei Anbietern bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Große Kaufhäuser, die in den achtziger Jahren in keiner deutschen Großstadt fehlen durften, verschwinden heute immer mehr aus den Innenstädten. Der Grund ist nicht nur die Bequemlichkeit der Konsumenten, sondern auch die neutrale bis unfreundliche Behandlung, die die Kunden im Geschäft erleben müssen. Es scheint, als wollten sich die Angestellten nicht an die neue Situation anpassen und dazulernen.
Als Inhaber oder Angestellter eines Einzelhandelsgeschäfts muss ich mir also genau überlegen, was will der Kunde in meinem Geschäft erleben? Es gibt sehr viele Beispiele, bei denen es durch besondere Ansprache oder Zuwendung an den Kunden, durch ein ganz spezielles Sortiment oder durch eine ganz besonders gut gestaltete Atmosphäre gelingt.
Hier geht es also darum, darüber nachzudenken, welches Erlebnis der Kunde beim Kauf erleben möchte.
Beim Blick in die Organisationen von produzierenden Unternehmen fällt auf, dass sich die allerwenigsten darüber Gedanken machen, welches Erlebnis der Kunde mit dem hergestellten Produkt wirklich erleben will. Das gilt übrigens auch für das hochpreisige Segment, von dem erwartet werden dürfte, dass man sich hier besonders viel Mühe macht.
Es mag sein, dass ein Unternehmen eine sehr gute Marketing- und Marktforschungsabteilung hat, die darauf spezialisiert ist, neue Produktideen zu generieren. Spätestens in der nächsten Stufe, nämlich beim Produktentwickler, scheint dieses Interesse häufig schon nicht mehr vorhanden zu sein. Kommt dann noch der Einkauf dazu, der häufig kostengetrieben ist und am liebsten in Niedriglohnländern einkaufen möchte und weniger Interesse an der Qualität der Komponenten hat, verkommt die Idee, ein tolles Produkt für den Kunden erzeugen zu wollen.
In diesem Umfeld müssen Manager der Produktion oder der Qualität agieren und ihre eigenen Interessen vertreten und durchsetzen. Der Zielkonflikt ist vorhersehbar. Der Qualitätsverantwortliche muss ständig damit ringen, dass andere Abteilungen versuchen, die versprochene, aber nicht gehaltene Qualität dennoch ausliefern zu dürfen. Es werden permanent Sonderfreigaben und Concessions erstellt, womit die abweichende Produktqualität gerechtfertigt werden soll.
Merkwürdigerweise haben Firmen, in denen Qualität so „betrieben“ wird, häufig in ihren Firmenwerten etwas zum Thema hohe Qualität zu sagen. Es wird genau in diesen Firmen propagiert, dass das Einhalten der Qualität das oberste Gesetz sei.
Was hat das Ganze aber mit dem Wunsch des Kunden zu tun, der ja bestenfalls antizipiert werden soll, damit das Produkt oder die Dienstleistung besonders wertvoll gelingen kann? Herzlich wenig, es herrscht ein vollkommener Disconnect zwischen dem Kundenwunsch und den real durchgeführten Handlungen.
Andererseits, je besser es mir gelingt, die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden in den täglichen Abläufen der Organisation zu verankern, umso besser wird das Fulfillment der Dienstleistung oder des Produktes sein. Die Organisation, die davon beseelt ist, die Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen und darüber hinaus zu erahnen, was sie noch wollen würden, wird immer einen Vorteil haben gegenüber Organisationen, in denen die Menschen sich nicht darum kümmern.
In gut geführten Hotels wird sich der Barmann bewusst Zeit nehmen mit jedem Gast ein Gespräch beginnen zu wollen, damit dieser sich angenommen und anerkannt fühlt. Gute Häuser achten auf diese Kundenerfahrung.
Eine ganz einfache Frage, die ich immer wieder stelle, ist: „Was würdest du von uns erwarten, wenn du unser Kunde wärst?“ Das funktioniert in vielen Situationen, weil dann plötzlich klar wird, was getan werden muss – und andere Dinge rücken in den Hintergrund.
Häufig werden aber heute die Interessen der Aktionäre oder der obersten Leitung VOR die Interessen der Kunden gestellt. Die Auswirkungen dieses Zielkonfliktes spiegeln sich in den Diskussionen des mittleren Managements wider. Häufig wird darüber gestritten, ob ein Produkt mit einem Mangel ausgeliefert werden darf, damit z. B. das Monatsergebnis stimmt. Geschieht das wirklich im Interesse des Kunden?
Wenn die Führung des Unternehmens nicht die Wünsche des Kunden im Blick hat, dann treten an deren Stelle individuelle Bedürfnisse und Interessen, die eher weniger mit der Erfüllung des Kundenwunsches zu tun haben. Da geht es um ganz handfeste egozentrische oder egoistische Ziele. Es geht um Karriere oder die Höhe des Gehalts. Der untergebene Manager gerät nun in einen Zielkonflikt: Soll er die Bedürfnisse seines Vorgesetzten erfüllen oder den Kundenwunsch oder nach den Werten handeln, die von der Führung vorgegeben werden? Die meisten versuchen, alles unter einen Hut zu bringen und bemühen sich, jede Anforderung zu erfüllen. Am Ende wird vollkommen unklar, was denn nun wichtig ist und für welchen Zweck die Arbeit getan wird.
Der Manager verliert die Einstellung zur Arbeit, weil er schlicht bei den vielen verschiedenen Zielen, die um ihn herumschwirren, nicht mehr weiß, was als Erstes erledigt werden soll. Mittelfristig wird er seinen Einsatz reduzieren, weil er einsieht, dass er ansonsten aufgerieben wird zwischen den verschiedenen Anforderungen.
DIE SITUATION – DIE HÖLLE – ALLES HAT KONSEQUENZEN
Situationen, die Sie sicher nicht kennen
Unser Tun hat immer Konsequenzen. Im Positiven soll meine Handlung etwas auslösen und ich tue das bewusst. Beispielweise pflanze ich im Frühjahr Blumenzwiebeln ein, weil ich im späteren Verlauf des Jahres mich und meine Umwelt erfreuen möchte mit den schönen, blühenden Blumen.
Genauso hat aber auch das Nichtstun Konsequenzen. Da wir jahrzehntelang weggeschaut haben, wenn es um das Thema Plastik ging, haben wir nun die Konsequenz, dass es einen riesigen Berg von Plastikmüll gibt, der auf dem Ozean vor sich hintreibt. Keiner hört die Wahrheit so gerne, wenn es um Konsequenzen geht, die negative Auswirkungen haben.
Unternehmen verschwinden vom Markt, weil sie die negativen Konsequenzen ihrer Handlungen oder Ausrichtungen nicht verkraften können. Nehmen wir das Beispiel Nokia und die Handyherstellung. Bevor Nokia sich komplett aus dem Geschäft der Handyherstellung zurückgezogen hat, haben sie angenommen, dass sich Smartphones niemals durchsetzen würden. Sie mussten die Konsequenz ihrer Fehleinschätzung bezahlen und existieren nicht mehr auf dem Markt.
Jeder Mensch weiß, dass er mit Sport und guter Ernährung dem Altern vorbeugen und ein besseres Leben im hohen Alter genießen kann. Dennoch gibt es Millionen von Menschen, die rauchen, sich von Fast Food ernähren und nur sehr unregelmäßig Sport machen. Sie werden die Konsequenzen ihres Nichtstuns tragen müssen und somit im Alter leiden.
Der Versuch von Boing, bei der Abnahme durch die Behörde zu tricksen, wird nicht nur tausende Jobs gekostet haben, sondern hat hunderte Menschenleben gekostet. Alles hat eben Konsequenzen.
Ich habe schon viele Projekte erlebt, bei denen der Projektleiter sich schlicht nicht getraut hat auszusprechen, dass die vorgegebene Zeit oder die eingesetzten Ressourcen nicht reichen werden. Das ist aber sein Job, er hat diesen Job ja gerne angenommen. Erstaunliche 60 % aller Projektleiter glauben nicht mal an den Erfolg des Projekts. Die Konsequenz ist, dass das Projekt das gewünschte Ergebnis nicht erzielen wird.
Es gibt viele Beispiele aus der Automobilindustrie, wo die verspätete Fertigstellung der Produktentwicklung zu erheblichen Auswirkungen geführt hat. Es gibt unzählige Spritzgusswerkzeuge, die nie zum Einsatz gekommen sind, weil sie technisch nicht funktionieren konnten oder weil der Chefdesigner kurz vor dem Produktionsstart nochmals seine Meinung geändert hat und alle Bemühungen damit zunichte gemacht hat, das Produkt in der gewünschten Zeit und mit der gewünschten Qualität auf den Markt zu bringen.
Es existieren Hallen voll Sitzgarnituren für die Automobilindustrie, die niemals in Autos eingebaut wurden, weil sie qualitative Mängel aufwiesen. Die Konsequenz einer laschen Qualitätspolitik oder nicht stringenter Einhaltung von Designregeln. Vielleicht alles nicht so schlimm, wenn es sich nur um Material handeln würde, aber es ist ja auch Arbeitszeit hineingeflossen und die Ledergarnituren waren ursprünglich Teile von lebenden Wesen.
Denken wir mal an die Erstellung von Budgets und sagen wir, der Manager hat nach bestem Wissen und Gewissen sein Budget aufgestellt und erklärt, dass es mit weniger Personal nicht möglich sein wird, die Aufgaben seiner Abteilung zu erfüllen. Und dann hört er, dass er die Kosten nochmals um x Prozent kürzen soll. Welche Konsequenzen wird das für den Manager haben? Wenn er clever ist, dann wird er seine Kosten vor der nächsten Budgetrunde höher rechnen und sich einen Puffer nehmen. Auf jeden Fall muss er schon hier Energie hineinstecken, bevor er überhaupt etwas umsetzen konnte. Er wird die Erstellung des Budgets als Last empfinden, denn er beginnt zu begreifen, dass er unter diesen Umständen sowieso nicht die Leistung aus seiner Abteilung herausholen kann, die er für sinnvoll erachten würde. Die Konsequenz ist, dass dieser Manager nur noch mäßig motiviert ist, die Interessen der Firmenleitung umzusetzen. Er beginnt über einen Jobwechsel nachzudenken.
Viele Projekte durfte ich erleben, bei denen das Budget schlicht zu gering angesetzt war und obwohl dies jedem bekannt war und es auch klar dargestellt wurde, wird am Ende des Projektes so getan, als sei das überraschend. Dann wird mit Mehraufwand die Situation halbwegs bereinigt. Die Kosten sind dann aber meist viel höher, als wenn man zu Beginn richtig kalkuliert hätte.
Es gibt Beispiele, wo Cent-Produkte Menschenleben gekostet haben, weil Menschen zu gierig waren, einen angemessenen Betrag für ein lebensnotwendiges Produkt auszugeben. Wenn ein Neugeborenes vom Nabel getrennt wird, dann muss die Nabelschnur abgeklemmt werden. Das geschieht mit ganz einfachen Klammern. Malen wir uns aus was passiert, wenn diese Klammer nicht die erforderliche Schließkraft aufbringt und das Blut nicht stoppen wird. Die Krankenschwester verlässt sich aber darauf, weil sie schon hundertmal bei der Entbindung dabei war. Alles hat Konsequenzen.
Sicherlich haben die allermeisten tagtäglichen Aufgaben, die wir so zu erfüllen haben, nicht DIESE Art von Konsequenzen, aber es macht sicherlich Sinn darüber nachzudenken, WIE ich den Job erfülle, für den ich mich entschieden habe. Lasse ich mich leiten von wahrhaft hohen Werten oder geht es mir nur um Pflichterfüllung und ich hoffe, niemand schaut genau hin, dann kann ich auch mal etwas unter den Tisch fallen lassen.
Die Hölle mit der internen Brille betrachtet
Der Manager, der das mittlere Management vertritt, der also die Werte des Unternehmens an sein Team weitergeben soll und gleichzeitig dafür sorgen muss, dass „der Laden läuft“, hat sich bewusst für den Job entschieden. In seinem Inneren drängt es ihn dazu, der Welt etwas zu geben. Er spürt, dass er noch Anleitung braucht und ist getrieben von seinem Ehrgeiz, etwas für seine Familie und für sich selber erreichen zu wollen. Dieser Mensch ist von Idealen geprägt, die er in seiner Jugend aufgenommen hat und die er durch sein Studium getragen hat. Er will die Welt verändern, weil es das ist, was ihn antreibt.
Er trifft am ersten Arbeitstag auf die Fülle der Aufgaben und ist zunächst erschlagen davon.
Am zweiten Tag trifft er auf Mitarbeiter seines Teams, die die Illusion verloren haben, etwas ändern zu können und erstmalig fragt er sich: Wie kann das eigentlich sein. War das im Vorstellungsgespräch nicht anders? Hat sich das nicht alles anders, viel besser angehört? Geht es der Firma nicht darum, das Beste für die Kunden und für die Mitarbeiter gestalten zu wollen?
Am dritten Tag trifft er auf seine „Peers“, also auf Manager, die andere Abteilungen vertreten, die aber komplett andere Ziele zu verfolgen scheinen, als die, die die Firma auf ihrer Homepage propagiert und die auch im Vorstellungsgespräch postuliert wurden? Die erste Begegnung ist nicht konfrontativ, sondern fühlt sich merkwürdig an, weil die Peers ihm viel Glück wünschen im neuen Job und er ahnt, dass das nicht vollkommen aufrichtig gemeint ist. Warum wird plötzlich in Frage gestellt, dass die Wünsche des Kunden zu respektieren sind? Warum dreht sich plötzlich alles nur noch um Kosten? Wie soll er bloß seinem Team klarmachen, dass er von den hehren Zielen wohl abweichen muss, die er noch gestern versprochen hat? Verwirrt geht er nach Hause.
Am vierten Tag nimmt er wahr, dass nicht in allen Bereichen so agiert wird, wie er es für optimal hält, und er zweifelt zum ersten Mal, ob er sich für das Richtige entschieden hat. Aber heute ist noch nicht der Tag für ein Resümee und so geht er auch am fünften Tag in die Firma.
Freitage, so stellt er schon jetzt fest, sind in dieser Organisation nicht ganz so ruppig. Er hat Zeit, die ersten Eindrücke zu sammeln und ihm wird bewusst, dass sehr viel Arbeit vor ihm liegt.
Immer noch euphorisiert von den Anfängen genießt er das Wochenende mit den Freunden und der Partnerin, weil er sich wohl für das beste Unternehmen entschieden hat, für das man sich entscheiden kann.
Die nächst Woche verläuft ruhig und er gewöhnt sich langsam ein. Nicht in jedem Meeting (und es sind verdammt viele Meetings, die er zu besuchen hat) geht er auf Konfrontation, sondern hält sich hier und da auch mal zurück, weil das wohl so opportun ist. Er spürt, dass das für die Erfüllung des Jobs richtig ist, aber für die Durchsetzung seiner Ziele und die Auffassung über die Werte, die er vertritt, von denen er gedacht hat, dass sie auch vom Unternehmen vertreten würden, bringt ihm das nur große Fragezeichen.
In der dritten Woche beginnt er mit einem Masterplan, wie er seine Abteilung aufstellen will, damit sie die Herausforderungen schafft, die auf sie zukommen. Er freut sich über den Plan, weil er für sich genommen ein geniales Masterpiece ist.
In der vierten Woche macht er sich daran, seinen Plan an sein Team zu vermitteln und er trifft auf die ersten Widerstände. Sein Team scheint nicht zu verstehen, was er will. Er nimmt hier und da so etwas wie Weigerung wahr. Der Eine sagt „das haben wir schon immer so gemacht“ und der Andere zweifelt an seiner Kompetenz. Der Manager spürt, dass er noch sehr viel zu lernen hat und dass er keineswegs angekommen ist. Am Abend und am Wochenende zermartert er sich das Hirn, was er besser machen kann, damit sein Team versteht, was er will. Liegt das denn nicht offen auf der Hand? Er wischt sich gedanklich den Mund ab und denkt sich, es ist besser weiterzumachen.
Chaos und Aufgabenhaufen beim Manager
Mikromanagement und andere Führungsprinzipien. So werden Untergebene werden Verweigerer
Thomas trifft also mit seinem Masterplan auf das Team. Er führt ein multidisziplinäres Team und hat permanent tausend Dinge im Kopf, die während des Produktanlaufs eines neuen Automobils der gehobenen Mittelklasse nun einfach anstehen. Er muss sich beschäftigen mit den logistischen Anforderungen und dafür sorgen, dass die Materialien in richtiger Qualität und zum richtigen Zeitpunkt an den Verbauort kommen. Dafür hat er das Team. Das Team ist jung und unerfahren und kennt sich weder in der Marktumgebung aus, noch haben die Mitglieder gelernt, wie man Druck gegenüber Lieferanten aufbauen kann, die säumige Lieferungen haben oder schlechte Qualität liefern.
In dieser Situation versucht Thomas die Kontrolle zu gewinnen über all die kleinen Aufgaben und sein Mittel der Wahl ist ein großes Board, auf dem alle Aufgaben des Tages geschrieben stehen, den einzelnen Personen zugeordnet sind und mit Terminen und Uhrzeiten versehen sind. Jeden Morgen erwartet er pünktlich um 08:00 Uhr, dass sein Team sich am Board versammelt und gegenüber ihm Rechenschaft ablegt, welche Dinge erledigt werden konnten und welche offengeblieben sind.
Am ersten Morgen steht er vor einem motivierten Team und er spürt, dass diese Mannschaft reif ist etwas zu lernen und nach vorne zu gehen. Sie nehmen interessiert teil an der Diskussion und auch bereitwillig Aufgaben an. Allerdings stellt er schon fest, dass sich die Beteiligten ungerne auf Fertigstellungstermine oder gar Uhrzeiten festlegen lassen möchten. Das gefällt ihm nicht so gut, aber er denkt sich dabei erst mal noch nichts.
Über den Tag bekommt er weitere Aufgaben von den Ansprechpartnern seiner Kunden und auch von Lieferanten zugespielt, die er gerne an die Teammitglieder delegieren will. Daher setzt er für den frühen Nachmittag ein neues Meeting an. Dort will er die Aufgaben verteilen, stößt aber auf erste mürrische Antworten und muss sich anhören, dass die Aufgaben vom Morgen noch nicht gelöst worden wären und dass man doch bitte Zeit einräumen solle, diese zunächst zu lösen, bevor es wieder neue Aufgaben zu bewältigen gäbe.
Am nächsten Morgen erwartet er dann um 08:00 Uhr wieder die Anwesenheit und den Rapport seines Teams. Thomas stellt fest, dass nicht mal 50 % der verteilten Aufgaben erledigt worden sind. Mit dem, was er sich von gestern noch aufgeschrieben hat und was er sich in einer unruhigen Nacht noch alles hat einfallen lassen, türmen sich inzwischen schon die Aufgaben am Board und es beginnt unübersichtlich zu werden.
Am darauffolgenden Morgen sind nicht mehr alle Teammitglieder an der Morgenbesprechung beteiligt und auch die Anwesenden haben bei Weitem nicht alle Aufgaben gelöst.
Thomas ist frustriert. Er hatte doch so einen guten Plan für das Vorgehen und ist auch bis in die Haarspitzen motiviert, die besondere Herausforderung zu meistern. Er versteht einfach nicht, warum die anderen aus seinem Team die Wichtigkeit der Aufgaben einfach nicht begreifen wollen.
Er ändert seinen Ton und verschärft ihn, er wird fordernder gegenüber seinen Teammitgliedern und setzt noch kürzere Fristen, weil er will, dass endlich Dinge erledigt werden.
Am Ende der Woche stellt er fest, dass nur ein Bruchteil von dem, was er sich für sein Team vorgenommen hat, erledigt werden konnte. Thomas sagt sich „was man nicht selber tut …“ und ärgert sich über die schlechte Performance seines Teams. Frustriert geht er in das Wochenende und grübelt weiter darüber nach, wie es dazu kommen konnte.
Am Wochenende macht er sich erneut einen Plan und legt fest, dass er nur noch gezielte Aufgaben verfolgen wird. Immer nur eine Aufgabe zu einer bestimmten Zeit und dann muss er sich eben die Leute dazu holen, die ihm helfen können.
Also macht er das so, konzentriert sich auf eine Aufgabe, spricht bei Bedarf die Teammitglieder ganz individuell an und arbeitet auch mit Druck und Dringlichkeit. Damit scheint er wirklich Erfolg zu haben und es gelingt Thomas, ein paar größere Brocken, die ihn schon lange genervt haben, aus dem Weg zu räumen.
Wenn er Aufgaben von seinen Teammitgliedern zurückgespiegelt bekommt, dann schaut er sich die Ergebnisse genau an und kritisiert, verbessert und korrigiert, wo er nur kann. Thomas denkt, dass das Team dann am schnellsten lernt, was er von ihnen erwartet.
Langsam bekommt er einen Dreh in die Angelegenheit und er freut sich, dass jetzt zumindest ein paar Aufgaben erledigt werden. Akribisch verfolgt er die Aufgaben auch an dem Board und es stellt sich ein gutes Gefühl ein, weil der Haufen an Aufgaben nur noch langsamer wächst, allerdings bemerkt er ebenfalls kritisch, dass doch noch eine Menge Aufgaben zu spät erledigt werden.
Erstmals muss Thomas auch den übergreifenden Projektfortschritt bei seinen Vorgesetzten melden und ihm wird recht schnell deutlich, dass diese mit dem Ergebnis bisher nicht zufrieden sind. Also setzt er sich am Wochenende wieder hin und sortiert die Aufgaben, Zuständigkeiten und Fristen neu und freut sich am Sonntagabend über seinen Plan, den er gleich am Montag mit seinem Team zur Umsetzung bringen will.
Am Montag ist nur die Hälfte der Teammitglieder anwesend und Thomas gefällt das gar nicht. Er hat am Nachmittag ein paar kritische Gespräche zum Thema Anwesenheit mit den fehlenden Teammitgliedern. Am Donnerstag soll er dann erneut gegenüber der Geschäftsführung berichten und je näher der Termin rückt, umso nervöser wird er, weil sein Team die Aufgaben, die er vergeben hat, einfach nicht in der vorgegebenen Zeit abgearbeitet bekommt.
Die Vorstellung am Donnerstag endet dann in einem gefühlten Desaster, weil Thomas‘ Kompetenz von dessen Vorgesetzten in Frage gestellt wird. Es geht vor allem um Fragen nach der Führung des Teams. Vollkommen frustriert verlässt er den Termin und nimmt sich vor, es sich einfach nicht mehr gefallen zu lassen.
Am Freitagmorgen geht er mit sichtlich schlechter Laune auf sein Team zu und konfrontiert es mit den schlechten Ergebnissen, die bis dato erzielt worden sind. ER lässt seinen ganzen Frust raus und bebt geradezu vor Wut. Einzelne Teammitglieder starren ihn ängstlich an und er merkt, dass sie sich zurückziehen. Plötzlich bekommt er Angst. Hat er es übertrieben? Er braucht doch die Zuarbeit vom Team. Ohne das Team wird es gar nicht gehen. Er bricht die Sitzung abrupt ab und zieht sich zurück. Völlig verwirrt läuft er durch die Hallen und weiß nicht, wo ihm der Kopf steht.
Nach dem Mittag kann er sich nochmals aufraffen und er versucht einen Plan zu machen. Der Aufgabenhaufen hat sich inzwischen zu einem schier unüberwindlichen Berg aufgetürmt und es erscheint ihm vollkommen unmöglich, dass er die aufgelisteten Aufgaben in irgendeiner Weise abdecken kann.
Da klopft es an seiner Tür. Er ist schon fast erleichtert über die Unterbrechung, weil er aus seinen fast panischen Gedanken gerissen wird. Vor der Tür stehen Petra und Oliver, die Lieferantenbetreuer, er bittet sie herein. Sie nehmen in aller Ruhe Platz an dem kleinen Besprechungstisch und überreichen ihm dann, beide mit einem diebischen Grinsen im Gesicht, ihre Kündigungen.
Die Sinnhaftigkeit der Aufgabe
Die meisten denken nicht mal bis zum Tellerrand