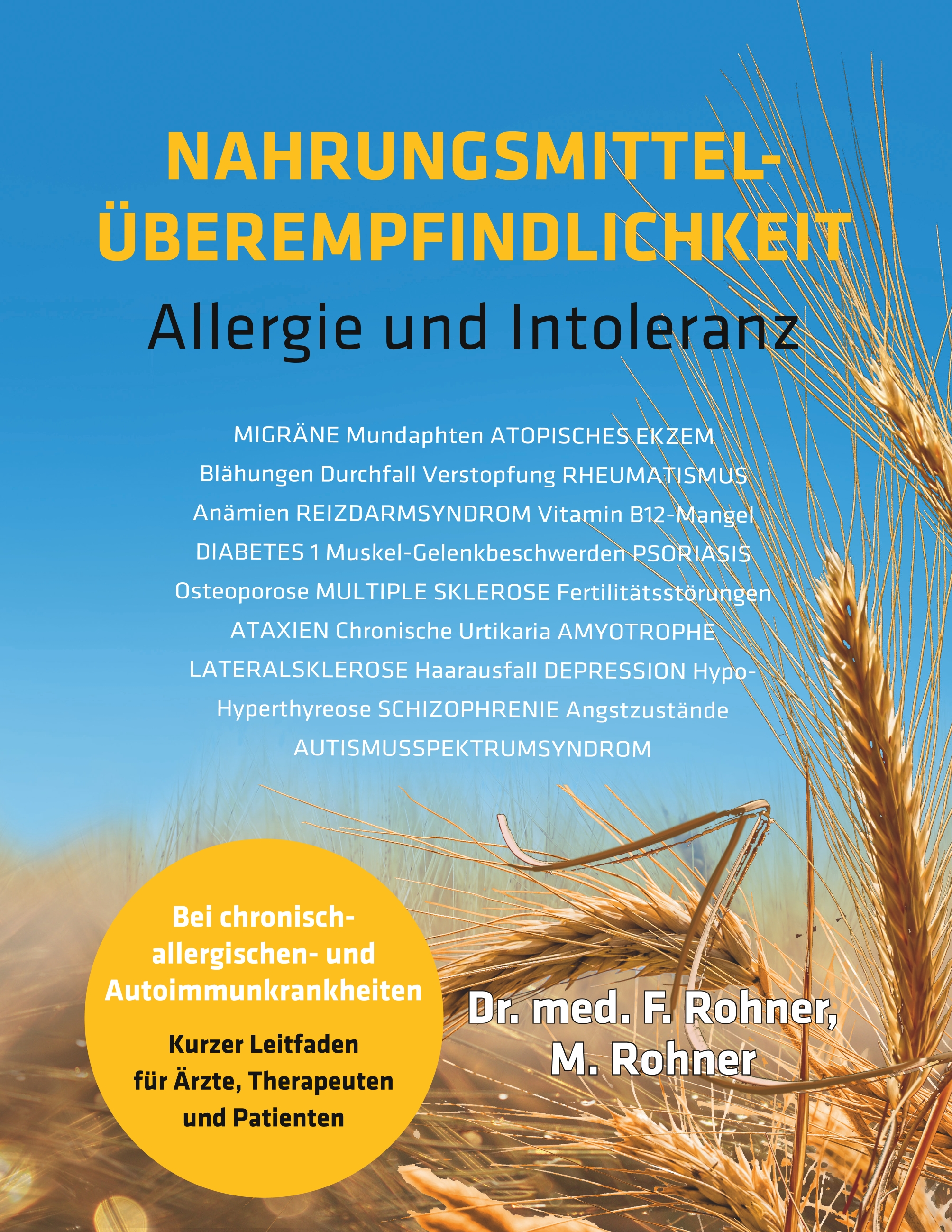
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Nahrungsmittelüberempfindlichkeit als Oberbegriff für Allergien sowie nicht-allergische Intoleranzerscheinungen repräsentiert einen bedeutenden Anteil unseres Krankengutes. Ausführliche Texte zu diesem Thema sind vorhanden, richten jedoch den Fokus oft nur auf akute allergische Reaktionen, wie z. B. eine Erdbeer- oder Nussallergie aus. Im Gegensatz dazu befasst sich dieses Buch mit chronischen allergischen- und Intoleranzerscheinungen, deren Entstehung sowie den möglichen Auswirkungen auf den menschlichen Organismus. Der Fokus richtet sich v. A. auf das unterschätzte Thema einer GLUTEN oder einer NICHT-GLUTEN bedingten chronischen Nahrungsmittelüberempfindlickeit. Dieser Aspekt weist auf eine viel größere Anzahl von Krankheiten mit einem immunologischen Hintergrund hin. Beispiele sind rheumatische, neurologische, psychiatrische Erkrankungen aber auch spezielle Symptome wie Mundaphthen, Anämien, Haarausfall und Fertilitätsstörungen. Eine genaue Abklärung und spezifische diätetische Maßnahmen werden besprochen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Literaturverzeichnis
Vorwort
Nahrungsmittelüberempfindlichkeit, als Oberbegriff für Allergien sowie nicht-allergische Intoleranzerscheinungen, repräsentiert einen bedeutenden Anteil unseres Krankengutes. Ausführliche Texte zu diesem Thema sind vorhanden, richten den Fokus jedoch oft (nur) auf akute allergische Reaktionen, wie z.B. eine Erdbeer- oder Nussallergie aus.
Im Gegensatz dazu befasst sich dieses Buch ausführlich mit chronischen allergischen und Intoleranzerscheinungen, deren Entstehung sowie möglichen Auswirkungen auf den menschlichen Organismus.
Dieser Aspekt einer Nahrungsmittelüberempfindlichkeit deckt ein weit größeres Panorama von Krankheiten ab, welche einen immunologischen Hintergrund aufweisen können. Beispiele sind das Reizdarmsyndrom, rheumatische, neurologische, psychiatrische und weitere im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Krankheiten. Diese Erkrankungen werden oft als »idiopathisch« oder »multifaktoriell« klassifiziert, da die reale Ursache meist als unbekannt bezeichnet wird.
Mit »multifaktoriell« sind verschiedene bekannte und unbekannte, teilweise schwer bewertbare Faktoren gemeint, z.B. werden klimatische Einflüsse erwähnt, weiterhin mögliche Mangelerscheinungen auf Grund ausgelaugter Ackerböden (Magnesium-Selen-Mangel?) sowie subklinische Herdinfektionen (Zahnpathologie etc.). Ein neues Forschungsgebiet befasst sich mit der Bedeutung der Darmflora, welche eine Schlüsselposition in vielen der hier nachträglich behandelten Krankheiten einnehmen könnte.
Im Folgenden wird jedoch die Auffassung vertreten, dass in einer nicht unerheblichen Anzahl von Fällen die Ursache in einer »chronisch-allergischen« oder »Intoleranz«-Reaktion auf Nahrungsmittel zu suchen sein könnte. Dies belegen während mehreren Jahrzehnten verfasste medizinische Publikationen. Auffinden und Ausschluss der verantwortlichen Nahrungsmittel könnte somit zu einer Besserung oder gar zur Heilung führen.
Der Anstoß für dieses Interessengebiet entstand vor mehr als 30 Jahren durch einen Fall einer Patientin, welche an einer Pustulosis-Palmoplantaris, eine Schwestererkrankung der Schuppenflechte erkrankt war. Systemische und topische Kortisonbehandlungen und andere immunsuppressive Therapien sind der heutige Goldstandard. Allerdings sind diese Medikamente teils sehr teuer und mit Langzeitkomplikationen behaftet.
Durch reinen Zufall erwies sich doch, dass das kurze Wort GLUTEN die Lösung war. Nach einer Umstellung auf eine glutenfreie Diät kam es zu einer vollständigen und permanenten Remission der Hautkrankheit. Weitere Hinweise, dass es sich um eine echte Zöliakie handeln könnte, war das spätere Auftreten von typischen glutenassoziierten Komplikationen wie einer Thyreotoxikose sowie einem Diabetes Mellitus Typ 1 (LADA). Jahre später erkrankte der Sohn dieser Patienten an diffusen Hautpigmentstörungen und noch ernsthafter an zunehmenden neuromuskulären Degenerationserscheinungen sowie fokalen epileptischen Anfällen. Durch die Erfahrung mit dem ersten Fall belehrt, führte auch hier eine Umstellung auf eine glutenfreie Diät zu einer vollständigen Remission.
Sowohl Mutter als Sohn hatten keine für eine Zöliakie typischen Darmsymptome; bei beiden hatten willkürliche oder unwillkürliche Diätabweichungen unmittelbare Folgen mit Wiederauftreten der initialen Beschwerden.
Diese unerwartete Erfahrungen waren ein »Aha-Erlebnis« und der Schlüssel für den Zugang zu einer für uns bisher unbekannten Welt einer ernährungsbedingten Krankheitsentstehung. Offiziell war die Zöliakie für einen ausgebildeten Pädiater ja v.a. eine Kinderkrankheit mit gastrointestinalen Symptomen und einer relativ unbedeutenden Häufigkeit von 1 % in einer Allgemeinpopulation.
Wertvolle Hilfe für diese nun langjährige Auseinandersetzung mit diesem Thema waren einige zu dieser Zeit publizierte wegleitende Studien. Aus einem im »Lancet« publizierten Artikel mit dem Titel »Is the coeliac disease cause of various associated diseases?« ging hervor, das Gluten nicht nur ein assoziativer Faktor war, sondern das eigentliche verursachende Antigen bei der Entstehung von etlichen Erkrankungen sein könnte.
Unsere nachfolgende intensive Literaturrecherche konnte dies weitgehend bestätigen. Es wurde deutlich, dass sich die Zöliakie vor allem bei Erwachsenen weit häufiger als verborgen oder »kryptisch« manifestiert als die bekannte Form der klassischen Zöliakie, mit den intestinalen Symptomen. Dies ist das erste wichtige Fazit.
Es ist nunmehr nicht übertrieben zu behaupten, dass bei einer Vielzahl der im Titel dieses Buches aufgeführten Krankheiten, wie z.B. einer Anämie, einer Osteoporose, internmedizinischen, neurologischen und neuropsychiatrischen Erkrankungen, Gluten als eigentlicher Verursacher sich dahinter evtl. verbergen könnte. Deshalb würden diese Krankheitsentitäten eine Reevaluation verdienen. Dieser Aspekt wird vom »Mainstream« des medizinischen Kollektivs vielleicht unterschätzt.
Eine weitere wichtige (und heute vergessene) Publikation zu seiner Zeit im »Lancet« war eine Studie des pädiatrischen Immunologen Soothill aus London über (in diesem Buch später ausführlich behandelte) Migräne, bei welcher er die üblichen akademischen und formalistischen Begriffe wie »Ist das eine Allergie oder eine andere Nahrungsmittelunverträglichkeit?« über den Haufen warf. Die Patienten wurden initial auf eine oligoantigene Diät gestellt. Dabei verschwand überraschenderweise nicht nur die Migräne, sondern verschiedene üblicherweise nicht mit Nahrungsmitteln assoziierte Symptome, u.a. epileptische Anfälle, rheumatische sowie neuropsychiatrische Beschwerden.
Darüber hinaus erschien deutlich, dass nicht nur Gluten und Milchprodukte, sondern eine Vielfalt – mehr als zwanzig – andere Nahrungsmittel als Verursacher in Frage kommen könnte. Deshalb ist das in der üblichen Allergologie angewendete Exklusionsverfahren irreführend und muss daher als fraglich bzw. als eine Illusion bei diesen nahrungsmittelinduzierten Erkrankungen bezeichnet werden.
Dies ist das zweite wichtige Fazit.
Klinische Diätstudien ohne gleichzeitige Untersuchung stützender oder negativ ausfallender Laborparameter sind mit einem deutlichen Nachteil behaftet. In dieser Hinsicht kann man eine Studie über vegetarisch ernährten Rheumapatienten zitieren. Bei 12 Patienten erfolgte eine klinische Besserung unter einer Fastenperiode und gleichzeitig normalisierte sich ein dünndarmspezifischer Resorptionstest (PEG), um bei Wiederaufnahme der vorbestandenen vegetarischen Diät wieder pathologisch auszufallen. Dieses Beispiel zeigt, dass eine eindeutige Qualitätsverbesserung erzielt werden kann, wenn man bei Durchführung von Diätversuchen jeweils gastroenterologische Parameter (z.B. PEG, Folat, Eisen etc.) miteinbezieht.
Mit der Annahme, dass es sich hier um einen zöliakieähnlichen pathophysiologischen Mechanismus handelt, könnte bei einer Reihe von »idiopathischen«, heute in unterschiedlichen Abteilungen innerhalb der Medizin untergebrachten und ohne offensichtlichen Zusammenhang unter sich stehenden Krankheitsbildern künftig doch ein gemeinsamer Nenner bzw. ein weitgehend identischer Hintergrund gefunden werden.
Die Zöliakie ist ja der Prototyp für eine allgemein anerkannte nahrungsbedingte Erkrankung, bei welcher die Ursache, die noch nicht genau erforschten Mechanismen einer Antigeneinwirkung auf das »innere Milieu« und schlussendlich die möglichen multiplen klinischen Endeffekte bekannt sind.
Die Plausibilität dieser Hypothese wird sowohl aus älteren Studien wie aus neuen Publikationen ersichtlich. Neuerdings hat sich am Beispiel des pädiatrischen nephrotischen Syndroms erwiesen, dass es in der Mehrzahl (sechs von acht) untersuchten Fällen mit einer u.a. glutenfreien Diät zu einer vollständigen Remission kam. Ein anderes, als Revolution zu bewertendes Beispiel sind neulich beschriebene Krankheitsfälle von Diabetes Typ 1, bei denen eine glutenfreie Ernährung zu einer Regression des Krankheitsgeschehens führte. Dies unabhängig vom Ausfall der üblichen serologischen glutenbeweisenden Labortests. (Der Unterzeichnete hatte schon 1993 eine Arbeit mit dem Titel »Coeliac disease, valid pathophysiologic model in studying chronic-allergic and autoimmun diseases; etiology of the diabetes Type 1« eingereicht.)
Dieses Buch richtet sich im Wesentlichen an zwei Leserkategorien. Für den praktisch tätigen Arzt oder Therapeuten sollte es ein möglichst einwandfreies pathophysiologisches Modell als Arbeitsunterlage liefern, mit der Möglichkeit, welche das Internet heute bietet, eigene Erfahrungen und Kenntnisse weiter auszubauen. Im Laufe der Zeit wurde der Text jedoch so formuliert, dass er für einen weiteren interessierten Leserkreis geeignet sein könnte. Betroffene Patienten können dieses Buch individuell als Nachschlagewerk benützen. Für das tiefere Verständnis gewisser Zusammenhänge ist jedoch auch die Lektüre des ersten allgemeinen Teils zu empfehlen.
Wohl ist die Mehrzahl der Bevölkerung verschont von den hier aufgeführten Erkrankungen, doch weisen ungefähr 30–40 % einer nordwesteuropäischen Gesellschaft ein genetisch bedingtes Potential für eine mögliche Entwicklung dieser chronisch-allergischen Krankheiten auf.
Es liegt den Autoren fern anzunehmen, dass allen Patienten geholfen werden könnte und alle erwähnten Symptommanifestationen auf solche allergische und Intoleranzmechanismen zurückzuführen sind.
Selbstverständlich können auch viele andere Ursachenfaktoren in Betracht kommen. Andererseits weist die Pharmaindustrie große Fortschritte auf und ist oft in der Lage, eine echte Alternative mit einer medikamentösen Behandlung anzubieten, welche einfacher, aber auch komplikationsreicher und teurer zu stehen kommen kann.
Man kann trotzdem schon vorwegnehmen, dass mit dem Beispiel der Schuppenflechte mindestens 10–40 % der Patienten mit einem Getreideproduktverzicht eine wesentliche Besserung erfahren könnten. Dies belegen später in diesem Text angeführte Literaturangaben eindeutig.
Allein für die Bundesrepublik bedeutet dieses Fazit in Zahlen, dass weit mehr als eine Million betroffener Patienten eine bedeutende Verbesserung ihrer Lebensqualität haben könnten; nicht zu reden von bedeutenden Einsparungen im staatlichen Gesundheitsbudget.
Die Auffassung, dass unsere Grundnahrungsmittel, wie Getreide- und Milchprodukte, einen wesentlichen Anteil an der Entstehung verschiedener chronisch-allergischen und Autoimmunkrankheiten haben, erschien bis vor kurzem recht unrealistisch. Jedoch ist in den letzten Jahren ein Umdenken in dieser Frage erfolgt, nicht zuletzt auf Grund anthropologischer Argumente. Diese besagen, dass ca. 90 % unserer aktuellen Lebensmittel erst seit ungefähr 10 000 Jahren in unser Ernährungsarsenal eingeführt wurden, was eine allzu kurze Zeit darstellt, um dem Immunsystem die Möglichkeit einer Adaptation zu erlauben. In dieser Hinsicht empfiehlt sich die Lektüre von Physiologieprofessor Loren Cordains »Cereal grains: Humanity’s doubleedged sword«. Er weist auf die Folgen unserer heutigen Ernährungsgewohnheiten hin, für welche wir genetisch nicht angepasst sind.
Das Buch widerspiegelt die diesbezügliche Forschung in den letzten 30 Jahren. Sowohl ältere epochemachende klinische Untersuchungen über den Zusammenhang von Nahrungsmitteln und spezifischen Krankheiten als auch neueste Erkenntnisse über die Bedeutung der Darmflora wurden berücksichtigt.
Für die wertvolle Hilfe unserer Söhne Andreas Rohner und Jean-Christophe Rohner mit u.a. Textverfassung, Layout und Tabellen sowie für das grammatikalische Korrekturlesen von Esti Dürrenberger möchten wir uns an dieser Stelle besonders bedanken.
Francois Rohner
Marianne Rohner
1. Einleitung
Eine eventuelle Beziehung zwischen Ernährungsgewohnheiten und Gesunderhaltung oder Krankheit ist ein permanent aktuelles Thema und kann verschiedene Aspekte aufweisen. Am offensichtlichsten ist die Relation zwischen Input und Output, d.h. eine rein rechnerische Bilanz in Kalorien gemessen, zwischen Einnahme und Ausgabe. Ein weiterer Faktor kann in einer Fehlverteilung zwischen den Hauptkomponenten unserer Ernährung, d.h. den jeweiligen Anteilen von Eiweiß, Fett und Kohlehydraten in der täglichen Kost liegen. Zu viel Fett bedeutet Einlagerungserscheinungen, zu viel Kohlehydrate bedingen eine chronische Insulinstimulierung mit all ihren Folgen.
Wie im Vorwort erwähnt, widmet sich das Thema dieses Buches einem anderen Sachverhalt. Es wird versucht, einen wissenschaftlich dokumentierten Nachweis zu erbringen, dass bei einer ausgewählten erblich belasteten Gruppe von Patienten eine Überempfindlichkeit gegen spezifische Nahrungsmittel bestehen könnte und eine damit verbundene Ursache bei einer Reihe von chronischen Krankheitsbildern darstellen könnte. Diese gelten jedoch meistens als »idiopathisch« bedingte Krankheiten, d.h. ohne bekannte Ursache.
Im Gegensatz zu diesem Standpunkt wird in diesem Buch die Behauptung vertreten, dass in einer nicht geringen Proportion diese Krankheitserscheinungen in Wirklichkeit auf einer im weitesten Sinne »allergischen« oder »Intoleranzreaktion« auf bestimmte Nahrungsmittel beruhen könnten. Diese könnten als fremd empfunden werden und Verteidigungsmechanismen hervorrufen, d.h. eine immunologische Reaktion. Eine Elimination eines oder evtl. mehrerer Nahrungsmittel – in diesem Zusammenhang Antigene benannt – könnte den Verlauf dieser Erkrankungen entschieden verändern, einen verminderten Medikamentenverbrauch und wesentliche Einsparungen im persönlichen und staatlichen Gesundheitsbudget bedeuten.
Beispiele sind Krankheiten wie das Reizdarmsyndrom, die Migräne, Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis, das atopische Asthma und die atopische Dermatitis, Psoriasis (Schuppenflechte) etc. Weiterhin gehören in dieses Kapitel chronische Müdigkeitserscheinungen, chronische unklare Anämien, Alopezien (Haarausfall), Osteoporose, Depressionszustände, Verhaltensstörungen wie Autismus und Schizophrenie, Hyperaktivitätssyndrome bei Jugendlichen usw.
Da diese Krankheitsbilder im Allgemeinen als idiopathisch bezeichnet werden, beschränkt sich deshalb heutzutage eine Behandlung auf weitgehend symptomatische Maßnahmen; dabei werden die Ursachen jedoch nicht behoben.
Dieses Buch baut sich im Wesentlichen auf folgende Punkte und Schritte auf:
Die in diesem Zusammenhang häufigsten Treffer, welche die offizielle medizinische Literatur dazu liefert, gelten dem in den Getreideprodukten vorkommenden Glutenmolekülkomplex, der im engsten Sinne für die Zöliakie verantwortlich ist. Dies erscheint prima vista erstaunlich, da Getreideprodukte und dessen Glutenanteil zu unseren »natürlichsten« Ernährungsquellen zählen. Dass diese »Natürlichkeit« nicht so vollumfänglich stimmt, geht vor allem aus der neuerdings aktualisierten Evolutionsbiologie hervor. Entsprechend dieser Erkenntnisse gehörten Getreide- und Milchprodukte nicht zu den Ernährungsgewohnheiten unter der einige hunderttausend Jahre dauernden Evolution des Homo sapiens. Sie wurden erstmals vor ca. 10 000 Jahren zusammen mit dem Übergang einer Jäger-Beerensammelkultur zu einer sesshaften Agrargesellschaft eingeführt. Über 90 % der heute konsumierten Nahrungsmittel gehörten unter der langen Evolution des Homo sapiens nicht zum Ernährungsarsenal.
Vor allem die Erwachsenenpathologie liefert Anhaltspunkte dafür, dass die Anzahl von glutenempfindlichen Patienten möglicherweise viel größer sein könnte als derjenigen, welche die bis heute ausschließlich anerkannten engen ESPGHAN1-Kriterien für das Vorliegen einer Zöliakie erfüllen. Diese Kriterien beinhalten folgende Punkte: gastrointestinale Symptome, Nachweis eines erhöhten Transglutaminaseantikörpertiter sowie eine Verbesserung unter einer glutenfreien Kost. Bei nur mäßiger Erhöhung eines Antikörpertiters muss eine Dünndarmbiopsie vorgenommen werden. Auch ein positiver Ausfall des HLA DQ2/8 ist erforderlich.
Im Gesamtbild geht aus den uns zur Verfügung stehenden und hier zitierten Literaturquellen hervor, dass Getreideprodukte, u.a. der Glutenmolekülkomplex und vielleicht auch die Milchprodukte, bei den hier abgehandelten immunologischen Krankheiten eine viel ausgeprägtere Position einnehmen als nur dem der Zöliakie entsprechenden kleinen und engen Diagnosenkomplex entsprechend der ESPGHAN-Definition. Ob Gluten oder die Lektine2, wie u.a. WGA und ATI, welche u.a. in den Getreideprodukten potente Abwehrfaktoren darstellen, die wirklichen schädlichen Komponenten sind, kann mit den vorliegenden Kenntnissen nicht entschieden werden. Der hohe Gehalt an Phytinsäure, v.a. in den Vollkornprodukten, bewirkt eine verminderte Aufnahme von Kalzium, Magnesium, Eisen und Zink. Mit der Einnahme von Getreideprodukten werden nicht nur Gluten, sondern auch diese verschiedenen potentiell schädlichen Bestandteile wie z.B. WGA (Wheat Germ Agglutinin), ATI (Amylase Trypsin-Inhibitoren) sowie FODMAP-Komponenten (Fermentable-Oligo-Disaccharid-Momo und Polyole), welche u.a. in den Getreideprodukten enthalten sind, eingenommen. Dies ist zu berücksichtigen, wenn bei entsprechenden Symptomen eine Glutenserologie negativ ausfällt und eine glutenfreie Diät trotzdem erfolgreich ist, was bei dem später beschriebenen und neu aufgekommenen Diagnosenkomplex der NCGS (Non Coeliac Gluten-Sensitivity) oder GS (Gluten Sensitivity) der Fall sein könnte. Die universelle einseitige Ausbreitung des Getreidekonsums muss als einer der heißesten Kandidaten für mögliche Schadwirkungen an der Dünndarmschleimhaut gelten. Nicht umsonst ist das Gluten als latentes Gift in unserer Ernährung bezeichnet worden. Somit könnte, wie hier nachträglich untersucht werden wird, der Pool glutenempfindlicher Patienten sich als viel größer erweisen als bis anhin angenommen wird. Darüber hinaus stellt Gluten ein Schlüsselantigen dar, welches als Wegbereiter für den Zutritt anderer Nahrungsmittelallergenen zum »inneren Milieu« verantwortlich sein könnte.
In einem weiteren Schritt soll gezeigt werden, dass entsprechend den Literaturquellen eine Assoziation zwischen Gluten und verschiedenen chronisch-allergischen und Autoimmunkrankheiten nachgewiesen ist, dies sowohl aus genetischen Gründen als auch von der klinischen Evidenz her. Dies ist eine
unumstrittene Tatsache
.
Im nächsten Schritt wird zu belegen versucht, dass in einigen Fällen Gluten nicht nur ein assoziierter Faktor ist, sondern dass er den eigentlichen Verursacher bei diesen Krankheiten darstellen kann.
Dieser Punkt ist umstritten
und hängt v.a. auch von der angewandten Diätsuchmethode ab.
Danach werden klinische Daten präsentiert, welche belegen, dass auch andere, nicht glutenenthaltende Nahrungsmitteleiweiße ebenso als Verursacher ähnlicher Erkrankungen in Frage kommen könnten.
Schlussendlich muss eine wichtige methodologische Eigenheit hervorgehoben werden. Diese chronischen immunologischen Erkrankungen folgen nicht einem »sofort«-allergischen Reaktionsmechanismus. Meist weisen sie einen verzögerten immunologischen Reaktionstyp auf. Bei einem verzögerten Vorgang treten Symptome erst spät ein und können deshalb nicht leicht auf ein eben eingenommenes Nahrungsmittel zurückgeführt werden. Dazu kommt – wie später hier beschrieben –, dass prinzipiell eine Vielzahl von Antigenen in Frage kommen können. Heute wird in der Allergologie oft die Methode einer »Eliminations«-Praxis angewendet. Diese stützt sich auf IgE/RAST/Hauttests und ist nur bei Sofortreaktionen anwendbar. Bei verzögerten immunologischen Mechanismen ist deshalb eine diametral verschiedene Untersuchungsmethode angebracht, welche initial die meisten vermuteten Antigene ausschließt. Anschließend wird versucht, Schritt für Schritt eine adäquate Diät aufzubauen.
Darüber hinaus ist es von Bedeutung, dass bei einer Abklärung von chronischen allergischen und autoimmunen Zuständen eine
allergologische
Untersuchung (inklusive Zöliakieserologie) mit einer
gastroenterologischen





























