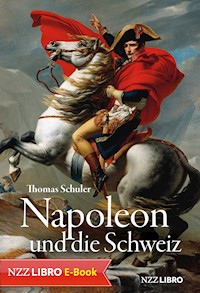
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zwischen 1798 und 1815 stand auf Messers Schneide, ob die Schweiz wie Venedig, Polen und Hunderte deutsche Länder unwiederbringlich von der europäischen Landkarte verschwinden sollte. Napoleon wirkte 1798 wesentlich daran mit, dass Frankreich die Schweiz angriff und eroberte. Die darauffolgenden Phasen der Helvetik, der Mediation und des Wiener Kongresses prägten die Schweiz nachhaltig. Insbesondere als Napoleon 1803 die Mediation stiftete und mit der Gründung von sechs neuen Kantonen die bürgerkriegsähnlichen Zustände beendete, schuf er eine wichtige Grundlage der modernen Schweiz. Napoleon und die Schweiz ist die erste Gesamtdarstellung zu Napoleon Bonapartes Wirken in der Schweiz. Dabei erläutert der Historiker und Napoleon-Experte Thomas Schuler anschaulich die Ursachen und Folgen der «Franzosenzeit» für die Schweiz und deren Position in Europa. Er eröffnet einen neuen Blick auf Napoleon, indem er sich auf Archiv- und Literaturrecherchen und auf Besuche an einschlägi-gen Schauplätzen stützt – nicht nur in der Schweiz und in Deutschland, sondern auch an der weissrussischen Beresina, wo Schweizer Soldaten für Napoleon kämpften. So verknüpft Schuler die spannende Schilderung der Ereignisse zwischen 1789 und 1815 mit unserer Gegenwart und macht deutlich, wie bedeutend Napoleon für die Schweiz war und wie viel aus dieser Zeit bis heute wirksam ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
«Die Geschichte wird entscheiden, ob es für den Frieden der Welt nicht besser gewesen wäre, wenn weder Rousseau noch ich je geboren worden wären.»1
Napoleon
Thomas Schuler
Napoleon
und die Schweiz
NZZ Libro
Die Rechtschreibung der zeitgenössischen Quellen wurde einer besseren Lesbarkeit halber der heutigen Rechtschreibung angepasst.
Der Autor und der Verlag danken herzlich:
Gedruckt mit Unterstützung der ULRICO HOEPLI-STIFTUNG, ZÜRICH
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2022 (ISBN 978-3-907291-85-6)
© 2022 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Lektorat: Regula Walser, Zürich
Korrektorat: Sandro Malär, Wädenswil
Umschlag: Grafik Weiss GmbH, Freiburg i. B.
Gestaltung, Satz: Claudia Wild, Konstanz
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN Druckausgabe 978-3-907291-85-6
ISBN E-Book 978-3-907291-86-3
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Inhalt
Vorwort
Tuilerien, 10. August 1792
Kapitel IDie Schweiz am Vorabend des Überfalls
Kapitel IIDer Goldraub von Bern
Kapitel IIIDas Massaker von Stans
Peter von Matt:Die Wahrheit und die Bajonette
Kapitel IVDas russische Bajonett hat die Alpen durchbrochen
Kapitel VNapoleon am Grossen St. Bernhard
Kapitel VIDie Helvetik
Kapitel VIIDie Mediation
Kapitel VIIIDie Schweiz im Europa Napoleons
Kapitel IXBeresina
Kapitel XBasel als Schauplatz der Weltgeschichte
Kapitel XIDie Neuverteilung Europas
Kapitel XIIDie Schweiz nach Napoleon
Anmerkungen
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Vorwort
«Ein Menschenleben reicht nicht aus, um alles, was über ‹Napoleon und die Schweiz› geschrieben wurde, zu lesen», sagte während eines Treffens in Bern Jürg Stüssi-Lauterburg zu mir. Hinzu kommt, dass allein über Napoleon mehr als eine Million Bücher geschrieben wurden, was die Frage nach dem Wesentlichen in dieser schieren Masse an Quellen und Literatur zu keiner einfachen macht.
Fest steht, dass ohne den räuberischen französischen Überfall von 1798 die festgefahrenen Strukturen der Schweiz des Ancien Régime noch sehr lange nicht aufgebrochen worden wären. Durch die von Napoleon gestiftete Mediation von 1803 wurden die Grundlagen für die Entwicklung eines modernen, föderalistischen Staatswesens – ohne Untertanen – geschaffen. Im Jahr 1806 hätte Napoleon die Eidgenossenschaft um ein Haar an das verbündete Baden gegeben, die dann, wie Venedig und Hunderte deutscher Einzelstaaten, als eigenständiges Land unwiderruflich aufgehört hätte zu bestehen.
Wegweisend für die aussenpolitische Zukunft der Schweiz war die auf dem Wiener Kongress von den Grossmächten auferlegte Neutralität, die in der langfristigen Konsequenz dazu führte, dass die Schweiz von den Stürmen zweier Weltkriege im 20.Jahrhundert nahezu unberührt blieb und zu dem kulturell vielfältigen und prosperierenden Land wurde, das sie heute ist.
Neben der Darstellung dieser historisch dramatischen Ereignisse war es dem Autor ein Anliegen, einen tieferen Blick auf die Geschichte zu werfen im Sinne dessen, was die Schweizer Psychoanalytikerin und Mitarbeiterin von C. G. Jung, Marie-Louise von Franz, wie folgt formulierte:
«Man könnte sagen, das was wir in der Schule als Geschichtsprozess lernen, das Kommen und Gehen von Kulturen und Nationen, die alle im Staub der Finsternis und im Todeswasser der Vergänglichkeit vergehen, dass darunter noch ein weiterer Strom des Geschehens ist. Ein allmählicher, ganz langsam sich über die Jahrhunderte erstreckender Bewusstwerdungsprozess der Menschheit. Und um den geht es.»
Ob Marie-Louise von Franz damit dasselbe meinte, wozu Friedrich Schiller, der Autor des Wilhelm Tell, aufgefordert hatte, dass es bei der Beschäftigung mit Geschichte darum gehe, «sich als Mensch auszubilden», lässt sich nicht eindeutig sagen. Unumstritten aber ist, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im menschlichen Geist immer im Jetzt stattfinden.
Dafür, dass dieses Buch auf diese Weise geschrieben werden konnte, muss ich meinem Freund Matthias Hasenauer danken, der mich auf den Schutzheiligen der Schweiz, Niklaus von Flüe, aufmerksam gemacht hat. Herausfordernd stellte er sich immer dazwischen, wenn ich versucht war, Geschichte, und damit meine ich auch meine eigene, auf die einfache Aneinanderreihung von Fakten zu beschränken, anstatt dem Raum zu geben, was uns alle, die ganze Menschheit trägt. In gleicher Weise möchte ich meiner Frau Monika Natalie, meiner Mutter Elisabeth und meiner Schwiegermutter Eva danken, ohne deren enorme zeitliche und finanzielle Unterstützung die Entstehung dieses Buches nicht möglich gewesen wäre. Mein weiterer Dank gilt von Herzen Nikolaus Fürst Blücher von Wahlstatt, dem Schriftsteller Peter von Matt sowie den Schweizer Historikern Jürg Stüssi-Lauterburg, Christian Schweizer und Peter Steiner aus Stans, die mir über manchen Alpenpass geholfen haben.
Tuilerien, 10.August 1792
Abb.1: Der Sturm auf die Tuilerien von Jean Duplessis-Bertaux, Öl auf Leinwand, 1793. Das Werk entstand bereits wenige Monate nach dem blutigen Geschehen im August 1792. Napoleon war als 22-jähriger, unbekannter Offizier zufällig Augenzeuge des Massakers.
Schweissnass standen die rotuniformierten Schweizer Leibgardisten auf den Steintreppen der Tuilerien und feuerten auf den fanatisch anstürmenden Pöbel.2 Schwere Kanonen donnerten auf den prächtigen, unter Katharina von Medici erbauten Königspalast, Fenster zerbarsten, schwarze Rauchschwaden drangen hervor. Danton hatte 80000Patronen unter den Angreifern austeilen lassen, die zusätzlich zu ihren Gewehren mit Piken, Äxten, Messern und Bratspiessen bewaffnet waren. Die 700 tapferen Schweizer Gardisten3 verteidigten die Tuilerien, ihrem Eid getreu, Saal für Saal. Als einigen Dutzend von ihnen in den oberen Stockwerken die Munition ausging, wurden sie ergriffen und lebendig aus den Fenstern geworfen.4
Da sich der französische König Ludwig XVI. in den Schutz der Nationalversammlung begeben hatte, verteidigten die Schweizer ein leeres Gebäude und starben für ein steinernes Symbol der dem Untergang geweihten Königsherrschaft. Ein Symbol, das der König aber gar nicht verteidigt sehen wollte. Als der Kanonendonner zur Nationalversammlung herüberdrang, unterzeichnete er ängstlich einen Befehl, der die Garde zur sofortigen Einstellung aller Kampfhandlungen und zum Rückzug in die Kasernen aufforderte. Ohne es zu ahnen, hatte Ludwig XVI. damit das Todesurteil seiner Garde unterschrieben.
Der Befehl erreichte die Offiziere an der östlichen Seite der Tuilerien nahe des Louvre. Obwohl 200Mann das Feuer unverzüglich einstellten, wurden sie von den Angreifern weiter beschossen und zum Teil an Ort und Stelle massakriert. Da der Befehl nicht auf die andere Seite der Tuilerien vorgedrungen war, wurde der Kampf um Leben und Tod dort fortgesetzt. In den königlichen Gärten erlagen die Schweizer der tausendfachen Übermacht, wurden mit Knüppeln erschlagen, niedergestochen oder erschossen. In einem kollektiven Blutrausch wurden ihre Leichen in Stücke gehauen, die abgehackten Köpfe und Körperteile auf Piken gesteckt und wie Trophäen durch die Strassen getragen. Ein junger Artillerieleutnant in Zivil, der in diesen Augenblicken über die Rue des Petits Champs in Richtung der Tuilerien unterwegs war, berichtete, wie ihm «ein Haufen zerlumpter Kerle entgegen [kam], die einen auf eine Spitze aufgespiessten Kopf vor sich hertrugen. Da sie mich einigermassen anständig gekleidet sahen und wohl einen Herrn in mir vermuteten, kamen sie auf mich zu, um mich ‹Vive la Nation› rufen zu lassen. Wie man sich denken kann, fiel mir das nicht schwer.»5
Der Augenzeuge war der zu diesem Zeitpunkt vollkommen unbekannte Napoleon Bonaparte. Nach dem Massaker wagte sich der 22-Jährige in die verwüsteten Gärten der Tuilerien, wo die verstümmelten und enthaupteten Leichen Hunderter Schweizer Gardisten ein Bild des Grauens boten.
«Niemals», erinnerte sich Napoleon, «hat mir später eins meiner Schlachtfelder auch nur annähernd den Eindruck so vieler Leichen gemacht, wie es mir hier bei der Menge toter Schweizer der Fall zu sein schien.»6
Kapitel I
Die Schweiz am Vorabend des Überfalls
«Von freien Vätern erzeugt, sollen wir freie Söhne sein.»7
Stäfner Memorial, 1794
Die Schweiz des Ancien Régime
Die Heimat der beim Tuileriensturm in Paris niedergemetzelten Schweizer Garden war ein loser Staatenbund aus 13Kantonen.8 Im Ausland wurde das Geburtsland von Wilhelm Tell oft als romantisch verklärter Hort der Freiheit wahrgenommen. In Wirklichkeit wurden die insgesamt 1,6Millionen Schweizer von kleinen Oberschichten regiert und war Freiheit die Teilhabe weniger an der Herrschaft über viele Unfreie. Geistige Grundlage dieses Gesellschaftssystems bildete, wie im übrigen Europa, die von Menschen geschaffene Idee einer «gottgewollten Ordnung». An oberster Stelle stand die Geistlichkeit. Was die Bischöfe, Priester und Pfarrer von den Kanzeln predigten, das bestimmte weitgehend, was die Menschen dachten und taten. Neben der geistlichen Macht waren die beiden grossen Kirchen aber auch Inhaber erheblichen weltlichen Besitzes.
Beim zweiten Stand der weltlichen Macht gab es in einzelnen Kantonen starke Unterschiede. Während in den Städten Bern, Luzern, Solothurn und Freiburg ein elitärer Kreis von Patrizierfamilien das politische Zepter fest in den Händen hielt,9 regierten in Basel, Schaffhausen und Zürich die Zünfte. Auch in den Landkantonen Appenzell, Glarus, Schwyz, Unterwalden und Uri war das politische Geschehen von wenigen Familien beherrscht. Auf der untersten Stufe der sozialen Leiter standen die Bewohner der Untertanengebiete.10
Da die «gottgewollte Ordnung» den ersten beiden Ständen ein Leben mit erheblichen Privilegien ermöglichte, hatten sie an der Aufrechterhaltung des Systems das grösste Interesse. Als es in den Jahrzehnten vor der Französischen Revolution in fast jedem Kanton zu Aufständen kam, wurden diese allesamt brutal niedergeschlagen und endeten zumeist mit Hinrichtungen.11 In Zürich beispielsweise wurde 1780 der Pfarrer Johann Heinrich Waser öffentlich enthauptet, nur weil er Unterlagen, die Vetternwirtschaft belegten, weitergegeben hatte. Im restlichen Europa wurde die Hinrichtung des 38-jährigen Pfarrers zu Recht als Justizskandal wahrgenommen. Auch wenn es den Obrigkeiten mit Gewalt noch lange gelang, die Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten, so zeigten die Ereignisse klar, dass zahlreiche Schweizer mit den herrschenden Zuständen unzufrieden waren.
Abb.2: Die Struktur der Eidgenossenschaft im 18.Jahrhundert
Im 18.Jahrhundert liess vor allem die Geistesbewegung der Aufklärung die Zustimmung zu dieser «gottgewollten Ordnung» zusehends bröckeln. Einer ihrer wichtigsten Vertreter war der Genfer Philosoph Jean-Jacques Rousseau. In seinem 1762 erschienenen Werk Der Gesellschaftsvertrag schrieb er: «Da[ss] kein Mensch von Natur aus Herrschaft über seinesgleichen ausübt und Stärke keinerlei Recht erzeugt (…).»12
Der Genfer entwarf die grossartige Vision, dass alle Menschen von Natur aus frei seien und daher zwischen ihnen eine natürliche politische und rechtliche Gleichheit bestehe. Einzig und allein dem Gemeinwillen stehe es zu, Gesetze zu erlassen; alle politische Macht müsse mit dem Ziel des Wohles aller vom Volk ausgehen. Da diese revolutionäre These die «gottgewollte Ordnung» und somit die herrschenden Eliten infrage stellte, wurde Rousseaus Werk in Frankreich, den Niederlanden, in Genf und Bern augenblicklich verboten. In Genf erschien es den Machthabern gar so gefährlich, dass es durch den Henker öffentlich verbrannt wurde (!).13 Rousseau musste, um der Verhaftung zu entgehen, über das Waadtland nach Neuenburg fliehen, von wo aus er in seinen Briefen aus den Bergen das Vorgehen der Bücherverbrennung kritisierte.
Als Napoleon im August 1800 in Ermenonville das leere Grab Rousseaus besuchte, dessen Leichnam 1794 triumphal in den Pariser Invalidendom überführt worden war, sagte er zum Eigentümer des Anwesens, Graf Cécile Stanislas Xavier de Girardin: «Es wäre für den Frieden Frankreichs besser gewesen, wenn dieser Mensch nie existiert hätte.» De Girardin erwiderte: «Warum sagen Sie das, Bürger Konsul? Er hat der Französischen Revolution den Weg geebnet.» Als der Graf weiter ausführte, dass diese ihm doch nur zum Vorteil gereicht habe, sagte Napoleon: «Die Geschichte wird entscheiden, ob es für den Frieden der Welt nicht besser gewesen wäre, wenn weder Rousseau noch ich je geboren worden wären.»
Der Nachbar des Vesuv
Als der französische König Ludwig XVI. für das Jahr 1789 die Generalstände einberief, um einen Ausweg aus der katastrophalen Finanzlage zu finden, ahnte er nicht, dass dies eine Jahrtausendzäsur auslösen sollte. Als sich der dritte Stand zur alleinigen Nationalversammlung erklärte und die Feudalrechte und die Leibeigenschaft abschaffte, wurde in einem der mächtigsten Länder Europas die «gottgewollte Ordnung» zur Geschichte. Am 26.August 1789 rief die Nationalversammlung die Menschenrechte aus, womit sich manifestierte, was Rousseau gefordert hatte: die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, mit Ausnahme der Frauen. Wie eine nicht aufzuhaltende Sturzflut brandeten die Ideen der Französischen Revolution über die Grenzen; ein Umstand, der einen österreichischen Diplomaten 1797 gegenüber einem eidgenössischen Gesandten zu der Äusserung veranlasste, die Schweiz sei der «Nachbar des Vesuv».14 In der Eidgenossenschaft verstärkte der Einfluss der Französischen Revolution die ohnehin bereits vorhandenen Spannungen, auch in den Eliten.15
Die bahnbrechenden Ereignisse im Nachbarland wurden in allen Gesellschaftsschichten der Eidgenossenschaft kontrovers diskutiert und fanden lebhafte Resonanz in Salon- und Freimaurergesprächen, in Zeitungen und Pamphleten. Grundlegend war, dass es diesmal Mitglieder in den einzelnen Kantonsregierungen gab, die die Reformen durchaus befürworteten.16
Als liberal gesinnte Bürger in der Waadt und in Genf am 14.Juli 1791 den Jahrestag des Sturms auf die Bastille feierten,17 schickte die Berner Patrizierregierung 2400 Soldaten in die Rhonestadt. In Stäfa forderten 1794 Reformwillige unter Berufung auf urkundlich verbriefte Rechte eine Verfassung, die rechtliche Gleichstellung von Stadt- und Landbewohnern sowie die Aufhebung der Feudallasten. In einem Memorandum verkündeten die Verfasser:
«Von freien Vätern erzeugt, sollen wir freie Söhne sein. Dafür redet die Geschichte, dafür zeugen die Urkunden, (…) als solche respektiert uns jene Nation, die gegenwärtig auf dem politischen Schauplatz die Rolle im Grossen spielt, die (…) unsere Väter im Kleinen spielten.»18
Auch Zürich schickte Soldaten nach Stäfa, liess die Wortführer festnehmen und unter Folter verhören. Nur der Einspruch berühmter Männer wie des Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi verhinderte die Vollstreckung der Todesurteile und bewirkte deren Umwandlung in lebenslange Haftstrafen.19 Als Machtdemonstration wurde die Hinrichtung allerdings durch Heben und Senken des Henkerschwerts über dem Haupt des Textilfabrikanten Johann Jakob Bodmer symbolisch vollzogen.20 Als zusätzliche Strafe liess der Zürcher Rat in Stäfa den Brotverkauf und die Armenunterstützung verbieten.
Unter den Reformwilligen führten die bitteren Erfahrungen, die in der zeitgenössischen Publizistik grossen Niederschlag fanden, zu einer geistigen Radikalisierung und zur Überzeugung, dass Veränderungen mit friedlichen Mitteln nicht zu erreichen waren.21 Paul Usteri, der spätere Leiter der Neuen Zürcher Zeitung, konstatierte, dass es «moralisch unmöglich [sei], dass von unseren bestehenden Regierungen aus vernünftige und nötige Reformationen ausgehen».22
Krieg
Frankreich erklärte Österreich am 20.April 1792 den Krieg. Das Habsburgerreich, das dem revolutionären Land zuvor gedroht hatte, verbündete sich daraufhin mit halb Europa, insbesondere mit Preussen, zur I. Koalition; 1793 wurde vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zusätzlich der Reichskrieg ausgerufen. Nach Ausbruch der Feindseligkeiten besetzten französische Truppen die nördlichen, zu Österreich gehörenden Gebiete des Fürstbistums Basel. Als eine eilig einberufene Tagsatzung in Frauenfeld (14.–30.Mai 1792) feierlich die Neutralität der Schweiz erklärte, wurde diese zunächst von beiden Konfliktparteien respektiert.23 Die Armeen der I. Koalition sammelten sich im Rheinland zum Angriff auf Frankreich. In Koblenz erliess der Herzog von Braunschweig als Oberbefehlshaber der Alliierten am 25.Juli 1792 einen Aufruf an die Pariser Bevölkerung und drohte «eine beispiellose und für alle Zeiten denkwürdige Rache» an, falls der französischen Königsfamilie Gewalt angetan werde.24 Der in einer Pariser Zeitung veröffentlichte Aufruf war Öl in das Feuer eines archaischen Hexenkessels. Den Revolutionären galt die ausländische Einmischung als Beweis, dass Ludwig XVI. mit den feindlichen Mächten gemeinsame Sache machte. Eine unheilvolle Kettenreaktion löste das Massaker an den Schweizer Garden beim Tuileriensturm aus und führte am 22.September 1792 zur Abschaffung des Königtums. Ludwig XVI. und seine Familie wurden im Temple eingekerkert und Frankreich wurde zur Republik erklärt. Ein Revolutionstribunal verurteilte die 246 beim Tuileriensturm gefangenen Schweizer Gardisten zum Tod und die Erste Französische Republik beging ihre Taufe mit dem Blut von Unschuldigen: In einem kollektiven Gewaltausbruch wurden die Gardisten zusammen mit anderen Gefangenen in den Gefängnissen brutal umgebracht. Die willkürliche Ermordung der Landsleute löste in der Schweiz blankes Entsetzen und Fassungslosigkeit aus. «Ich weiss kein Beispiel in der Geschichte», sagte der Zürcher Pfarrer und Philosoph Johann Caspar Lavater bei einer Predigt in der St.Peterskirche im Oktober 1792, «wo mit so satanischer Kaltblütigkeit leidenschaftlicher und regelloser gegräuelt worden sei, als in diesen Tagen in Paris gegräuelt wird.»25 Dessen ungeachtet erklärte eine ausserordentlich einberufene Tagsatzung in Aarau neuerlich die Neutralität. Die vielfach zu findende Angabe, ein Antrag zum Eintritt der Schweiz in den Krieg sei vonseiten Berns gestellt worden, gehört in das Reich der französischen Propaganda.26
In Paris nahmen indessen unerbittlich die Ereignisse ihren Lauf, die die Schweizer Garden nicht hatten verhindern können.
König und Schweizer in einem Grab
Langsam rollte am Morgen des 21.Januar 1793 die Kutsche mit Ludwig XVI. über das Kopfsteinpflaster der von 20000Menschen gesäumten Place de la Révolution. Der König bestieg von Henkersknechten begleitet die Treppen der tiefrot gestrichenen Guillotine.27 An das Volk gewandt sagte er: «Volk! Ich sterbe unschuldig! Ich vergebe denen, die meinen Tod herbeigeführt haben …»28
Trommelwirbel der Nationalgarde setzte ein und übertönte die weiteren Worte. Der todgeweihte Monarch wurde auf dem Rücken gefesselt, auf der horizontal kippbaren Vorrichtung festgezurrt und sein Nacken zwischen den beiden halbkreisförmigen Holzbrettern eingekeilt. Mit ruhiger Hand löste der Henker Charles-Henri Sanson den Hebel der Guillotine, die mit tödlicher Präzision senkrecht herabsauste und in Bruchteilen von Sekunden den Kopf vom Rumpf trennte.29 Als ein Henkersgehilfe das bluttriefende Haupt aus dem Korb zog und es dem Volk entgegenhielt, erscholl über den weiträumigen Platz der zehntausendfache Ruf: «Vive la Nation! (…) Vive la République!»30
Ein Bürger tauchte seine Hand in das Blut des Königs und sprenkelte es wie Weihwasser über die Köpfe der Menge.31 Im Blutrausch patriotischer Gefühle begann ein euphorisches Volksfest mit Gesang und Tanz, wobei die rote Lache unter der Guillotine zum Gegenstand kultähnlicher Handlungen wurde. Männer tauchten ihre Säbel in das Blut oder rieben es sich in die Schnurrbärte. Frauen «wollten Königsblut auf ihren Fingern (…), einige füllten die Scheiden damit (…). Die Kleider des Delinquenten wurden in die ersinnlich kleinsten Fetzen geteilt, die Haare des Catogans32 büschelweise und sehr teuer verkauft».33
Anschliessend wurde der Leichnam des Geköpften zum nahe gelegenen Friedhof Madeleine gebracht und in das 12Fuss tiefe Massengrab seiner massakrierten Schweizer Garde geworfen.
Napoleon und Rousseau
Der junge Artillerieoffizier Napoleon studierte die erschütternden Ereignisse seiner Zeit gründlich. Am Tag der Hinrichtung von König Ludwig XVI. hielt er sich in Korsika auf34 und notierte in seinen später erscheinenden Memoiren, in denen er über sich selbst stets in der 3. Person schrieb: «Eingehend beschäftige er sich mit der Geschichte der französischen Monarchie, um die Ursachen kennenzulernen, die den Sturz des Königtums herbeigeführt hatten. Die damals erschienenen Sammlungen geheimer Memoiren über die Regierung Ludwigs XIV. und Ludwigs XV. (…), wurden von dem Oberleutnant ebenso gründlich studiert und exzerpiert wie die Reise des Engländers Cox durch die Schweiz.»35
Tatsächlich war Napoleon Bonaparte bereits als Schüler an der Militärschule hochbelesen,36 wobei sein besonderes Interesse antiken Tragödien, klassischen Dramen und der Geschichte galt. Schwärmerische Bewunderung hegte der Offiziersanwärter für Alexander den Grossen, Julius Cäsar und Jean-Jacques Rousseau. Diese Verehrung reichte so weit, dass er 1791 eine Dissertation über Rousseau verfasste, die dann unbeachtet im Archiv der Lyoner Akademie verstaubte. Nachdem Napoleon Augenzeuge des Massakers an den Schweizer Gardisten beim Tuileriensturm geworden war und 16500Menschen während der Schreckensherrschaft teilweise willkürlich guillotiniert worden waren, verwandelte sich seine «unbedingte Vergötterung Rousseaus in kritisches Studium». In seinen Memoiren liest dies sich wie folgt: «Im allgemeinen huldigte er auch jetzt noch den Idealen des Genfer Philosophen, doch suchte er die allzu extremen Theorien des Naturapostels auf eine realere, praktisch leichter zu verwirklichende Formel zu bringen.»37
Jahre später, als Napoleon zum mächtigsten Mann Europas aufstiegen war, legte ihm der französische Aussenminister Charles-Maurice de Talleyrand eines Tages überraschend das vergilbte Heft mit seiner Dissertation auf den Tisch. Der Kaiser nahm das Manuskript und warf es, ohne dass der intrigante Minister es hätte verhindern können, in den offenen Kamin mit den Worten: «Ah, das ist nur eine Schülerarbeit.» Der entsetzte Talleyrand versuchte das Werk dem Feuer zu entreissen, «ausser sich, dass er nicht vorher eine Abschrift hatte anfertigen lassen». Später erzählte Napoleon auf St.Helena seinem englischen Arzt Barry O’Meara über den Vorfall: «Ich aber war recht froh, weil die Abhandlung voll republikanischer Ideen war und einen überspannten Drang nach Freiheit verriet, der durch die lebhafte Philosophie noch verstärkt wurde. Die Stimmung der Zeit hatte mich allzu sehr begeistert; was in dem Aufsatz gesagt war, passte aber nicht für die Praxis.»38
Abb.3: Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) von Allan Ramsay, Öl auf Leinwand, 1766. Rousseau übte mit seiner Philosophie grossen Einfluss auf Napoleon aus.
Abb.4: Napoleon in seinem Arbeitszimmer von Paul Delaroche, Öl auf Leinwand, 1838. Napoleon war als junger Offizier ein grosser Bewunderer Rousseaus.
Der Sonderfrieden von Basel
Die französischen Revolutionsarmeen drängten 1794/95 die Alliierten an allen Fronten zurück. Die Neutralität der Schweiz bot hierbei der mit halb Europa Krieg führenden Republik entlang der 300Kilometer langen Juragrenze einen wirkungsvollen Flankenschutz, an der sie keine Truppen aufzubieten brauchte. Die strategische Lage Frankreichs verbesserte sich noch weiter, als der Basler Oberzunftmeister Peter Ochs in seinem barocken Stadtpalais Holsteiner Hof im Frühjahr 1795 eigenmächtig einen Sonderfrieden mit Preussen vermittelte.39 Dieser versprach beiden Parteien erhebliche Vorteile. Preussen erhielt im Osten freie Hand, sich gemeinsam mit Russland den Rest Polens einzuverleiben, das anschliessend für über 120Jahre von der europäischen Landkarte verschwunden sein sollte. Frankreich seinerseits hatte durch den Frieden einen mächtigen Kriegsgegner weniger und konnte sich nun mit all seiner militärischen Kraft auf Österreich werfen. Im Zuge dessen sah eine weiträumige Strategie der französischen Truppen einen Zangenangriff auf Wien beidseits der Alpen im Norden über Süddeutschland und im Süden über Oberitalien vor.40 In Nizza41 betrat im Frühjahr 1796 ein junger Mann die Bühne der Geschichte, der die Welt in atemloses Staunen versetzen sollte – Napoleon.
Napoleon in Italien und der Schweiz
Der mittlerweile zum General beförderte 27-Jährige jagte als Oberbefehlshaber der französischen Italienarmee die Österreicher in einem Blitzkrieg durch Oberitalien. Im oftmals täglich wechselnden Hauptquartier des Feldherrn diente als Schatzmeister Rudolf Emanuel von Haller aus Bern. Der skrupellose Kaufmann war nicht nur zuständig für die Besoldung der Truppen, die Lebensmittel- und Holzbeschaffung, sondern auch für den Verkauf von säkularisiertem Kloster- und Kirchengut, wobei er erklärte, dass er «zu sehr Kaufmann sei, um sich eine bleibende politische Überzeugung zu leisten».42
Napoleon, der aus seinem Italienfeldzug sowohl politisch als auch finanziell das grösstmögliche Kapital zu schlagen gedachte, schickte im Januar 1797 Truppen in den Kirchenstaat, um ihn zu besetzen und auszuplündern. Beim Raubzug am Tiber federführend mit dabei war Schatzmeister Haller, der die Plünderung des Vatikans bis hin in die Privatgemächer des 80-jährigen Pontifex leitete und dem Papst zwei kostbare Ringe persönlich vom Finger riss.43 Im Mai 1797 liess Napoleon Truppen in das neutrale Venedig einmarschieren und die Serenissima ihres Staatsschatzes, ihrer Kriegsschiffe und zahlreicher Kunstreichtümer, einschliesslich der antiken kupfernen Pferde vom Markusdom, berauben. Die anschliessende politische Auslöschung der mehr als 1000Jahre alten Seerepublik galt vielen Eidgenossen als Fanal, machte dies doch deutlich, was Napoleon die Neutralität eines Landes galt.44
Verstärkt wurde dieser Eindruck noch, als der siegreiche General am 18.Juni 1797 in einem kühnen Erkundungsritt von Como an den Luganersee kam und damit zum ersten Mal Schweizer Boden betrat.45 In diesem Gebiet hatten die eidgenössischen Untertanengebiete Veltlin, Chiavenna und Bormio, durch französische Agenten unterstützt, gefordert, ein gleichberechtigtes Mitglied des Freistaats der Drei Bünde zu werden. Deren Rat lehnte dieses Bestreben ab, woraufhin Napoleon die nach Gleichberechtigung strebenden Provinzen kurzerhand dem französischen Satellitenstaat der Cisalpinischen Republik zuschlug.46
Das Schicksal der alten Eidgenossenschaft
Das Laub fiel welk von den alten Bäumen des Parks der Villa Manin47 und schien fast ein Symbol zu sein für das, was der Schweiz bevorstand. Als Napoleon und der österreichische Staatskanzler Johann Amadeus Franz de Paula Freiherr von Thugut in der Sommervilla des letzten Dogen von Venedig am 17.Oktober 1797 den Friedensvertrag von Campo Formio48 unterzeichneten, war damit auch das Schicksal der alten Eidgenossenschaft besiegelt. In einem geheimen Zusatzartikel wurde das Land indirekt der französischen Einflusssphäre zugesprochen, und es war bereits, obwohl noch kein Schweizer etwas davon wusste, von einer «Helvetischen Republik» die Rede.49 Kaiser Franz II., den letzten Herrscher des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, der den Vertrag einige Wochen später ratifizierte, skizzierte ein Biograf wie folgt:
«Er war ein zaudernder Bewahrer, ein Feind alles Neuen und aller Neuerungen, den kaum etwas aus der Fassung brachte und der nichts bewegte (…). In seiner Regierungszeit wurde Österreich zu einem Hort der Reaktion, zum Inbegriff staatlicher und gesellschaftlicher Unbeweglichkeit.»50
Franz’ Wunsch, das Alte zu bewahren, ging im Privaten so weit, dass er für seine umfangreiche Sammlung ausgestopfter Tiere auch einen Schwarzafrikaner nach dessen natürlichem Ableben ausstopfen liess.51 Das politische Hauptaugenmerk des von seinem Gottesgnadentum tief überzeugten Franz fiel auf die Stärkung seiner österreichischen Hausmacht. Der Umstand, dass ihm das Heilige Römische Reich, dessen Kaiser er seit 1792 war, nicht sonderlich viel galt, sollte wesentlich zu dessen Ende im Jahr 1806 beitragen. Ein roter Faden, der sich durch die gesamte Regierungszeit des Habsburgers zog, war dessen Eidbrüchigkeit. Hierzu zählte u.a., dass er im Frieden von Campo Formio im Nachhinein der Abtretung des Veltlin an die Cisalpinische Republik zustimmte, obwohl er als Freiherr von Rhäzuns und Glied des Grauen Bunds diesem zur Loyalität verpflichtet gewesen wäre.52 Als territoriale Gegenleistung wurde Graubünden dem Einflussbereich der Habsburger zugesprochen und das länderhungrige Österreich erhielt aus Napoleons Händen als neue Provinz das überfallene Venedig einschliesslich des Grossteils von Venetien.53
Abb.5: Vertrag von Campo Formio [sic] zwischen der Französischen Republik, vertreten durch Napoleon Bonaparte, und Österreich, vertreten durch Martius Mastrilli, Ludwig von Cobenzl, Maximilian von Merveldt und Ignaz von Degelmann, 17.Oktober 1797. Die Abbildung zeigt die letzte Seite des Vertrags mit den Unterschriften und Siegeln der Unterzeichner. Der Friedensvertrag von Campo Formio veränderte die aussenpolitische Situation der Schweiz grundlegend. Die Eidgenossenschaft hatte Frankreich durch ihre Neutralität im Verlauf des I. Koalitionskriegs an dessen 300Kilometer langen Ostgrenze einen wirkungsvollen Flankenschutz geboten. Nach Campo Formio war dieser strategische Vorteil nicht mehr notwendig, was für die Schweiz verhängnisvolle Folgen hatte.
Der Friedensvertrag von Campo Formio hatte zwar die seit 1792 andauernde Auseinandersetzung zwischen Österreich und Frankreich beendet, nicht aber den 1793 ausgerufenen Reichskrieg mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Über diesen Frieden sollte ein eigener Kongress befinden. Als Tagungsort schlug Kaiser Franz II. das neutrale Bern vor,54 was von Napoleon entschieden abgelehnt wurde. Sucht man nach den Gründen dieser Ablehnung, so kommt der Schweizer Historiker Theo Tschuy der Wahrheit vermutlich recht nahe, wenn er schreibt: «Er [Napoleon] wusste, dass es nicht anging, in den Mauern einer Stadt über Frieden zu verhandeln, den Gastgebern für ihre freundliche Aufmerksamkeit zu danken, um sie kurz darauf zu überfallen. Auch in Frankreich hätten sich die Menschen über eine solche Ruchlosigkeit empört.»55
Als Austragungsort des Kongresses wurde daher das badische Rastatt bestimmt, wohin Napoleon als Generalbevollmächtigter am 17.November 1797 aufbrach.56 Die rasante Kutschfahrt von Mailand durch die Schweiz verlief in der ihm eigenen atemberaubenden Geschwindigkeit. Die Art und Weise, wie Napoleon reiste, beschrieb der Schriftsteller Emil Ludwig wie folgt: «Er ist der erste, der die Reibung in der Bewegung überwindet, und reist er auch nicht so rasch wie wir, so reist er doch rascher als je ein Mensch vor ihm (…). Auf dem Bock sitzt der Mamelucke [den es 1797 noch nicht gab], zwei Reiter vor ihm lenken die sechs [acht] Pferde. Stets ist der Wagen von einer Legion von Stallmeistern, Pagen, Jägern umgeben, und wenn sich der Zug fortwälzt, der Weg wird eng, alles wirbelt durcheinander in Hitze und Staub, in Nacht und Nebel, so stehen die Bauern staunend am Wege (…).»57
In Genf wurde Napoleon mit Kanonendonner, roten Teppichen und Glockengeläut empfangen.58 Der hagere General sagte bei einem offiziellen Festakt der Stadt seinen Schutz zu – was bedeutete, dass sie einige Monate später annektiert würde. In Lausanne betonte Napoleon, dass «kein Volk dem anderen Untertan sein dürfe», was mit Jubel von den Bewohnern quittiert wurde – die von den Eroberungsplänen nichts ahnten.59 Während eines Radbruchs seiner Kutsche beim Beinhaus von Murten westlich von Bern wurde Napoleon einige Zeit aufgehalten.60 Es war dasselbe Beinhaus, über das der spätere Napoleon-Verehrer Goethe 1826 folgendes Gedicht schrieb:
Bei Betrachtung von Schillers Schädel
«Im ernsten Beinhaus war’s, wo ich beschaute
Wie Schädel Schädeln angeordnet passten
Die alte Zeit gedacht’ ich, die ergraute.
Sie stehn in Reih’ geklemmt’ die sonst sich hassten,
Und derbe Knochen, die sich tödlich schlugen
Sie liegen kreuzweis, zahm allhier zu rasten.
Entrenkte Schulterblätter! was sie trugen,
Fragt niemand mehr, und zierlich tät’ge Glieder,
Die Hand, der Fuss, zerstreut aus Lebensfugen.
Ihr Müden also lagt vergebens nieder,
Nicht Ruh im Grabe liess man euch, vertrieben
Seid ihr herauf zum lichten Tage wieder,
Und niemand kann die dürre Schale lieben,
Welch herrlich edlen Kern sie auch bewahrte.
Doch mir Adepten war die Schrift geschrieben,
Die heil’gen Sinn nicht jedem offenbarte,
Als ich inmitten solcher starren Menge
Unschätzbar herrlich ein Gebild gewahrte,
Dass in des Raumes Moderkält und Enge
Ich frei und wärmefühlend mich erquickte,
Als ob ein Lebensquell dem Tod entspränge.
Wie mich geheimnisvoll die Form entzückte!
Die gottgedachte Spur, die sich erhalten!
Ein Blick, der mich an jenes Meer entrückte,
Das flutend strömt gesteigerte Gestalten.
Geheim Gefäss! Orakelsprüche spendend,
Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten?
Dich höchsten Schatz aus Moder fromm entwendend
Und in die freie Luft, zu freiem Sinnen,
Zum Sonnenlicht andächtig hin mich wendend.
Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen,
Als dass sich Gott-Natur ihm offenbare?
Wie sie das Feste lässt zu Geist verrinnen,
Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre.»61
Einige Wochen später sollte das von edlem Geist bedichtete Beinhaus von französischen Truppen niedergebrannt werden.
Als der ehrgeizige Feldherr an jenem trüben Novembertag vor dem verwitterten Gebäude stand, sagte er zu seinen Begleitern, dass «man die ganze Gegend mit 2000 Mann besetzen könne».62 Die Aussage darf als Beleg gelten, dass Napoleon die Reise durch die Schweiz auch zur militärischen Erkundigung des längst beschlossenen Angriffskriegs nutzte.63 In den Abendstunden bestieg er erneut die Kutsche, die durch die Dunkelheit in Richtung Aare rollte.
Kapitel II
Der Goldraub von Bern
«Lassen Sie mich wissen, wann das Geld aus Bern eintrifft und in welcher Währung.»64
Napoleon
Napoleon in Bern
Dunkler Kanonendonner verkündete am 23.November 1797 die Ankunft Napoleons in Bern. Als die achtspännige Kutsche in die Zähringerstadt einfuhr, drängten sich die Bürger dicht an dicht auf den Strassen, um einen Blick auf ihren berühmten Besucher zu erhaschen. Während der Empfang des Feldherrn in fast der gesamten übrigen Eidgenossenschaft dem Triumphzug eines römischen Imperators glich, war der Empfang in Bern ausgesprochen kühl, was manche für ein schlimmes Vorzeichen hielten. Die Einwohner waren zwar überaus neugierig, Napoleon zu sehen, allerdings ohne jede Begeisterung, wie der Augenzeuge Franz von Graffenried berichtete: «Die Volksmenge war ungeheuer und vermehrte sich von Minute zu Minute. Mein Platz war so gut gewählt, dass ich alles, was vorging, ganz in der Nähe sehen und hören konnte. Ich kann versichern, nicht ein einziges ‹vive Bonaparte!› gehört zu haben, und man kann mir um so mehr Glauben schenken, als ich ein enthusiastischer Bewunderer Bonapartes war.»65 Eine andere Darstellung des Empfangs in Bern gibt Napoleons Sekretär Bourrienne wieder: «Bei unserer Ankunft in Bern, des Nachts, passierten wir eine doppelte Reihe sehr gut erleuchteter Equipagen, die mit hübschen Frauen angefüllt waren. Alles rief: Es lebe Bonaparte! Es lebe der Friedensstifter! Man muss selbst von dieser ungezwungenen Begeisterung Augenzeuge gewesen sein, um eine wahre Vorstellung davon zu erlangen.»66
Von Graffenried kommentierte dies wie folgt: «Was die grosse Menge brillanter, mit eleganten Damen besetzten Equipagen anbetrifft, von denen Bourrienne in seinen Memoiren faselt, so ist dieses ein schönes Traumbild, welches niemand gesehen hat, und zwar einmal, weil Bern damals nur wenige Equipagen hatte; dann, weil Bonaparte Bern überraschte: – man hatte keine Zeit, einspannen zu lassen und Toilette zu machen. Endlich, weil eine solche Demonstration weder in den Sitten noch im Geiste der Berner Damen liegt. Kurz, das Ganze ist ein Märchen.»67
Im ersten Gasthof Berns, dem «Goldenen Falken», war ein üppiges Festessen mit den Ratsherren und die Übernachtung vorbereitet worden. Vor dem traditionsreichen Gebäude angekommen, in dem bereits so berühmte Gäste wie Goethe und Casanova genächtigt hatten, stieg der Feldherr allerdings nicht aus der Kutsche und liess sich lediglich ein Glas Wasser reichen. Anschliessend setzte er die Reise unvermittelt fort.68
Auffällig ist die zeitliche Nähe von weniger als zehn Wochen zwischen dem Besuch Napoleons und dem 28.Januar 1798. An besagtem Sonntag marschierten zwei französische Armeen im Jura und in der Waadt ein, um in einem Zangenangriff auf Bern vorzustossen.
Der französische Angriff
Obwohl Napoleon in seinen späteren Memoiren auf St.Helena die Alleinverantwortung für den Angriff auf die Schweiz auf das Direktorium der Französischen Revolution abzuschieben suchte,69 sprach er sich nach seiner Rückkehr aus Rastatt in Paris nachdrücklich für deren baldige Besetzung aus.70 Das kleine Alpenland sollte nach dem Vorbild der Niederlande (Batavische Republik) und Italiens (Cisalpinische und Römische Republik u.a.) in eine französische Tochterrepublik umgewandelt werden. Wie bei Napoleon üblich, verlief die Mechanik der Aggression mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks – Napoleon trug eine Schweizer Uhr von Bregue. Um die Zertrümmerung der alten Eidgenossenschaft vorzubereiten, erhielt der Berner Oberzunftmeister Peter Ochs bei einem persönlichen Gespräch mit General Napoleon und Aussenminister Talleyrand in Paris den Auftrag, eine neue Verfassung auszuarbeiten.71 Ohne Autorisierung der französischen Direktorialregierung erteilte der zielstrebige General am 10.Dezember 1797 den Befehl, eine ganze Division an die Grenze des Waadtlands zu verlegen. Fünf Tage später besetzten französische Truppen die südlichen Landschaften des unter Berner Protektion stehenden vormaligen Bistums Basel, einschliesslich der zugewandten Stadt Biel. Angesichts der Verletzung seiner Souveränität liess Bern am 26.Dezember eine ausserordentliche Tagsatzung der alten 13Orte in Aarau einberufen. Von französischer Seite wurde nach Kräften alles Erdenkliche getan, dass hierbei unter den Eidgenossen keine Einigkeit zustande kam.72 Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde in das 1886 eingeweihte Grauholzdenkmal bei Bern die Inschrift «Seid einig» aus Schillers Wilhelm Tell eingemeisselt.
Am 28.Dezember liess die französische Regierung Bern und Freiburg ein Dekret zustellen, in dem alle Aufstandsversuche in deren Staatsgebiet unter französischen Schutz gestellt wurden – was einer Kriegserklärung gleichkam.73 Der Akt, der eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Eidgenossenschaft darstellte, bildete ein machiavellistisches Glied in der Vorbereitung des längst beschlossenen Angriffs. Unter kaum verkennbarem, französischem Einfluss revolutionierte sich am 20.Januar 1798 gewaltfrei Basel, als erster eidgenössischer Stand.74 Vier Tage später wurde in der zu Bern gehörenden Waadt die «Lemanische Republik» ausgerufen. Die Berner Vögte wurden ohne Gewaltanwendung abgesetzt, die Berner Truppen zogen sich vor der französischen Übermacht kampflos zurück. Gleichzeitig mit dem Einmarsch erschienen in den ländlichen Untertanengebieten Flugblätter folgenden Inhalts:
«Eure Brüder haben das Joch eines hassenswerten Despotismus abgeworfen. Erwachet endlich und ahmt ihr Beispiel nach! Dann werdet ihr nicht mehr im Schweisse eures Angesichts für eine kleine Zahl übermütiger Familien arbeiten, sondern unter einer weisen Verfassung, die euer eigenes Werk sein wird, endlich die glücklichen Früchte der Freiheit und Gleichheit einbringen, die man in eurem Land kaum dem Namen nach kennt.»75
Die alte Eidgenossenschaft wurde mit aller Urgewalt in den Grundfesten aus den Angeln gehoben, wie ein Jahrhundert später das russische Zarenreich durch Lenin. Innerhalb weniger Tage vollzog sich, was der spätere Napoleon-Verehrer Goethe wenige Jahre danach in einer Strophe des Gedichts Ihro der Kaiserin von Frankreich Majestät zu Papier brachte:
«Worüber Jahrhunderte trüb gesonnen,
Er übersieht’s in hellstem Geisteslicht,
Das Kleinliche ist alles weggeronnen,
Nur Meer und Erde haben ihr Gewicht;
Ist jenem erst das Ufer abgewonnen,
Dass sich daran die stolze Woge bricht,
So tritt durch weisen Schluss und Machtgefechte,
Das feste Land in seine Rechte.»76
Die noch immer in Aarau tagende Tagsatzung erneuerte zwar am 25.Januar 1798 den Bundesschwur, der sich aber als Lippenbekenntnis herausstellen sollte.77 Die Landbevölkerung der Städte Zürich, Bern, Luzern, Freiburg, Solothurn und Schaffhausen errang innerhalb weniger Tage die Anerkennung ihrer Gleichberechtigung und die Zusicherung einer auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gegründeten Verfassung. Die von wenigen elitären Patrizierfamilien beherrschten Regierungen hatten in der trügerischen Hoffnung, einen Krieg gegen die Franzosen oder gar einen Bürgerkrieg verhindern zu können, nachgegeben. Was umso erstaunlicher ist, da noch kurz zuvor all diejenigen, die bürgerliche Freiheiten gefordert hatten, enthauptet, aufgehängt oder eingesperrt worden waren.78 Obwohl die grossen Ideale der Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit damit erfolgreich in das Nachbarland exportiert worden waren, wurde der französische Vormarsch auf Bern nur scheinbar eingestellt. Vielmehr nutzte General Guillaume Brune den bis auf den 1.März geschlossenen Waffenstillstand, um seine Truppen Schritt für Schritt kampflos vorzuschieben. Ein Brief von Brune an die französische Direktorialregierung lässt am Täuschungscharakter der Vereinbarung keinen Zweifel: «Ich ergreife den Ausweg, mit ihnen [den Schweizern] vage Verhandlungen zu führen, bis General Schauenburg [der von Norden vorstiess] die Position von Biel besetzt hat.»79
Wenn es aber nicht die vorgeblich ideellen Gründe der Französischen Revolution waren, stellt sich die Frage, worin Frankreichs eigentliches Motiv des Angriffskriegs bestand – und warum das primäre militärische Ziel ausgerechnet Bern war.
Der vielfach genannte Grund, dass es um den Besitz der strategisch wichtigen Alpenpässe ging,80 kann allenfalls als zweitrangig angesehen werden, denn als Napoleon 1796 im Siegeszug Oberitalien eroberte, hatte er dies auch ohne die Schweizer Alpenpässe getan. Auch das dritte, in der Literatur vielfach zu findende Motiv, dass es darum ging, aus der Schweiz Soldaten herauszupressen, war ein untergeordnetes Ziel. Frankreich hatte durch die Levée en masse, die während des I. Koalitionskriegs verfügte Massenaushebung, mehrere 100000Mann unter Waffen, so dass es auf die paar Tausend Soldaten nicht zwingend angewiesen war. Napoleon selbst rechtfertigte den Angriff in seinen späteren Memoiren irreführenderweise wie folgt:
«Frankreich hatte sich über den Kanton Bern und die Schweizer Aristokratie beständig zu beklagen; alle ausländischen Agenten, durch die Frankreich beunruhigt wurde, hatten stets in Bern ihren Stützpunkt gehabt. Es galt nunmehr, den grossen Einfluss, den die Republik sich in Europa gesichert hatte, zunutze zu machen und das Übergewicht dieser Aristokratie zu zerstören. Napoleon begriff vollkommen den Ärger des Direktoriums; er war wie dieses der Meinung, dass der Augenblick gekommen war, um den politischen Einfluss Frankreichs in der Schweiz sicherzustellen; aber er hielt es nicht nötig, zu diesem Zweck das ganze Schweizerland auf den Kopf zu stellen.»81
Im Angesicht der zu diesem Zeitpunkt herrschenden, vollkommen desaströsen finanziellen Lage Frankreichs und der als Folge von Korruption, Misswirtschaft und des I. Koalitionskriegs herrschenden Hyperinflation lag das tatsächliche Ziel klar auf der Hand: Es ging um die Ausplünderung des reichen Nachbarlands – und hier vor allem des sagenhaften Berner Staatsschatzes.82 Ganz klar wird das im Postkriptum eines Briefs Napoleons an das Direktorium, in dem es nur noch heisst: «Geld! Geld! Geld!»83
Bevor die Invasoren aber dazu übergehen konnten, das Fleisch des Bären zu filetieren, musste er zunächst noch erlegt werden.
Abb.6: Helvetische Revolution 1798
Die Schlacht von Neuenegg
Am Morgen des 5.März 1798 wurden die Bewohner Berns um 6Uhr früh durch das Sturmläuten der Kirchenglocken aus dem Schlaf gerissen. Kanonendonner drang vom nördlichen Horizont an die Aare zu den Fenstern der Häuser und liess keinen Zweifel daran, dass sich der Feind der Stadt näherte. Wenige Minuten später polterten Löschfässer über die Pflastersteine zu den Brunnen,84 Feuerspritzen wurden bereit gemacht und am Stadtgraben wurden grosse Bottiche mit Wasser gefüllt. Die feindliche Artillerie, so die durchaus naheliegende Befürchtung, würde schon bald die Häuser erreichen und die Stadt in Brand schiessen.
In der Morgendämmerung trat im Angesicht der hochdramatischen Situation die provisorische Regierung zusammen. Einen Tag zuvor hatte der ehrgeizige Seckelmeister Karl Albrecht von Frischling den Altbürgermeister Niklaus Friedrich von Steiger offiziell absetzen und sich selbst zum Präsidenten einer provisorischen Regierung wählen lassen.85 Während der greise Steiger eine entschlossene Verteidigung befürwortet hatte, war Frischling Anführer einer «Friedenspartei», die sich für ein Nachgeben einsetzte.86 Tatsächlich war die jahrelange Feindschaft zwischen diesen beiden Männern, bei der es vor allem von Frischling um die Mehrung seiner persönlichen Macht ging, einer der Gründe für den Untergang des alten Bern. So hatte der Seckelmeister einzig und allein, weil der Vorschlag von Steiger kam, im Rat auch noch so geringfügige Verteidigungsvorbereitungen abgelehnt. Und dies, obwohl das Wichtigste für einen Krieg, nämlich Geld, reichlich vorhanden war und zudem im Zeughaus über 500Kanonen, 22649Gewehre und Munition bereit waren. Kurz darauf sollte dieses umfangreiche Waffenarsenal nahezu vollständig den Franzosen in die Hände fallen.87
Nachdem von Steiger abgewählt worden war, stand er schweigend auf und verliess den Ratssaal. Als Zeichen der Ehrerbietung erhob sich der gesamte Rat, dem von Steiger beim Hinausgehen einen verächtlichen Blick zuwarf. Anschliessend begab sich der Altschultheiss in seiner Kutsche zu der am Grauholz im Felde stehenden Armee, wo er seinen eigenen Worten zufolge hoffte «beim Heer ein ehrenhaftes Ende zu finden und das unglückliche Vaterland nicht zu überleben».88
Auf den Strassen Berns machte sich indessen Anarchie breit und ein betrunkener, patriotisch aufgeladener Mob mit Sensen und Holzprügeln drohte jedem, der von Kapitulation sprach, mit Mord und Totschlag. Aus Angst um ihr Leben entschlossen sich die «Gnädigen Herren» der kapitulationswilligen, provisorischen Regierung daher nun doch zu militärischen Abwehrmassnahmen.
Gegen 8





























