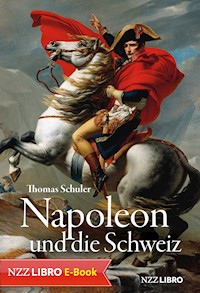7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Franz Josef Strauß hatte Chuzpe und Charisma, Ehrgeiz und Einfluss im Übermaß. Er war einer der schillerndsten und umstrittensten deutschen Politiker der Nachkriegszeit. Seine Kinder lernten ihn als absoluten Monarchen kennen und versuchten, ihm auf ihre Weise nachzueifern. Thomas Schuler beleuchtet die politischen Affären, die persönlichen Hintergründe und die privaten Höhen und Tiefen des Ausnahmepolitikers und seiner Familie. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Thomas Schuler
Strauß
Die Biographie einer Familie
Impressum
Covergestaltung: buxdesign, München
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei Fischer Digital
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-560956-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Die letzten Stunden
1 Die Kindheit und die Angst vor »den Roten«
2 Heranwachsen in der Straße der Bewegung
3 Studium und Krieg
4 Die ersten Schritte auf dem Weg nach oben
5 An die Macht in Bayern und Bonn
6 Die ersten Monate als Verteidigungsminister
7 Marianne Zwicknagl wird Marianne Strauß
8 Dr. Max Zwicknagl
9 Verlobung und Hochzeit: Sonne in Rom und Regen in Rott
10 Ein Sittenroman und eine Gefahr »für die westdeutsche Jugend«
11 Minister Strauß sieht Gelb
12 Ein guter Freund und die Fibag-Affäre bringen Strauß in Bedrängnis
13 Die Spiegel-Affäre: Strauß stürzt
14 Das Rätsel um die Bau-Union
15 Nach dem Sturz – FJS will endlich Recht bekommen
16 Noch einmal studieren
17 Die Kinder kommen in die Politik
18 Mariannes Unfall und Tod – 22. Juni 1984
19 Die Kinder nehmen Abschied vom Vater und kommen doch nicht von ihm los
20 Max Strauß
21 Monika Hohlmeier
Epilog
Anmerkungen
Dank
Nachtrag zur Taschenbuchausgabe
Zeittafel
Quellen
Bibliographie
Register
Die letzten Stunden
Samstag, 1. Oktober 1988: Der dienstliche Teil des Tages beginnt mit einem Interview für die Bild am Sonntag. Dann erscheint Verteidigungsminister Rupert Scholz im Privathaus von Franz Josef Strauß. Sie reden und gehen anschließend um 12.30 Uhr aufs Oktoberfest. »Er machte auf mich einen ausgeglichenen, vitalen Eindruck«, sagt Scholz später. Im Zelt des Gastronomen Käfer, wo sich die Prominenten treffen, essen sie Kalbshaxe mit Semmelknödeln und Rotkohl, dazu trinken sie eine Schorle mit toskanischem Weißwein. Zweieinhalb Stunden später steigt Strauß in einen Polizeihubschrauber, der ihn zum »Aschenbrenner-Marter« im »Thiergarten« des Fürsten von Thurn und Taxis bringt. Es ist Brunftzeit, Strauß will auf die Hirschjagd gehen.
Bevor er in den Hubschrauber steigt, telefoniert er zwanzig Minuten lang mit seiner 26-jährigen Tochter Monika, die mit ihrem zweiten Kind schwanger ist. Strauß erkundigt sich nach seiner Enkelin und nach Monikas eigenem Befinden. Er erzählt ihr von seinem Gespräch mit Scholz und spricht mit ihr über die vielen Termine der vorangegangenen Woche. An diesem Wochenende, sagt er, wolle er sich erholen. Die Jagd beim Fürsten von Thurn und Taxis in dessen Wäldern rund zwölf Kilometer östlich von Regensburg soll Teil des Ausspannens sein. »Ich komm wahrscheinlich noch heut’ Nacht zurück«, sagt er seiner Freundin Renate Piller. »Wünsch mir Weidmannsheil!« Zwar hat er ihr kurz zuvor ein Jagdkostüm geschenkt, aber sie macht sich nichts aus der Jagd und will lieber mit einer Freundin auf eine Modemesse gehen.
Der Flug ist ruhig. Es herrscht nasskaltes Wetter bei zwölf Grad. Das »Aschenbrenner-Marter« liegt auf einer Bergkuppe, umgeben von vielen kleinen Jagdhäusern. Schon seit Tagen haben die Förster Sechzehnender gesehen und röhren hören. Vor dem Jagdhaus wartet bereits der Fürst mit seiner Familie – außerdem zwanzig livrierte Jäger und Diener. Strauß schickt seine Leibwächter ins Wochenende. »Der Hubschrauber landete um 15.50 Uhr«, erinnert sich Oberförster Bernd Riedl. »Strauß stieg aus, winkte den Piloten noch einmal zu und ging auf den vor dem Portal wartenden Fürsten zu.« Dann geht er zum Jagdauto und nimmt Platz. Haushofmeister Wilhelm Lechner reicht ihm das Jagdgewehr. »Bitte, Herr Ministerpräsident.« Da fasst Strauß sich ans Herz. »Halt«, sagt Strauß zum Fahrer. »Der Flug war ein bisschen anstrengend. Warten Sie noch.« Dann bricht er zusammen. Er ist leichenblass. »Sofort liefen drei Diener los, versuchten, den Bewusstlosen mit Mund-zu-Mund-Beatmung ins Leben zurückzuholen«, erinnert sich Oberförster Riedl. »Andere alarmierten über Funk das Krankenhaus und holten Decken herbei.« Fürst Johannes sagt später: »Zu diesem Zeitpunkt war ein Puls nicht feststellbar.«
Die Helfer und die Polizei piepen Dr. Rainer Tichy an, den Chefarzt für Anästhesie am Evangelischen Krankenhaus in Regensburg und leitenden Notarzt des Malteser Hilfsdienstes. Unterdessen versuchen drei Anwesende Strauß zu reanimieren. Sie pressen den großen Brustkorb, um das Herz wiederzubeleben. Ein Helfer bläst Luft in die Lungen. Weder Atemspende noch Brustmassage zeigen Erfolg. Die Helfer brechen Strauß vier Rippen – bei einem 73 Jahre alten Mann keinesfalls ein Fehler, sondern ein Zeichen für die richtige Dosierung der Kompression.
Gegen 16.30 Uhr landet Dr. Tichy im Hubschrauber etwa fünfzig Meter von dem Ort entfernt, wo Strauß bewusstlos am Boden liegt. Er eilt zu ihm und leitet sofort eine medizinische Grundversorgung ein, um Atmung und Kreislauf zu stabilisieren. Strauß muss mit seinen Kreislaufbeschwerden schnell in ein Krankenhaus, entscheidet Dr. Tichy: »Wenn der Ministerpräsident länger bewusstlos dort gelegen hätte, hätte die Gefahr bestanden, dass er ersticken konnte und weitreichende vitale Störungen aufgetreten wären.« Zehn Minuten nach Tichy trifft der Rettungshubschrauber »Christopherus 15« mit einem weiteren Arzt und einem Sanitäter am Unfallort ein. Die Ärzte geben Strauß kreislaufstärkende Mittel und beatmen ihn künstlich. Fünfzehn Minuten später heben sie und die Sanitäter ihn auf einer Trage in den Hubschrauber und fliegen ihn zum zwölf Kilometer entfernten Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg. Gegen 17.00 Uhr trifft er dort ein.
Nun ist Dr. Rolf Manz, Chefarzt der Intensivstation, zuständig. Er muss sich fragen, warum Strauß bewusstlos ist, und hat ein Dutzend Möglichkeiten zur Wahl. Jede erfordert eine andere Behandlung. Schon bald nach der Einlieferung gelangt die Nachricht davon an die Öffentlichkeit. Um 18.20 Uhr informiert ein Hörer Radio Charivari in Regensburg. Der Sender unterbricht sein Programm. Rasch ranken sich wilde Gerüchte um den Zusammenbruch. Strauß sei auf der Jagd angeschossen worden, lautet eine Falschmeldung. Eine andere besagt, er habe einen Schuss auf einen Hirsch abgegeben und sei dabei über eine Wurzel gestolpert.
Am Samstagabend eröffnet Wirtschaftsminister Gerold Tandler die Münchner Modewoche. Nach seiner Rede fährt er sofort nach Regensburg. Innenstaatssekretär Peter Gauweiler lässt das Krankenhaus gegen 19.00 Uhr mit Hilfe von hundert Polizisten von der Öffentlichkeit abschirmen. Politiker und Beamte schweigen gegenüber den Journalisten, die immer zahlreicher vor dem Tor der Klinik eintreffen. Aus Wackersdorf, Nürnberg und Regensburg rückt immer mehr Polizei an. Die Beamten drohen den wartenden Journalisten, sie notfalls mit Gewalt zu entfernen.
Renate Piller wartet auf ihre Freundin, um gemeinsam die Gala der Modewoche zu besuchen, als das Telefon klingelt. »Ich habe schlechte Nachrichten für Sie«, sagt Gauweiler, »der Ministerpräsident hat einen Unfall gehabt.« Es sei eigentlich »alles unter Kontrolle, nur ein leichter Herzanfall wahrscheinlich«, dennoch rät er ihr vom Besuch der Gala ab. »Stellen Sie sich bloß vor, wie das aussieht, wenn man Sie mit dem Sektglas in der Hand fotografiert, während der Chef …« Ist es doch ernster? Renate Piller ruft im Krankenhaus an. Nicht-Familienangehörige erhalten keine Auskunft.
Bald trifft auch Monika Hohlmeier im Krankenhaus ein. Vergebens suchen Mitarbeiter von Strauß seine Söhne Max und Franz Georg, die sich beide im Urlaub befinden. Die Mitarbeiter leiten außerdem die nötigen Schritte ein, um Strauß nach München verlegen zu lassen. Sie informieren zwölf Krankenhäuser um München herum, die über einen Hubschrauberlandeplatz verfügen, dass Strauß noch in dieser Nacht aufgenommen werden muss.
Um 21.00 Uhr steht ein Hubschrauber startklar neben der Klinik. Die Feuerwehr stellt Scheinwerfer auf, um ihm den Weg zu weisen. Doch die Ärzte sind unsicher, ob der bewusstlose Patient den Flug verkraften würde, und sagen die Verlegung ab. Sein Zustand ist ernst. Um 21.30 Uhr kommt Pater Camillus Halbleib und spendet ihm die Letzte Ölung, die verharmlosend »Sakrament der Krankensalbung« heißt. Gegen 21.45 Uhr wird Monika Hohlmeier in einem Polizeiwagen aus der Klinik gefahren.
Die kritische Phase beginnt um 22.00 Uhr: Zwar wurden durch den Kollaps weder Gehirn noch Hauptschlagader geschädigt, aber Strauß ist weiterhin bewusstlos. Er hat einen so genannten »akuten« oder »unsicheren« Bauch, wie die Mediziner sagen. Das heißt, sein Bauch ist riesengroß geworden. Droht ein Magen- oder Darmdurchbruch? Der Chefarzt der Inneren Abteilung, Professor Paul Döring, entscheidet sich zu einer nächtlichen Notoperation. Er öffnet den Bauch, und es entweicht viel Luft. Er sucht nach Blutungen in der Bauchhöhle, forscht fast zwei Stunden nach Anzeichen eines möglichen Durchbruchs, nach Erkrankungen von Galle und Bauchspeicheldrüse, aber vergeblich. Er kann nichts Krankhaftes finden. Nach der Operation stabilisiert sich der Kreislauf von Strauß zunächst.
Vor dem Krankenhaus treffen immer mehr Journalisten ein, die jeden nach dem Zustand von Strauß fragen. Kurz nach 23.00 Uhr treten Wirtschaftsminister Gerold Tandler, Bayernkurier-Chefredakteur Wilfried Scharnagl und Polizeipräsident Fenzl zu ihnen ans Eingangstor. Tandler sagt: »Nach Auffassung der Ärzte hat der Ministerpräsident einen Kreislaufkollaps ohne ernsthafte Folgen erlitten.« Man gehe davon aus, dass bei der »bekannt guten Gesundheit des Ministerpräsidenten bald wieder gute Nachrichten ins Land ziehen«. Im Übrigen sei es »reiner Quatsch«, dass Strauß bewusstlos aufgefunden worden sei. Die Journalisten sind skeptisch.
Monika Hohlmeier kommt zurück in die Klinik, und damit beginnen neue Spekulationen. Angeblich bezieht sie nun ein Zimmer neben dem Zimmer ihres Vaters auf der Intensivstation im zweiten Stock. In einem weiteren Zimmer richtet Innenstaatssekretär Peter Gauweiler ein Lagezentrum ein. Die Staatskanzlei in München fahndet unterdessen weiter nach den beiden Söhnen von Franz Josef Strauß. Max macht Ferien in Südtirol. Vergeblich wird über den Rundfunk nach ihm gefahndet. Franz Georg ist mit einem Wohnmobil in Nordamerika unterwegs, da ist es zwecklos, ihn per Radio zu suchen. Gegen 0.30 Uhr fährt eine Wagenkolonne mit Hohlmeier, Tandler und Gauweiler in ein Regensburger Hotel. Zwei Ärzte, die schon auf dem Heimweg waren, werden zurückgerufen.
Sonntag, 2. Oktober 1988: In den frühen Morgenstunden verschlechtert sich der Zustand von Strauß rapide. Seine Lunge arbeitet kaum noch, auch seine Nieren funktionieren nur noch eingeschränkt.
Am Sonntagvormittag werden die Journalisten ein ums andere Mal auf einen neuen Termin für eine ärztliche Stellungnahme vertröstet. Erst um 11.00 Uhr beendet ein Bulletin der Ärzte das Gerüchtewirrwarr. Es endet mit dem Satz: »Im Laufe der weiteren Behandlung entwickelte sich ein Lungenbefund, wie er nach Wiederbelebungsmaßnahmen beobachtet wird.« Daraus schließen Fachleute, dass Strauß bereits klinisch tot war und wiederbelebt wurde. Um 14.00 Uhr geben die Ärzte das zweite Bulletin heraus. »Der Zustand des Ministerpräsidenten hat sich in der Zwischenzeit verschlechtert.« Eigentlich bräuchte Strauß die Betreuung einer Uniklinik. Der Hubschrauber für den Transport steht bereit, doch Strauß kann nicht transportiert werden. Den Ärzten ist das Risiko zu groß. Als der Chefarzt von »Lebensgefahr« spricht, gibt ein Regierungssprecher zögernd zu, die Öffentlichkeit sei wohl zu lange zu optimistisch informiert worden.
Am Sonntagmorgen wird Strauß’ Schwester Maria nach Regensburg geholt. Den wenigen Besuchern wird klar, dass Strauß nur noch von Hightech-Medizin am Leben gehalten wird.
Am Sonntagnachmittag beginnen die Spekulationen über die Nachfolge von Strauß. Sie konzentrieren sich zunächst auf Wirtschaftsminister Gerold Tandler für das Amt des Ministerpräsidenten. Theo Waigel gilt als potenzieller Nachfolger als Parteichef.
Im Laufe des Tages schickt Gauweiler seinen Fahrer nach München und lässt Renate Piller holen. Diskret schleust er sie ans Krankenbett. Bedenken im Krisenstab begegnet er mit den Worten: »Ich sag’ nur eins: Wen glaubt ihr, dass der Chef sehen will, wenn er aufwacht?« Der Anblick bestätigt ihr den Ernst der Lage: »Franz Josef Strauß lag an tausend Schläuchen, ich hielt ihm eine Weile die Hand, aber erkannt hat er weder mich noch sonst jemanden.« Gauweilers Chauffeur bringt sie anschließend zurück nach München.
Ebenfalls am Nachmittag schickt die Staatskanzlei zwei Spezialisten nach Regensburg: Professor Dr. Siebert, Chef-Chirurg der Uniklinik Rechts der Isar, und Professor Dr. Peter, Chef-Anästhesist vom Klinikum Großhadern. Gauweiler lässt mit Hubschraubern zusätzliche medizinische Geräte nach Regensburg einfliegen, die aber nicht eingesetzt werden. Gegen 15.00 Uhr ringen insgesamt sechs Ärzte um das Leben des Ministerpräsidenten. Dr. Valentin Argirov, der seit achtzehn Jahren als Leibarzt von Strauß fungiert, wird mit Tränen in den Augen gesehen, als er im Park des Krankenhauses Luft schnappt. »Es sieht sehr sehr ernst aus«, sagt er. »Wir müssen das Schlimmste befürchten.«
Um 19.00 Uhr erscheint das dritte Bulletin. Strauß befinde sich »weiterhin in kritischem Zustand«, heißt es. »Die lebenswichtigen Funktionen sind aber jetzt stabil.« Es ist von Organversagen der Lunge und der Nieren die Rede, zudem zeichne sich eine Infektion ab. »Die Prognose ist nach wie vor als ernst zu bezeichnen.«
Inzwischen ist der Andrang der Journalisten so groß, dass das Pressezentrum in ein Hotel verlegt wird. Der Gesundheitszustand von Strauß beherrscht nun alle Nachrichtensendungen, und die ganze Republik erlebt mit, was die Kinder schon seit Jahren beschäftigt: Die Sorge über die Gesundheit ihres Vaters. Später sagen sie: »Seine Gesundheit war immer Thema bei uns.« Natürlich fühlte Strauß sich »pumperlgsund«, wenn er gefragt wurde. Aber weder sein eigenes Verhalten noch das seiner unmittelbaren Umgebung konnte ihn »gesund« halten: Er ließ sich nichts sagen.
Montag, 3. Oktober 1988: Früh um sechs Uhr ruft Peter Gauweiler bei Renate Piller an. »Da schien Franz Josefs Zustand ganz stabil«, erinnert sich die Freundin. Es ist Gauweilers letzter Anruf. Die Pressekonferenz um 9.00 Uhr beginnen die Ärzte mit der guten Nachricht, dass es in der Nacht davor »zu keiner weiteren Verschlechterung« gekommen sei. Allerdings müssten Herz und Kreislauf weiter »maximal unterstützt« werden. Die Ärzte weigern sich, Prognosen zu stellen. Die Journalisten erfahren, dass Strauß noch vor einer Woche selbst nach Bulgarien geflogen war und dass während des Flugs ein plötzlicher Druckluftabfall aufgetreten war. Strauß hatte den Flieger von 10000 Metern auf 1000 Meter Höhe fallen lassen müssen. Hatte seine Lunge dabei Schaden erlitten? Sein Leibarzt Dr. Argirov, der ihn nach Bulgarien begleitete und mit im Flieger saß, sagt nein. Erst vor kurzem habe er seine Fitness getestet, Strauß sei gesund gewesen. Dann sagt der Leibarzt noch: »Bitte erwarten Sie keine Sensationsmeldungen. Wir müssen viel Geduld haben.« Es klingt, als würde der Arzt nicht mit dem Schlimmsten rechnen, als sei Strauß auf dem Weg der Besserung und als bestehe noch Hoffnung. Etliche Journalisten reisen ab. Die wenigen, die im Pressezentrum bleiben, werden um 12.22 Uhr durch die Nachricht aufgeschreckt, Strauß sei um 11.45 Uhr gestorben. Der Bayerische Rundfunk unterbricht sein Programm und sendet Trauermusik. Eineinhalb Stunden später tritt Professor Klaus Peter »tief erschüttert« vor die Presse. Seit Samstagabend schon habe sich der Zustand von Strauß nicht mehr gebessert, und man habe immer mehr Medikamente einsetzen müssen. »Man muss eingestehen, dass auch die Medizin den schicksalhaften Verlauf nicht hat aufhalten können«, sagt Peter. Als Todesursache nennt er ein Multiorganversagen von Lungen-, Nieren- und Kreislaufsystem. Die genaue Ursache bleibt ungenannt.
Wer will schon Verantwortung übernehmen für den Tod eines großen Mannes? »Es ist immer gefährlich, prominent zu sein – besonders als Patient«, zitiert der Spiegel einen ungenannten Intensivmediziner. »Mit diesen Leuten geschieht zu viel. Sie werden maximal, aber oft nicht optimal versorgt.« Als bayerischem Landesvater widerfuhr dem bewusstlosen alten Mann »die geballte Kraft des medizinischen Rettungswesens«, behauptet das Nachrichtenmagazin. »Das hat er nicht überlebt.«
Der Münchner Gerichtsmediziner Wolfgang Spann seziert die Leiche seines Freundes. Entgegen kollegialem Brauch dürfen die behandelnden Ärzte nicht an der Obduktion teilnehmen, berichtet der Spiegel. Das Ergebnis, erklärt die Bayerische Staatsregierung, werde nicht bekannt gegeben.
6. September 2005. Siebzehn Jahre nach dem Tod von Franz Josef Strauß versammeln sich seine Kinder, weitere Verwandte, CSU-Politiker, zwei Geistliche und zwei Dutzend Schaulustige und Anhänger auf dem Friedhof von Rott am Inn. Der Friedhof des kleinen Ortes zwanzig Kilometer nördlich von Rosenheim liegt malerisch auf einem Berg, direkt neben dem ehemaligen Kloster, in dem Monika und ihre Brüder Max und Franz Georg unbeschwert aufgewachsen sind. Hier hat schon ihre Mutter Marianne ihre Kindheit verbracht, und hierhin zog sich der Vater Franz Josef von seinen Niederlagen in der Bonner Politik zurück. Am Rande des Friedhofs liegt die Familiengruft. Vater und Mutter und ihre Vorfahren sind hier begraben. Es ist ein besonderer Tag für die Familie Strauß: Heute wäre Franz Josef Strauß neunzig Jahre alt geworden.
Franz Josef Strauß verkörperte die alte Bundesrepublik wie kaum ein anderer Politiker. Anfang und Ende seines politischen Lebens fallen mit Anfang und Ende der alten Bundesrepublik zusammen. Er saß ab 1948 im Wirtschaftsrat, dem Parlament der Bizone. Ab 1949 gehörte er dem ersten Bundestag an und war insgesamt viermal Bundesminister – für besondere Aufgaben, für Atom, für Verteidigung und für Finanzen; dreimal unter Kanzler Adenauer, einmal unter Kanzler Kurt Georg Kiesinger. Er war Verteidigungsminister zu einer Zeit, als dieses Ministerium die Außenpolitik bestimmte. Doch seine Ambitionen zielten auf das Kanzleramt. Der Einserschüler Strauß wollte immer der Beste, der Erste, der Mächtigste sein, obwohl er doch »als Zweiter unübertrefflich war«, schreibt Spiegel-Autor Wolfram Bickerich in seiner Biographie über ihn.
Zwar scheiterte er in seinem Versuch, Kanzler zu werden, dafür bekamen Kanzler Helmut Kohl und die Parteifreunde von CDU und CSU seinen Anspruch und Ehrgeiz später umso heftiger zu spüren. Strauß selbst drückte es so aus: »Mir ist egal, wer unter mir Kanzler ist.« Oft genug stand er sich mit seinem Ehrgeiz, dem Poltern und Polarisieren selbst im Wege. »Eine der großen Begabungen in der Politik«, nannte ihn Willy Brandt, »aber eine, die mit dem Hintern oder dem Mundwerk wieder umstößt, was die Hände gerade aufgebaut haben.«
Niemand konnte seinem ergebenen Volk besser vermitteln, dass selbstbewusste barocke Pracht und Machtentfaltung letztlich dem Wohle aller diene, schrieb die Weltwoche. Die erinnerungsselige Schar der Strauß-Anhänger ergötzte sich gerne an seinen schneidigen Taten: Wie der Hobbypilot Strauß sein Kabinett zum Staatsbesuch nach Moskau flog; wie ein niederbayerischer Bäderunternehmer dank der Nähe zum bayerischen Ministerpräsidenten seinen zweifachen Lebenstraum verwirklichen konnte, nämlich Millionär mit Krankenkassenbeiträgen zu werden und kaum Steuern zahlen zu müssen.
Bereits in den sechziger Jahren war Franz Josef Strauß ein Politiker, dessen öffentliches Leben eine Erzählung vom Aufstieg und Fall und Wiederaufstieg eines scheinbar unbeugsamen Mannes – kurz: ein dramatisches Schauspiel – bot. »Es gibt wohl keinen zweiten Politiker in der Bundesrepublik, über den so viele festgefügte Urteile und auch Vorurteile, im Guten wie im Bösen, existieren«, sagte der Publizist Günter Gaus bereits 1965 über ihn.
»In Bayern gehen die Uhren anders, nämlich richtig«, pflegte Strauß zu sagen. Strauß nutzte seine Macht stets, um auch außerhalb Bayerns Politik zu machen, und wurde dafür von Anhängern und Gegnern gleichermaßen verehrt und gefürchtet. Er machte seine eigene Außenpolitik und sah sich ein Leben lang als geschichtsbewussten Geostrategen. In der Passauer Nibelungenhalle schimpfte er hemmungslos auf die Kommunisten in Ost und West; zugleich hielt er mit Milliardenkrediten die marode DDR am Leben.
Um 9.30 Uhr soll ein Polizeihubschrauber Ministerpräsident Edmund Stoiber und seine Frau Karin absetzen. Nur wenig verspätet treffen sie um 9.40 Uhr ein. Kränze werden zur Gruft der Familie getragen. Stoiber hält eine Rede und ehrt Strauß als »Vater des modernen Bayern«, als »Visionär« und als bedeutenden Politiker der Nachkriegszeit, der »Weltbürgertum und Heimatliebe auf einzigartige Weise« verbunden habe. Max bleibt im Hintergrund, selbst dann, als seine Schwester ihn nach vorne winkt. Die Bereitschaftspolizei spielt Deutschland- und Bayernhymne.
Den Journalisten erzählt Monika Hohlmeier, dass für sie der 6. September eigentlich kein Tag der Trauer, sondern ein Tag schöner Erinnerungen sei. Im Landhaus in Rottach-Egern am Tegernsee, am Odeonsplatz in München und im Ferienhaus in Südfrankreich habe man wunderbare Geburtstagsfeiern mit vielen Anhängern erlebt. Die, pflichtet ihr ihr 16-jähriger Sohn Markus bei, kenne auch er von Bildern. Er selbst hat den Opa nicht mehr erlebt.
Die Kinder von Franz Josef Strauß mussten erleben, wie erst das Andenken an ihren Vater geschmälert wurde und dann sie selbst gefallen sind. Ihre Zukunft ist ungewiss. Beim Tod von Franz Josef Strauß war von einer Zäsur für die Politik in Deutschland und in Bayern die Rede gewesen. Siebzehn Jahre später hat sich in der Politik vieles gewandelt, selbst in Bayern lebt man gut ohne Strauß. Siebzehn Jahre später ist klar, dass sein Tod vor allem das Leben seiner Kinder auf eine Art verändert hat, die sie nicht wahr haben wollen.
An diesem 6. September 2005 fällt die Bilanz der Erben, die sich um das Grab von Franz Josef Strauß versammeln, ernüchternd aus: Zwar ist der politische Ziehsohn Edmund Stoiber Ministerpräsident von Bayern geworden, den Sprung zum Kanzler hat indes auch er nicht geschafft. Schlimmer ist es den leiblichen Kindern ergangen: Max ist zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden und muss auf die Berufung hoffen. Monika ist dem Vater in die Politik gefolgt, vor wenigen Monaten jedoch gestürzt worden, und das von der eigenen Partei. Vor einigen Monaten hat der Freistaat sogar mit Zustimmung der CSU-Regierung versucht, die Gruft der Eltern zu pfänden.
Siebzehn Jahre später sprechen Monika Hohlmeier und ihre Brüder ungern vom Erbe des Vaters. Sie vermeiden es, seinen Lebensweg mit dem eigenen Schicksal in Verbindung zu bringen. Dabei ist die Frage nahe liegend: Was hat der Aufstieg und Fall des Vaters mit dem Aufstieg und Fall der Kinder zu tun? Sind sie wegen der gleichen Stärken und Schwächen gestürzt, die erst seinen Erfolg bedingen und dann sein Scheitern? Wird das Erbe des Vaters, das den Kindern zunächst so viele Vorteile verschafft, ihnen schließlich zum Verhängnis? Verursachen die gleichen Kräfte, die den Aufstieg der Familie Strauß begründen, auch ihren Fall? Davon handelt dieses Buch.
1 Die Kindheit und die Angst vor »den Roten«
Am 7. November 1918 ist es ungewöhnlich warm in München, und die Leute klagen über Föhn. Es ist nicht verbürgt, ob Franz Josef Strauß sen. seinen kleinen Metzgerladen in der Schellingstraße 49 den ganzen Tag über geöffnet hat. Die meisten Geschäfte in Schwabing und in den anderen Teilen der Stadt jedenfalls bleiben an diesem Tag geschlossen, ebenso Betriebe und Ämter. Die Angestellten sollen die Möglichkeit haben, an einer Kundgebung auf der Theresienwiese teilzunehmen. Auf der großen Wiese in der Nähe des Hauptbahnhofs, auf der alljährlich das Oktoberfest stattfindet, rufen SPD, Gewerkschaften und die kommunistische USPD für den ersten Jahrestag der russischen Oktoberrevolution gemeinsam zu einer Friedenskundgebung auf.
Strauß muss keine Rücksicht auf Angestellte nehmen, die einen freien Tag hätten fordern können. Er hat keine. Seine einzige Mitarbeiterin ist seine Frau Walburga. Er hofft, dass seine Tochter Maria vielleicht bald mehr helfen kann. An einem milden Tag wie diesem macht er sich Sorgen um seine Fleischwaren. Lohnt es sich, in der Schlachterei Fleisch einzukaufen? Sind überhaupt Kunden zu erwarten? Falls sie ausbleiben, ist dann genug Eis da, um das Fleisch zu kühlen? Kühlschränke gibt es damals noch nicht, und Strauß kann es sich nicht leisten, Vorräte zu halten.
Strauß ist zwei Monate zuvor 43 Jahre alt geworden und könnte eigentlich trotz der unruhigen Zeiten halbwegs zufrieden in die Welt blicken: Er war aus dem kleinen Ort Kemmathen in Franken nach München gekommen. Weil ein älterer Bruder den elterlichen Hof übernahm, musste er sich in der großen Stadt Arbeit suchen, und er fand mit Walburga eine Frau, die wie er der Arbeit wegen nach München gezogen war. Sie stammt aus dem noch kleineren Ort Unterwendling bei Kelheim nahe Regensburg. Der Ort besteht aus nur vierzehn Häusern. München ist für beide eine ganz andere Welt. Vor allem Schwabing zieht nach der Jahrhundertwende viele Leute an, die man auf dem Land nicht kannte: Künstler, Studenten und Bohemiens. Zumindest an ihren Anblick werden sich Walburga und Franz Josef aber bald gewöhnt haben, denn Universität und Kunstakademie liegen in unmittelbarer Nähe ihres Metzgerladens in der Schellingstraße.
Im November 1906 heiraten Walburga und Franz Josef. Eigentlich planen sie ihre Feier für den 13. November. Ausgerechnet an diesem Tag sind jedoch die Standesämter geschlossen, weil Kaiser Wilhelm II. zur Grundsteinlegung des Deutschen Museums nach München kommt. So müssen sie die Hochzeit um zwei Tage verschieben. Sie leben in sehr bescheidenen, aber nach damaligen Kriterien nicht ärmlichen Verhältnissen. Immerhin ist es ihnen gelungen, aus der Provinz nach München zu ziehen und sich dort hochzuarbeiten. Immerhin hat Franz Josef Strauß das Bürgerrecht erhalten, was keine Selbstverständlichkeit ist, und er hat sich selbstständig gemacht. Er ist sein eigener Herr, wenn auch abhängig von der Nachfrage, und ständig überarbeitet. Seit 1904 betreibt er seinen eigenen Laden. Es ist eine so genannte Altmetzgerei, die nur frisch geschlachtetes Fleisch und hausgemachte Leberwurst verkauft. Die Familie hat keine Sicherheiten. Sie muss von Montag bis Samstag arbeiten und lebt von der Hand in den Mund. Später behauptet Franz Josef Strauß, seine Eltern hätten über Jahrzehnte hinweg keinen einzigen freien Tag gehabt. Aber sein Vater hat es immerhin so weit gebracht, dass er fürchten muss, das Wenige, das ihm gehört, zu verlieren.
Im Jahr nach der Heirat wird Maria geboren. Jetzt, 1918, ist sie elf Jahre alt und zeigt Geschick und Begeisterung im Umgang mit Zahlen, so dass der Vater sie wohl bald ohne Bedenken an die Kasse lassen kann. Ein Schwesterchen ist 1914 kurz nach der Geburt gestorben. Doch ein Jahr später – am 6. September 1915 – wird ein Sohn geboren, der gesund zu sein scheint. Die damals achtjährige Maria ahnt zunächst nichts von der Geburt. Sie glaubt noch an den Klapperstorch, wie sie später sagt. »Darum wunderte ich mich sehr, dass […] als ich spät vom Nachmittagsunterricht heimkam, statt der Mutter unser Dienstmädchen Theres das Abendessen auf den Tisch stellte und erklärte: ›Die Mama ist krank. Du darfst nicht zu ihr ins Schlafzimmer gehen.‹ Nachdem ich meine Hausaufgaben gemacht hatte, wurde ich gleich ins Bett geschickt, konnte aber lange nicht einschlafen. Auf einmal hörte ich das Schreien eines Babys und merkte, dass diese Laute nicht aus der Nachbarwohnung, sondern aus dem Schlafzimmer meiner Eltern kamen. Erst am nächsten Morgen durfte ich meine Mutter besuchen und mein ruhig schlafendes Brüderchen anschauen.«
Wenige Tage später taufen Walburga und Franz Josef ihren Sohn auf den Namen Franz Josef. Zu Hause gibt es ein Festessen, das wegen des Krieges aber bescheiden ausfällt. Franz Josef sen. hofft, dass der Junge eines Tages seine Metzgerei übernehmen und dann für die Familie sorgen wird. Davon geht er aus. »Obwohl die Lebensmittelzuteilung sogar für Kinder sehr schlecht war, gedieh das Baby prächtig und sah bald viel besser aus als ich«, erinnert sich seine Schwester. »Einmal fragte jemand, ob ich ein angeborenes Stiefkind sei, was unsere Mutter sehr kränkte.« Die Geschwister gleichen nicht einander, sondern der Junge sieht ganz wie seine Mutter aus; die Tochter wie der Vater. Aufgrund des unterschiedlichen Aussehens werden die beiden später oft gar nicht für Geschwister gehalten.
Wenngleich die Eltern nicht viel besitzen, eines haben sie in großem Maße: den Glauben an Gott. Sonntags geht die Familie in die Josefskirche, und das Wort eines Pfarrers hat für Strauß sen. großes Gewicht. Den Namen Martin Luther hingegen darf man in der Gegenwart des Vaters nicht aussprechen, und wenn doch, macht er das Kreuzzeichen, als müsste er sich vor dem Teufel schützen.
Es spricht einiges dafür, dass Franz Josef Strauß an der Kundgebung auf der Theresienwiese nicht teilnimmt, obwohl viele Menschen aus den Häusern, Läden und Cafés in seiner Nachbarschaft über dass Ereignis sprechen und sich den Demonstranten anschließen. Er hält nichts von den Veranstaltern, der SPD, den Gewerkschaften und der USPD. Ein Jahr später, 1919, tritt er der konservativen Bayerischen Volkspartei bei, deren Gründungsmitglied er wird. Traditionen sind ihm wichtig, und deshalb blickt er besorgt in die Zukunft. Am liebsten wäre ihm, wenn alles so geblieben wäre wie vor dem Krieg.
Er mag Ludwig III., der König und doch eine bürgerliche Erscheinung ist, »einfach und von rührender Aufrichtigkeit«, wie der Historiker Benno Hubensteiner in seiner Bayerischen Geschichte schreibt. »In seiner inneren Abneigung gegen alles Höfische und Zeremonielle hatte er nichts dagegen, wenn ihn ein Bauer nach alter Art mit ›Du‹ anredete, und auch als König verging kaum eine Woche, ohne dass er sich mit ein paar Münchner Bürgern in einer Wirtschaft an der Türkenstraße zur Kegelpartie traf«, so Hubensteiner. Selbst August Bebel habe einmal vor dem Reichstag gesagt: »Wenn wir eine Reichsverfassung hätten, nach der der Kaiser vom Volk gewählt würde, […] ich gebe Ihnen mein Wort, Prinz Ludwig hätte die größte Aussicht, Deutscher Kaiser zu werden.«
Von der Türkenstraße zum Laden der Familie Strauß sind es nur ein paar Meter. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sich der Metzger und der König zufällig auf der Straße treffen. Falls doch, hätte sein Sohn später sicher davon erzählt. Ludwig III. ist selbst Bauer und kümmert sich auf seinem Gut in Leutstetten um alles selbst. Abends geht er mit der Lampe durch die Ställe. Am liebsten eröffnet er Landwirtschaftsausstellungen. Seine Gegner verspotten ihn deshalb als »Millibauer« – Milchbauer. Andere nennen ihn wegen seiner stets zerknitterten Hosen auch »Ludwig den Vielfältigen«. Vielleicht wünscht sich Strauß sen. aber gerade wegen dieser Volksnähe des Königs, Ludwig III. möge weiterhin über Bayern herrschen.
Doch im November 1918 ist unklar, wer regieren wird. Nach vier Jahren Krieg ist das Volk müde und unzufrieden und wirft dem König vor, dass er sich nicht stärker gegen Berlin und für den Frieden einsetzt. An den politischen Rändern gärt es. Der Polizei liegen Hinweise auf einen Umsturzversuch der USPD vor. Dennoch fordert Ludwig III. die Polizei auf, zurückhaltend zu sein. Ihm liegt daran, den Übergang zur parlamentarischen Monarchie in Bayern so problemlos wie möglich zu gestalten. Er will Kämpfe vermeiden. Am 7. November geht er im Englischen Garten spazieren. Arbeiter, die er zufällig trifft, sagen: »Majestät, gengan’s hoam und bleibn’s in der Residenz, sonst passiert Ihnen was […] Heit machan’s nämli Revolution!« Der König ist irritiert, aber der Ernst der Lage ist ihm nicht bewusst.
Am frühen Nachmittag ist es schwül wie vor einem aufziehenden Gewitter. Tausende strömen von der Ludwigstraße in Demonstrationszügen Richtung Theresienwiese. Als die Kundgebung um drei Uhr nachmittags beginnt, sind rund 60000 Menschen versammelt. Zwölf Redner sprechen an verschiedenen Stellen des Platzes zu ihnen, darunter Erhard Auer, der Vorsitzende der bayerischen SPD, Ludwig Gandorfer, ein radikaler Vertreter des Bayerischen Bauernbundes, und Kurt Eisner, der Vorsitzende der USPD. Einige wollen die Leute beruhigen und weisen auf kommende Reformen hin. Andere fordern rasche Änderungen. Eisner sagt, ein sozialistisches Rätesystem solle die Monarchie ersetzen. Rund 1000 bis 2000 Anhänger, darunter vor allem Soldaten, scharen sich um ihn. Eisner hat sich mit ihnen gleich zu Beginn der Kundgebung im Norden der Wiese aufgestellt, um anschließend möglichst rasch und ohne aufgehalten zu werden zu den Kasernen zu gelangen. Nach Ende der Reden verfasst die Menge eine Resolution: Darin fordert sie einen sofortigen Friedensschluss, den Achtstunden-Arbeitstag und eine Arbeitslosenversicherung. Außerdem soll der deutsche Kaiser abdanken.
»Mit einem Schlage gerieten die johlenden Massen ins Vorwärtsdrängen«, notiert der Münchner Schriftsteller Oskar Maria Graf, der an der Spitze des Zuges mitmarschiert. »Wie eine […] schwarze Welle wälzten sich die tausend und aber tausend Menschen hangaufwärts auf die Strasse; weiter ging es im Schnellschritt, an geschlossenen Häusern und herabgezogenen Rolläden vorbei, den Kasernen zu. […] Keine Gegenwehr kam. Alle Schutzleute waren wie verschwunden. […] Überall gesellten sich neue Trupps zu uns, nun auch schon einige Bewaffnete. Die meisten Menschen lachten und schwatzten, als ging’s zu einem Fest. Hin und wieder drehte ich mich um und schaute nach rückwärts. Die ganze Stadt schien zu marschieren.« Die Demonstranten schwenken rote Fahnen, sie halten Trambahnen und Züge an, sie plündern Waffenläden und schießen um sich. In München herrscht Revolution.
Die Revolutionäre haben »leichtes Spiel« in den Kasernen, wie der Historiker David Clay Large berichtet, »da die wachhabenden Soldaten prompt zu den Aufständischen überliefen«. Nur vor der großen Türkenkaserne stoßen die Aufständischen auf Gegenwehr, können sie aber rasch überwinden. »Die Sache wäre zweifellos anders ausgegangen, wären die Regierungstruppen fest entschlossen gewesen, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln gegen die Rebellen vorzugehen«, betont Large. Doch nach vier Jahren Krieg seien sie nicht mehr bereit gewesen, ihr Leben für die Wittelsbacher zu geben. Zudem hatten die Zivilbehörden die von Eisner und seinen Anhängern ausgehende Gefahr unterschätzt. Sie waren unvorbereitet und unentschlossen und wussten nicht, was sie tun sollten.
Eine große Gruppe der Aufständischen hält im größten Bierkeller Münchens, dem Mathäserbräu, eine improvisierte politische Kundgebung ab. Untermalt von alkoholisierten Hochrufen, wird der erste Münchner Rat der Arbeiter, Soldaten und Bauern mit Eisner als Vorsitzendem gewählt. Der Rat schickt Soldaten los, wichtige Gebäude zu besetzen. Zugleich lässt er Hunderte gelber Mitteilungsblätter anschlagen, die den Beginn einer neuen Ordnung verkünden. »Es lebe der Frieden! Nieder mit der Dynastie!«
Gegen zehn Uhr abends machen sich die Mitglieder des Rats, beschützt von einer bewaffneten Garde von sechzig Mann, auf den Weg zum Landtagsgebäude, wo Eisner die Geburt der bayerischen Republik verkündet: »Die bayerische Revolution hat gesiegt, sie hat den alten Plunder der Wittelsbacher Könige hinweggefegt. […] Jetzt müssen wir zur Bildung einer Regierung fortschreiten. […] Der, der in diesem Augenblick zu Ihnen spricht, setzt Ihr Einverständnis voraus, dass er als provisorischer Ministerpräsident fungiert.«
Franz Josef Strauß sen. hätte sich wohl gewünscht, dass der König sich gegen den Umsturz wehrt. Stattdessen tritt der auf Anraten seiner Berater in Zivilkleidung, die Zigarrenkiste unterm Arm, die Flucht an. Sogar sein Chauffeur ist zu den Revolutionären übergelaufen. Der König muss sich an den Eigentümer einer Mietwagenfirma wenden, um Ersatz zu finden. Er sieht die Flucht als vorübergehend an, aber darin täuscht er sich.
Abends beginnen in der ganzen Stadt alle Glocken zu läuten, die den Krieg überdauert haben. Erst hört man in der Schellingstraße ein fernes Dröhnen vom Liebfrauendom, dann scheint es, als komme der dumpfe, rollende Klang immer näher. In das Hämmern der Liebfrauenkirche mischt sich das Glockenläuten der Theatinerkirche und dann der Ludwigskirche. Der nahe Klang wird untermalt vom fernen Läuten zahlreicher anderer Türme.
»München war die erste deutsche Landeshauptstadt, in der ein regierender Monarch seinen Thron verlor, und die letzte deutsche Stadt, in der nach den Umwälzungen von 1918–1919 wieder Ruhe und Ordnung einkehrten«, betont der Historiker Large. Anders als beim misslungenen Januarstreik, bei dem er zunächst verhaftet worden war, zielte Eisners Rhetorik diesmal nicht auf die Arbeiter, sondern auf die kriegsmüden Soldaten. Als sie zu ihm übergelaufen sind, kann sich der Staat nicht mehr wehren. Niemand gibt sein Leben für die Monarchie, nur die Kirche protestiert. Eisner wird der erste Ministerpräsident Bayerns – ausgerechnet ein Kommunist aus Berlin. Er tritt für die Demokratie ein. Allerdings gelingt es ihm in den wenigen Monaten als Ministerpräsident nicht, die Massen hinter sich zu halten. Seine Leute sind nicht zahlreich genug; die Soldaten verlassen ihn wieder; seine Anhänger sind zu jung, um Einfluss zu haben. Er hat die SPD eingebunden, und der Preis dafür war ein Verlust vieler Ämter an sie. Vermutlich hat Strauß sen. die Ideen und Ziele Eisners nicht wirklich gekannt. Vielleicht hat er gefürchtet, Eisner könnte die Betriebe verstaatlichen und ihm seine Selbstständigkeit nehmen. Genau das tut Eisner nicht. Schließlich verehrt er – zum Verdruss etlicher Anhänger – Kant mehr als Marx und will den Kommunismus auf seine Art verwirklichen. Eine Verstaatlichung der Betriebe liegt ihm fern.
Im Hause Strauß herrscht vermutlich dennoch keine hohe Meinung von ihm – von konservativer Seite wird er heftig kritisiert. Eisner kann seine Pläne nicht verwirklichen und verliert immer mehr Anhänger. Als er nach nur dreieinhalb Monaten den Rücktritt einreichen will, wird er auf dem Weg zum Parlament erschossen. Sein Tod bewegt viele Menschen. Der Trauerzug zum Ostfriedhof entwickelt sich zu einem der größten, den die Stadt jemals erlebt hat. Angeblich begleiten ihn 100000 Menschen. Immerhin hat Eisner in 100 Tagen nicht nur die mehr als 700 Jahre alte Monarchie gestürzt und den Freistaat ausgerufen. Er hat auch das Frauenwahlrecht und den Achtstundentag eingeführt, die Sonntagsarbeit abgeschafft, Betriebsräte eingeführt und Staat und Kirche zu trennen versucht. »Die hundert Tage der Regierung Eisner haben mehr Ideen, mehr Freuden der Vernunft, mehr Belebung der Geister gebracht als die 50 Jahre vorher«, sagt der Schriftsteller Heinrich Mann in seiner Trauerrede.
Nach Eisners Tod verschärfen sich die Unruhen. Alles wird nur noch schlimmer. Large: »Ausgelöst zunächst durch ohnmächtige Wut über den scheinbar endlosen Krieg und heillosen Haß auf die Zentralgewalt in Berlin, trieb die Revolution in München Exzesse an Unverantwortlichkeit und Haß hervor, die Angst und Schrecken verbreiteten.« Es gibt viele Hunderte Tote.
Die »rote« Revolution und die Angst davor, das ist die Zeit, in die Franz Josef hineingeboren ist. Er bekommt von alledem freilich nichts mit, denn er ist ja damals erst drei Jahre alt. Oder vielleicht doch? Später sagt er einem seiner Biographen, Thomas Dalberg, seine früheste Kindheitserinnerung stamme aus dem Jahr 1918, als der Krieg vorbei ist und die Revolution beginnt. Das »dramatische Sturmläuten der Glocken, im königstreuen Elternhaus mit Angst und Bestürzung registriert«, prägen sich ihm »unauslöschlich« ein, wie Dalberg notiert.
Die Worte stammen vom Biographen, aber man darf davon ausgehen, dass Strauß genau so empfindet – denn er und seine Schwester Maria autorisieren das Manuskript des 1968 erschienenen Buches. Natürlich ist er 1918 noch zu klein, um die Ereignisse bewusst wahrzunehmen. Aber im Unterbewusstsein habe er die angstvolle Stimmung in seinem Elternhaus sehr wohl wahrgenommen, sagt er später. Es ist anzunehmen, dass die konservative politische Haltung des Vaters und diese früh erlebte, unbewusste Angst vor den Kommunisten ihn prägen. Unbewusst, aber deshalb vielleicht umso wirkungsvoller, lernt er, dass »die Roten«, wie die Kommunisten in Bayern genannt werden, Chaos auslösen und die Ordnung stören.
König Ludwig III. verlebt seine letzten Jahre im Exil. Erst als der letzte bayerische König im Jahr 1921 gestorben ist, darf er nach München zurückkehren. Franz Strauß ist sechs Jahre alt. Im Hause Strauß trauert man, und Franz sieht an einem regnerischen Novembertag zu, wie der Trauerzug den Sarg direkt an seiner Haustür vorbei durch die Schellingstraße begleitet. Wieder untermalen dumpfe Glocken das Schauspiel, das Tausende schweigend verfolgen. Während sein Vater einer vergangenen Ära nachtrauert, hat der Sohn andere Gedanken: »Aus dem pompösen Trauergeleite, das die junge Republik dem einige Jahre vorher zur Abdankung gezwungenen König veranstaltete, blieben mir besonders die Gugelmänner in Erinnerung.« Die Königstreuen mit ihren Kapuzen sind für den kleinen Franz ein ganz besonderer Anblick, »weil sie mir so furchterregend schienen«.
2 Heranwachsen in der Straße der Bewegung
Im Jahr 1921 – Franz Strauß ist sechs Jahre alt – zieht im Haus gegenüber in der Schellingstraße 50 der Fotograf Heinrich Hoffmann ein. Der Mann gilt in seiner Branche als hochprofessionell und hat es zu einiger Berühmtheit unter seinesgleichen gebracht. Sein Vater war Hoffotograf bei Ludwig III. gewesen. Schon mit elf Jahren hat er bei seinem Onkel in Regensburg Porträtfotografie erlernt. Der Onkel war zwar »Hof-Photograph seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Hessen«. Aber dessen Atelier mit seinen gerafften Samtvorhängen und den Plüschkanapees bedrückt den Neffen. Er will modern arbeiten und geht deshalb nach Darmstadt. Dort und bei weiteren Stationen kommt er mit dem europäischen Adel in Kontakt und macht u.a. die Bekanntschaft des Kaisers und des Königs von Siam, der ihm für Bilder in Lebensgröße die damals sagenhafte Summe von 27000 Goldmark zahlt.
Schließlich landet Hoffmann 1906 im Alter von einundzwanzig Jahren in München, wo er im »Atelier Elvira« bei zwei Damen mit Hosen und Kurzhaarschnitt arbeitet und auf Künstler wie Kaulbach, Lenbach und Stuck trifft. Hoffmann lernt malen, geht dann aber 1907 des Geldes wegen nach London, wo er im Auftrag von Scotland Yard die Slums der Stadt fotografiert. Später porträtiert er in London Prominente wie den Dichter George Bernard Shaw und die ersten Flieger, die Gebrüder Wright. 1909 kehrt er nach München zurück und lernt in Schwabing die Maler Wassily Kandinsky und Franz Marc kennen. Er kauft Marc sein Atelier in der Schellingstraße 33 ab und fotografiert fortan die Berühmtheiten seiner Zeit wie z.B. den Tenor Caruso oder den Physiker Röntgen.
Im Anwesen Schellingstraße 50 lässt er in dem verwilderten Garten eine Arche Noah bauen und dreht mit dem Schauspieler Emil Jannings den Stummfilm Die Sintflut. Er gründet die »Fotoberichterstattung Heinrich Hoffmann« und wird Vertreter der amerikanischen Associated Press. Am 30. Oktober 1922 erhält er ein Telegramm aus den USA: »absendet umgehend bild adolf hitler stopp bieten honorar hundert dollar« Hoffmann ist erstaunt über die Höhe des Honorars. Reichspräsident Ebert bringt ihm sonst nur fünf Dollar ein, und für die anderen Prominenten bekommt er kaum mehr. »Und für den fast unbekannten Hitler zahlt AP einen solchen Überpreis?«, denkt Hoffmann. Das versteht er nicht.
Er wendet sich an seinen Duzfreund Dietrich Eckart, Hauptschriftleiter des Völkischen Beobachters, der Hitlers Aufstieg mitfinanziert und daher auch dessen Duzfreund ist. Eckart rät Hoffmann, das Vorhaben aufzugeben. Hitler lasse sich grundsätzlich nicht fotografieren. Wer ein Bild von ihm haben wolle, der müsse zahlen. »Keine 100 und keine 1000 Dollar, sondern 30000!«
Die Forderung kommt Hoffmann ungeheuerlich vor. Aber so leicht will er sich nicht entmutigen lassen, schließlich liegen Redaktion und Druckerei des Völkischen Beobachters nur ein paar Meter entfernt auf der anderen Straßenseite, im so genannten Buchdruckerhaus in der Schellingstraße 39/41. 1920 hat Hitlers Partei auf sein Drängen hin den Völkischen Beobachter gekauft und zur Parteizeitung ausgebaut. Ab 1922 wird das Blatt in der Schellingstraße fertig gestellt und gedruckt. Hitler kommt regelmäßig dorthin, um letzte Korrekturen an Artikeln vorzunehmen.
Wer wollte ihn, Hoffmann, an einer Aufnahme hindern? Hitler steht in der Öffentlichkeit und muss sich gefallen lassen, fotografiert zu werden, auch wenn er – wie Eckart erklärt – glaubt, dass ihn seine Kamerascheu nur noch interessanter macht für Zeitungen und die Leute schon allein deshalb zu seinen Reden kämen, um ihn einmal zu sehen. Die Schwabinger Zeitschrift Simplicissimus, deren Redaktion ebenfalls nur ein paar Meter entfernt liegt, bringt unter dem Titel »Wie sieht Hitler aus?« Karikaturen, die das Rätselraten noch weiter anfachen.
Hoffmann soll das nur recht sein. Er will Hitler heimlich »schießen« und wartet tagelang auf eine Gelegenheit. Nach einer Woche sieht er vor der Druckerei Hitlers alten grünen »Selve«-Wagen stehen. Hoffmann läuft schnell hinüber und erkundigt sich beiläufig nach Eckart, ohne dass er ihn wirklich sucht. Ihm liegt nur an Hitler. Tatsächlich, da steht der Mann mit dem charakteristischen Bärtchen im Trenchcoat an einem Stehpult. Die Peitsche, die er stets bei sich trägt, hat er auf das Pult gelegt. Er schreibt. Hoffmann hat ihn schon einige Male gesehen und erkennt ihn sofort. »Hitler wandte sich mir zu und ich wiederholte meine Frage nach Eckart«, erinnerte sich Hoffmann später. Hitler antwortet: »Auf den warte ich auch.« Hoffmann geht schnell nach Hause und holt seine Kamera.
Auf der Straße spricht er mit dem Chauffeur und verspricht ihm ein Trinkgeld, falls er sich bei der Abfahrt Zeit lasse. Stunden vergehen. Endlich kommt Hitler in Begleitung von drei Männern. Während der Chauffeur das Auto ankurbelt, macht Hoffmann die Aufnahme. Doch genau in diesem Augenblick, erzählt er später, fühlt er Fäuste um sein Handgelenk. Hitlers Begleiter packen ihn am Hals und nehmen ihm die Kamera weg. Hoffmann wehrt sich vergebens. Einer der drei zieht die Platte aus der Kamera und belichtet sie. Hoffmann schimpft: »Das ist Einschränkung der persönlichen Freiheit!«
Hitler ist inzwischen ins Auto gestiegen. Hoffmann steht da mit zerknautschter Krawatte und ruinierter Platte und sieht, dass Hitler ihm beim Abfahren zulächelt. Nach diesem Misserfolg wird es für Hoffmann »zur fixen Idee«, Hitler zu fotografieren. Er hat Glück. Eines Tages erzählt ihm ein Bekannter, dass er heiraten werde. Hoffmann bietet an, die Hochzeitstafel in seiner Wohnung auszurichten. Erstaunt hört er, dass Hitler einer der Trauzeugen sei. Bei der Gelegenheit sprechen sich Hitler und Hoffmann schließlich aus. Hitler verspricht ihm, er dürfe Bilder von ihm machen, und bald danach geht Hitler ein und aus in dem Haus, das direkt gegenüber der Metzgerei Strauß liegt.
Von da an wird Hitler im Trenchcoat, mit Schlapphut, Schaftstiefeln und Hundepeitsche auch für Franz Strauß ein immer vertrauterer Anblick. Hitler kommt im Opel Laubfrosch und lädt den Kofferraum mit Flugblättern voll, die er auf Parteiveranstaltungen verteilt. Wegen seines weit vorgewölbten Hinterteils nennen der kleine Strauß und seine Freunde sein Auto »Arschauto«. Auch Hermann Göring und Heinrich Himmler gehen bald auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein und aus. Wenn München, wie Hitler in den Zwanzigern betont, »die Stadt der Bewegung« wird, dann wird die Maxvorstadt, in der Strauß wohnt, das Viertel der Bewegung, und die Schellingstraße wird zur Straße der Bewegung.
Die Schellingstraße, benannt nach dem ersten Präsidenten der Künstlerakademie, wird nach der Jahrhundertwende, also zu der Zeit, als Strauß sen. mit seiner Frau dorthin zieht, Treffpunkt der Studenten und Künstler. Damals leben mehr Künstler in München als in Berlin. Der Maler Franz Marc bezieht 1907 ein Atelier in der Schellingstraße 33, in dem er drei Jahre lang arbeitet und wohnt. In dieser Zeit lernt er den russischen Maler Wassily Kandinsky kennen, der in der Schellingstraße 75 wohnt. Gemeinsam veröffentlichen sie den Almanach Blauer Reiter. Auch Franz von Stuck lebt in dieser Straße. Frank Wedekind, der um die Ecke wohnt, schreibt viel für das Satireblatt Simplicissimus, das in einer Querstraße produziert wird. Gräfin Franziska zu Reventlow erwirbt sich auf Partys und in Cafés ihren Ruf als »Königin von Schwabing«. Sie nimmt sich ihre Männer einfach so oder gegen Bezahlung – und schreibt einen Roman. Als sie wegen Ehebruchs mehrfach verurteilt und daraufhin geschieden wird, zieht sie ihren Sohn in einer Wohngemeinschaft in der Schellingstraße 92 auf.
Man trifft sich im Schellingsalon, in der Osteria Italiana, Münchens erstem Lokal mit südlicher Küche, oder im Kaffeehaus Altschwabing – alles in Sichtweite der Metzgerei Strauß. Im Schellingsalon verkehren Hitler und Lenin, Rainer Maria Rilke, Bertolt Brecht, Joachim Ringelnatz und Henrik Ibsen. Nebenan im Kaffeehaus Altschwabing unterhalten sich die Schriftsteller Thomas Mann und Stefan George sowie die Maler Paul Klee, Franz Marc und Wassily Kandinsky. Im Café Stephanie, ebenfalls nur einen Steinwurf entfernt, treffen sich Leute wie die Schriftsteller Erich Mühsam oder Oskar Maria Graf und der Expressionist Johannes R. Becher. Gräfin zu Reventlow gibt dem Lokal den Namen Café Größenwahn. Ihrer Meinung nach geht Schwabing »im bildlichen Sinne weit über die Grenzen eines Stadtteils hinaus«. Für sie lebt an diesem Ort »eine geistige Bewegung«.
Es ist eine kleine Welt. Nicht die Welt von Strauß sen., der sich wie ein militanter Verteidiger seiner katholischen Frömmigkeit vorkommen muss und entsprechend benimmt. Wie einst in seiner Jugend in Franken in der evangelischen Diaspora. Doch sein Junge kommt hin und wieder mit der Boheme in Berührung. Schließlich muss er in den umliegenden Gaststätten für den Vater Bier holen, weil damals niemand Flaschenbier zu Hause hat. »Das Stück Schellingstraße zwischen Türkenschule und Café Schellingsalon umschließt die meisten Erinnerungen an meine Kinder- und Jugendzeit«, bemerkt Franz Josef Strauß später.
Neben dem Haus in der Schellingstraße 49, in der die Metzgerei und die Wohnung liegen, befinden sich ein Obst- und Gemüseladen und im Hof eine Bauschlosserei, wo die Kinder besonders gerne spielen. Dem Werkmeister der Schlosserei gefällt das allerdings weniger. Wenn er die Kinder davonjagt, klettern sie über die Mauer zur Schreinerei nebenan und spielen zwischen den Brettern weiter. Im Sommer laufen Strauß und seine Freunde gerne die Barerstraße entlang und verbringen viel Zeit in den Anlagen der Alten und Neuen Pinakotheken. Die Aufseher sehen allerdings nicht gerne, dass die Kinder allerlei von Bäumen und Sträuchern reißen. Die Stangen und Geländer, die die gepflegten Rasenflächen und Rosenbeete begrenzen und schützen sollen, nutzen sie als willkommene Turngeräte. »Wenn wir es wieder einmal zu bunt getrieben hatten, zogen wir vor, einige Zeit nicht mehr in den Anlagen zu erscheinen.«
Dann spezialisieren sie sich wieder mehr auf die Schellingstraße, in der sie schussern, Kreisel oder Reifen treiben. »Ja, wir spielten ganz vergnügt auf der Straße und schusserten neben dem Randstein und wenn ein Auto vorbeikam, hörten wir es von weitem und gingen schnell auf den Bürgersteig. Die Autos waren noch wenig, dafür gab es umso mehr Pferdefuhrwerke, und so wie heute die Buben einen Opel von einem VW wegkennen, so kannten wir von weitem die Pferde der verschiedenen Brauereien und der Eisfabrik.« Die Eisfabrik stellt allerdings kein Speiseeis her, sondern Eisblöcke, die regelmäßig zum Füllen der Eisschränke gebracht werden, weil es damals noch keine Kühlschränke gibt. »Heruntergefallene Eisbrocken hoben wir auf und lutschten sie, wenn wir sicher waren, dass unsere Mütter uns nicht sehen konnten.« Wenn in der Nähe ein Fuhrwerk hält, geht Franz in den Hof an die Kisten des Gemüsehändlers und holt Rettich- und Karottenkraut, um damit die Pferde zu füttern.
Auch Hitler kommt 1913 der Kunst wegen nach München, wohnt unweit vom Königsplatz und bemüht sich, als »Architekturmaler aus Wien« Anschluss zu finden. Er geht gerne ins Café Stephanie. Neben Dichtern und Malern wie Wedekind oder Klee leben in dem Viertel auch Nazis wie Himmler, die eine andere Bewegung anstreben. Statt an die Boheme findet Hitler 1919 Anschluss an die Deutsche Arbeiterpartei. Im Juli 1921 übernimmt er den Parteivorsitz. Familie Strauß bleibt nicht verborgen, dass die Schellingstraße schon vor dem Einzug der Reichsleitung der NSDAP in das Haus gegenüber mehr und mehr zum Mittelpunkt für die Nazis wird. Papiergeschäfte legen auch in Zeiten des Verbots der Partei den Völkischen Beobachter und Postkarten mit den Konterfeis der Parteigrößen aus.
Mit dem Einzug des Verlags Franz Eher ins Buchdruckerhaus rollen ab 1922 Wagen an, um Propagandazeitungen abzuholen. Nach dem gescheiterten Putsch und der Festungshaft gründet Hitler die NSDAP 1925 neu. Ab dieser Zeit druckt der Eher-Verlag Mein Kampf, das in 906 Auflagen schließlich über elf Millionen Exemplare erreicht. Bis Anfang der vierziger Jahre übernimmt der Verlag so viele Zeitungen, dass er als größter Pressekonzern der Welt gilt. Dies alles spielt sich in dem Stück der Schellingstraße ab, in dem Strauß seine Kindheit verbringt. Familie Strauß spricht fast täglich über Hitler und die Nationalsozialisten, schreibt Strauß in seinen Erinnerungen.
Heinrich Hoffmann wird Hitlers Leibfotograf. Irgendwann hängt er ein Porträt von ihm in sein Schaufenster. Hoffmann prägt Hitlers Image. Mit der Vermarktung von Hitler-Fotos und -Postkarten wird er sehr reich. Er wird Stadtrat, eröffnet Filialen und hat schließlich dreihundert Angestellte. Eine dieser Angestellten heißt Eva Braun, die spätere Frau Hitler. Enge Bekanntschaft schließt Hitler mit Hoffmanns Tochter Henriette, die für ihn eine Art Ersatztochter wird. Sie heiratet den Reichsjugendführer Baldur von Schirach. Ob Franz Josef Strauß und Henriette Hoffmann miteinander zu tun hatten, ist nicht bekannt. Strauß hat über die Nachbarn nur wenig erzählt. Mehrfach aber erwähnt er später folgende Anekdote:
Im Alter von sechs Jahren habe er an einem Samstagnachmittag im Hausflur des Atelier Hoffmann gestanden. »Als kleiner Bub, der noch nicht lesen konnte, dem aber wie allen Kindern Bilder gut gefielen […] habe ich willig ein Paket Naziflugschriften unter den Arm genommen, bin damit die Schellingstraße entlangmarschiert und habe die Propagandazettel verteilt.« Eine alte Kundin der Metzgerei informiert den Vater. Der schickt Maria aus, ihren Bruder zu holen. Zu Hause gibt ihm der Vater eine »gewaltige Maulschelle«.
Sobald die Nazis zu Geld gekommen sind, fährt die Parteiprominenz im Maybach und im Mercedes in der Schellingstraße vor. Hitler ist Vegetarier und lässt sich nicht beim Fleischer blicken. Aber Himmler parkt oft direkt vor der Metzgerei und holt sich im Laden frische Leberwurst. Dabei belässt er es nicht beim Einkauf. Immer wieder bedrängt er den Metzgermeister Strauß, doch der Partei beizutreten. Wenn sie an die Macht käme – wovon Himmler ausgeht –, dann könne Strauß fest damit rechnen, die Reichswehr beliefern zu dürfen. Für einen Handwerksmeister, der in der Inflation seine Ersparnisse verloren hat, eine verlockende Aussicht.
Der Vater ist nicht nur Gründungsmitglied der Bayerischen Volkspartei und militanter Katholik, der die »Preißn« ablehnt, sondern er engagiert sich auch bei der Einwohnerwehr. Das bedeutet, dass er mit seinen politischen Ansichten teilweise gar nicht so weit entfernt ist von seinem Nachbarn Hoffmann, der ebenfalls in diesem rechtslastigen Verband organisiert ist. Beide verbindet eine tiefe Abneigung gegen die Kommunisten, ohne dass überliefert ist, ob sie sich darin gegenseitig bestärken oder austauschen. Vermutlich verkehren sie dafür in zu unterschiedlichen Kreisen. Hoffmann geht lieber ins Café Größenwahn als in die Kirche.
Zunächst ist der Vater sich jedenfalls nicht sicher, was er von den neuen Nachbarn, den Nazis, halten soll. Hitler habe zwar »recht eigenartige Ideen«, findet Strauß sen. Er sei gegen den Versailler Vertrag und für eine bessere Behandlung der Deutschen. Daraus folgert der Vater, dass »vielleicht doch etwas an ihm dran sei«, wie Strauß schreibt. Doch im Laufe der Zeit kommt Franz Josef Strauß sen. zu der Überzeugung, dass die Nazis nichts taugen. Er wolle lieber auf der Straße verhungern, als sich für die Nazis zu engagieren, sagt er seinen Kindern. Die Unklarheit über Hitler dauert nur kurz, wie Strauß schreibt. »Dann kam die nächste Phase, in der mein Vater endgültig den Stab über Hitler brach.« Hitler sei »Judenfeind« und »Kirchenfeind«. Was er über die Juden sage, dürfe kein Katholik mitmachen. »Von da an war Hitler für meinen Vater nur noch der Verderber und Zerstörer, der Dämon.« Beim Namen Hitler macht der Vater das Kreuzzeichen. »Bereits nach der Niederschlagung des Hitlerputsches vom 9. November 1923 wurde Hitler zum Inbegriff des politischen Hasses meiner Eltern«, erinnert sich Strauß.
Ungefähr im Jahr 1925 kommt der Vater wütend von einer Versammlung der Bayerischen Volkspartei nach Hause. Der damalige Bayerische Ministerpräsident Heinrich Held berichtet seinen Parteifreunden laut Strauß, dass er Hitler getroffen habe und dass der seine Fehler einsehe und künftig nur mehr legal arbeiten wolle. Hitler wollte die Wiederzulassung seiner Partei erreichen, und Held wollte seinen Anhängern erklären, warum das bayerische Kabinett zugestimmt habe. Doch Franz Josef Strauß sen. versteht seine Partei nicht. Er gerät »in hellen Zorn«. Für den obrigkeitsgläubigen Mann ein ungewöhnlich deutlicher Gefühlsausbruch.
Als guter Katholik geht Strauß am Katholikentag 1922 zu den beiden Hauptreden und erzählt seinem Sohn später immer wieder davon. Besonders beeindruckt ihn, als am Schlusstag der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer spricht. Adenauer ist Präsident des Katholikentages. Drei Tage zuvor hat der Münchner Erzbischof, Kardinal Michael Faulhaber, kritisiert, die Weimarer Republik sei nur durch Hochverrat zustande gekommen. Adenauer sagt nur, nicht Hochverrat habe diesen Staat geschaffen, sondern der alte Staat habe sich überlebt. Faulhaber reagiert erstaunt und zornig, packt seinen Kardinalshut und will gehen, wie Strauß seinem Sohn schildert. Plötzlich unterbricht Adenauer seine Rede und bittet den Kardinal um seinen Segen. Voller Wut habe Faulhaber seinen Segen gegeben. Strauß bewundert, wie geschickt Adenauer einen Eklat vermeidet. Den Namen Adenauer hört Strauß an diesem Tag zum ersten Mal, während Kardinal Faulhaber sogar den Kindern vertraut ist. Die Kirche spielt im Leben der Familie Strauß schließlich eine wichtige Rolle. Daher ist es auch nur folgerichtig, dass der Sohn Franz Ministrant werden soll. In der Familie ist das nichts Besonderes, und es ist der ausdrückliche Wunsch der Eltern. Dabei ahnen sie nicht, dass ihr Sohn so den ersten Schritt weg von dem Lebensweg macht, den sie sich für ihn vorstellen. Die Eltern hoffen natürlich, dass Franz einmal den Laden übernehmen und als Metzger für sie sorgen wird. Doch als er 1921 in die Amalienschule kommt, zeigt sich bald, dass Franz gerne lernt und schnell begreift. Bald ist er unterfordert. Einige Lehrer klagen, dass er nicht mehr aufpasse und nur noch spiele. Sie legen den Eltern nahe, das Kind zu fördern und es auf eine weitergehende Schule zu schicken. So kommt Franz am 1. Mai 1926 in die Gisela-Realschule. Am Ende des ersten Jahres loben die Lehrer seine guten und sehr guten Leistungen. Nur im Singen gehört er nicht zu den Guten.
Während der ersten Schuljahre besucht der Junge an einem Samstag die Abendandacht in der Ludwigskirche. Zu Hause fragt Franz seinen Vater, warum heute so viele Leute beim Beichten waren. »Weil morgen der letzte Sonntag für die Osterbeichte ist«, sagt er. »Warum seid ihr dann schon vor sechs Wochen gegangen?«, will der Sohn wissen. »Weil am letzten Sonntag nur noch die Pferdediebe beichten«, lautet die Antwort des Vaters. Pferdediebe? Der Junge bohrt weiter: »Was man gestohlen hat, muß man doch zurückgeben, hast du einmal gesagt. Du, wie machen die das denn mit den Pferden?«
Auch darauf ist der Vater nicht um eine Antwort verlegen: »Ja, die binden sie alle hinter der Kirche an die Bäume, du brauchst morgen früh bloß in den Kreuzgarten gehen, da kannst du die schönsten Pferde sehen.« Pferdediebe im Kreuzgarten, in der damals die Ludwigskirche umgebenden Grünanlage? Das muss interessant sein, wenn es da hinten von Pferden nur so wimmelt. Am nächsten Tag macht sich der Junge schon lange vor der Schulmesse, die um 8.45 Uhr beginnt, auf den Weg dorthin. Sogar an Zuckerstückchen hat er gedacht, um die Pferde der Diebe füttern zu können. An der angegebenen Stelle kann Franz allerdings kein einziges Pferd entdecken, obwohl doch so viele Diebe beichten waren. Traurig geht er nach Hause. »Nicht ein einziges Pferd war im Kreuzgarten«, berichtet er seinem Vater. Um seine Enttäuschung etwas zu mildern, verspeist er den Zucker selber.
In dieser Zeit fällt der Ministrant Strauß einem Pfarrer auf. Dr. Johannes Zellinger registriert, dass der Junge die lateinischen Texte nicht herunterleiert, sondern ihrem Sinn entsprechend betont. Überrascht hört Zellinger, dass sich der Neunjährige im Selbststudium lateinische Vokabeln beibringt. Dafür hat er sich angeblich von seinem eigenen Taschengeld ein Lehrbuch gekauft. Zellinger, der als Professor an der Universität lehrt, ist beeindruckt und beschließt, ihn zu fördern. Er unterrichtet ihn in Latein und drängt die Eltern, den Sohn auf ein Gymnasium zu schicken. An Ostern 1927 kommt der Junge im Alter von elf Jahren schließlich auf das humanistische Max-Gymnasium, wo er gleich eine Klasse überspringt. Er beginnt in Klasse za – ist allerdings dennoch ein Jahr älter als seine Mitschüler. Bald gehört er wieder zu den Besten. Lernen macht ihm offenbar Spaß.
Neben Latein lernt er nun auch Griechisch, und die Melodie dieser Sprache fasziniert ihn. Das Gymnasium ist für ihn ein Tor in eine andere Welt, mit der seine Eltern nichts anzufangen wissen. Zu Hause liest man Frommes und Erbauliches, Märchen und christliche Heldensagen, und spricht darüber. Nun liest er die Griechische Geschichte in zwei Bänden und die Geschichte Alexanders des Großen, später auch Romane, Schillers Don Carlos und Goethes Werther und Faust: Darüber wird zu Hause nie gesprochen.
Diese andere Welt habe ihn nicht von den Eltern entfremdet, schreibt Strauß später. Aber man darf annehmen, dass genau dies zu einem gewissen Grad der Fall ist. Es sind nicht nur Namen und Themen, mit denen die Eltern nichts anzufangen wissen. Während die Eltern monarchistisch, erzkatholisch und antipreußisch eingestellt sind, lehren am humanistischen Max-Gymnasium auch linksorientierte Lehrer. Die Schule gilt als liberal, nicht klerikal.
Gemeinsam mit dem neuen Schüler kommt ein Mädchen in die reine Jungenklasse. Leonore von Tucher stammt wie viele der Mitschüler aus einer wohlhabenden Familie, einer alteingesessenen Nürnberger Patrizierfamilie. Damit sie die Jungenklasse besuchen darf, muss ihr Vater, ein ehemaliger bayerischer Diplomat, eigens eine Genehmigung beantragen. Strauß und Tucher werden schnell integriert. Niemand nennt den Jungen Franz Josef. Eingetragen ist er als Franz, gerufen wird er beim Nachnamen. Die Mitschüler sprechen ihn einfach mit »du, Strauß« an. Aber recht schnell erhalten die beiden Neuen Spitznamen. Sie wird »die Turi«, er »der Struso«. Strauß nimmt bald wieder die vertraute Rolle des Vorzeigeschülers ein. Doch »Strauß ist nie aufgefallen«, sagt von Tucher. »Bei uns war keiner besonders schlecht oder besonders gut aufgenommen.«
Trotz guter Leistungen wird er nicht als Streber geschmäht, sondern zählt zu den beliebtesten Schülern. Er lässt nämlich seine Mitschüler anfangs Hausaufgaben abschreiben. Montags vor der ersten Stunde gibt er die Übersetzungen des Lateinischen und Griechischen an seine Mitschüler weiter. Zudem gibt er ihnen Nachhilfe, um sein Schulgeld zu verdienen. Seine Lehrer unterstützen ihn dabei und weisen ihm schwache Schüler zu, denn rasch spricht sich der Ruf des Ausnahmeschülers in der ganzen Schule herum. Er gilt als hilfsbereit und hat den Lernstoff immer parat. Auch im deutschen Aufsatz ist er meist der Beste.
In der fünften oder sechsten Klasse Gymnasium (also der neunten oder zehnten Klasse nach heutiger Zählweise) lässt ein Lehrer aus Versehen die Lateinarbeit für den nächsten Tag im Pult liegen. Ein Schüler findet sie. Daraufhin treffen sich alle Klassenkameraden in einem nahen Park, wo Strauß den Text übersetzt. Gemeinsam einigt man sich, dass die schwächeren Schüler absichtlich Fehler machen sollen, damit die guten Leistungen glaubwürdig bleiben. Erstaunt registriert der Lehrer die vielen guten Noten. Strauß macht also durchaus mit, wenn die Mitschüler Streiche planen. Einmal erhält er einen Verweis, einmal nach einem Museumsbesuch eine Stunde Arrest – weshalb, ist unklar.
Die Inflation in den zwanziger Jahren macht dem Metzger Strauß arg zu schaffen. Wenn der Vater morgens ein Kalb verkauft, bekommt er am Abend nur noch ein Huhn dafür. Franz Josef Strauß sen. ist froh, dass sein Sohn einen ordentlichen Teil des Schulgelds selbst verdient. Ebenso froh ist er, als seine Tochter Maria zu arbeiten beginnt. Ein Unternehmen wählt sie unter 102 Bewerbern aus. In den ersten Jahren gibt sie ihren Lohn dem Vater, der seinen Metzgerladen nur deshalb halten kann. Sie steigt schnell auf in ihrer Firma. »Turi« hat jedenfalls großen Respekt vor Maria, als »Struso« nebenbei erzählt, seine Schwester sei nun Prokuristin geworden – für eine Frau damals eine ungewöhnliche Position.