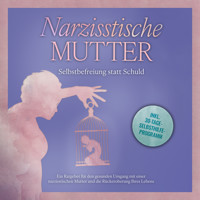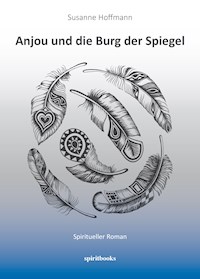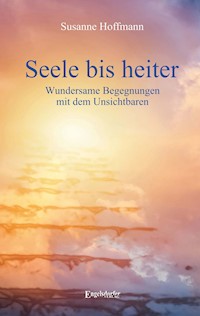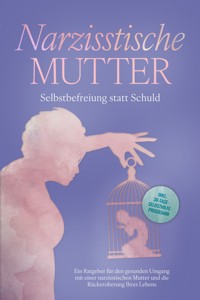
Narzisstische Mutter: Selbstbefreiung statt Schuld - Ein Ratgeber für den gesunden Umgang mit einer narzisstischen Mutter und die Rückeroberung Ihres Lebens - inkl. 30-Tage-Selbsthilfeprogramm E-Book
Susanne Hoffmann
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ONIX Media
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Manipulation, Kontrolle, Empathiemangel oder Machtspiele: Wer mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen ist, kennt all das nur zu gut aus seiner Kindheit. Auch auf Erwachsenen lastet diese Vergangenheit oft noch schwer – und wenn Sie sich aus diesen Fesseln befreien wollen, finden Sie in diesem Buch einen Weg! Mütter lieben ihre Kinder bedingungslos und wollen nur das Beste für sie: Das ist die gesellschaftliche Vorstellung von Müttern – doch es gibt auch solche, die das nicht erfüllen können. Zum Beispiel, weil sie von der psychischen Störung des Narzissmus betroffen sind, worunter ihre Kinder oft ein Leben lang leiden. Wie Sie als solches Kind die Schatten der Vergangenheit abschütteln und zu einem befreiten Leben finden, erfahren Sie in diesem Ratgeber. Zunächst machen Sie sich mit der Störung des Narzissmus vertraut und erfahren sachlich, wissenschaftlich fundiert und neutral, welche Auswirkungen sie auf den Nachwuchs von Betroffenen haben kann. Anschließend richten Sie den Blick nach vorne: Mit zahlreichen Strategien, Alltagsübungen und Praxismaßnahmen lösen Sie sich aus dem Griff der Vergangenheit und bauen Schritt für Schritt eine stabile Persönlichkeit, ein gesundes Selbstbewusstsein und ein unabhängiges Leben auf. Ohne Therapeut? Keine Sorge! Auch die Möglichkeiten professioneller Unterstützung werden thematisiert, doch die vielfältigen Ansätze in diesem Buch sind gezielt so konzipiert, dass Sie selbstbestimmt und in Eigenregie aktiv an Ihrer Entwicklung arbeiten können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags für jegliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2024 www.edition-jt.de
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Fragen und Anregungen:
Auflage 2024
Inhalt
Verständnis narzisstischer Mütter
Charakteristika einer narzisstischen Mutter
Wie Narzissmus die Mutter-Kind-Beziehung beeinflusst
Auswirkungen auf die Entwicklung und das Selbstwertgefühl der Kinder
Die Auswirkungen auf erwachsene Kinder
Das Erwachsenenalter: Fortdauernde Dynamiken und Herausforderungen
Identitätskrisen und Selbstzweifel
Beziehungsprobleme und Schwierigkeiten im sozialen Leben
Der Weg zur Selbstbefreiung
Erkennen des Problems: Den eigenen Standpunkt verstehen
Loslassen von Schuldgefühlen und Verantwortung
Gesunde Grenzen setzen
Die Bedeutung von Therapie und professioneller Hilfe
Möglichkeiten der Unterstützung durch Therapie und Beratung
Strategien für den Umgang mit einer narzisstischen Mutter
Kommunikationsstrategien für schwierige Situationen
Sich von manipulativem Verhalten distanzieren
Schutzmechanismen für das eigene Wohlbefinden
Den eigenen Weg finden – Selbstvertrauen, Liebe und Sicherheit manifestieren
Stärkung des Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins
Entdeckung eigener Stärken und Leidenschaften
Tägliche Rituale und Affirmationen
Beziehungen, die das persönliche Wachstum fördern
Sich abgrenzen: Du bist nicht sie!
Klarheit über eigene Bedürfnisse und Grenzen schaffen: Identifizierung persönlicher Grenzen und Prioritäten
Kommunikationsstrategien für gesunde Beziehungen: Direktheit, Ehrlichkeit und Respekt
Umgang mit Schuldgefühlen und Manipulationstaktiken: Stärkung des Selbstbewusstseins in Bezug auf die eigenen Entscheidungen
Praktische Methoden zur Durchsetzung von Grenzen: Nein sagen, Distanz wahren und Selbstbehauptungstraining
Bonus: Das 30-Tage-Selbsthilfeprogramm
Tag 1–5: Reflexion und Selbstakzeptanz
Tag 6–10: Umgang mit emotionalen Belastungen und Traumata
Tag 11–15: Grenzen setzen und Kommunikationsstrategienentwickeln
Tag 16–20: Aufbau eines Unterstützernetzwerks
Tag 21–25: Selbstfürsorge und Selbstentwicklung
Tag 26–30: Zukunftsplanungen und Ausblick
Literaturverzeichnis
Verständnis narzisstischer Mütter
„Es gibt keine Freiheit ohne gegenseitiges Verständnis.“
(Albert Camus)
Das Verhältnis von Mutter und Kind ist im Idealfall von Liebe und Vertrauen geprägt. Für viele ist die Mutter, auch im Erwachsenenalter, eine wichtige Bezugsperson, Ansprechpartnerin, Beraterin und vieles mehr. Dementsprechend positiv besetzt, fast schon idealisiert, ist das Bild der Mutter in unserer Gesellschaft. Dabei wird übersehen, dass auch Mütter bloß Menschen sind, die, wie alle anderen Menschen, Fehler machen können, bisweilen überfordert und gereizt sind oder mit physischer und/oder psychischer Belastung zu kämpfen haben. Um letzteren Fall soll es in diesem Ratgeber gehen. Es ist wichtig, zu verstehen, dass der Begriff „narzisstische Mutter“ nicht abwertend gemeint ist; die Aussage dahinter lautet nicht etwa: „Eine narzisstische Mutter ist ein schlechter Mensch.“ Es handelt sich beim Narzissmus um eine feststellbare Erkrankung der Psyche, die häufig wie folgt beschrieben wird:
Narzissmus ist eine Erkrankung der Psyche, bei der betroffene Personen die eigenen Fähigkeiten überschätzen und daher ein beinahe zwanghaftes Bedürfnis haben, sich zu präsentieren. Ein übersteigertes Bedürfnis nach Anerkennung geht damit einher. Auf der anderen Seite fehlt es narzisstischen Persönlichkeiten an Empathie und Einfühlungsvermögen. Der Narzisst will anderen imponieren, ist selbst aber nicht (oder nur sehr begrenzt) in der Lage, menschliche Wärme an andere zurückzugeben.
Anstatt mit narzisstischen Müttern könnte sich der Ratgeber also genauso gut mit depressiven, schizophrenen oder in sonstiger Form psychisch kranken Müttern auseinandersetzen. Das Tückische ist jedoch, dass Narzissmus häufig weniger offensichtlich ist als die anderen genannten Krankheitsbilder. Narzissten sind durchaus in der Lage, am Alltag teilzunehmen und sich gegebenenfalls sogar als besonders höflich und freundlich zu präsentieren, schließlich ist der Drang nach Anerkennung in hohem Maße vorhanden. Viele Erwachsene erkennen daher unter Umständen erst spät, dass sie es mit einer narzisstischen Mutter zu tun hatten und immer noch haben. Die Auswirkungen auf das Kind und später den Erwachsenen können also gravierend sein, obwohl dieser jahrelang nicht gemerkt hat, dass seine Mutter ihn mithilfe verschiedener Techniken manipuliert und beeinflusst. Dies kann zu einer erheblichen mentalen Belastung führen.
Ziel dieses Ratgebers ist es, Ihre mentale Belastung zu reduzieren und die seelischen Wunden, die Ihre narzisstische Mutter bei Ihnen hinterlassen hat, zu heilen. Um diesen gewichtigen Schritt zu gehen, muss jedoch zunächst ein anderer Schritt gegangen werden: Sie müssen verstehen, was es bedeutet, eine narzisstische Mutter zu haben. Was sind die Merkmale einer narzisstischen Mutter und inwiefern beeinflusst Sie die Eltern-Kind-Beziehung? Welche seelischen Verletzungen können entstehen und auch im Erwachsenenalter noch fortbestehen? All diese Fragen sollen zunächst in diesem Kapitel beantwortet werden, bevor Sie den Prozess der Heilung durchlaufen wollen.
Hinweis: In diesem Buch finden Sie einen QR-Code, der Sie zu einer Audiodatei führt. Falls Sie keine Möglichkeit haben, den QR-Code zu scannen, können Sie die Datei auch über diesen Link finden: https://bit.ly/47rns0v
Charakteristika einer narzisstischen Mutter
In der Literatur werden häufig drei große Charakteristika genannt, die eine narzisstische Mutter ausmachen. Jede dieser Charaktereigenschaften kann dabei individuelle Ausprägungen annehmen, es muss also nicht zwangsläufig bei allen narzisstischen Müttern jede Eigenschaft in gleicher Form und gleicher Stärke vorhanden sein. Dennoch können Sie anhand der drei folgenden Eigenschaften in der Regel gut erkennen, ob Sie es mit einer narzisstischen Mutter zu tun haben oder nicht (Donaldson-Pressman & Pressman, 1997).
Selbstzentriertheit und fehlende Empathie
Eine narzisstische Mutter zeichnet sich durch eine ausgeprägte Selbstzufriedenheit und einen Mangel an Empathie aus. Dieses Verhalten manifestiert sich auf verschiedene Weisen, die das Leben der Kinder erheblich beeinflussen können.
Selbstzufriedenheit bei einer narzisstischen Mutter bedeutet, dass sie sich selbst stets im besten Licht sieht. Sie hält sich für überdurchschnittlich attraktiv, intelligent und kompetent – unabhängig von der Realität. Diese Selbstwahrnehmung führt dazu, dass sie jegliche Kritik abwehrt und jede Anerkennung für ihre Leistungen als selbstverständlich betrachtet. Diese übertriebene Selbstwahrnehmung kann dazu führen, dass sie wenig bis kein Verständnis für die Bedürfnisse und Gefühle ihrer Kinder zeigt.
Fehlende Empathie ist ein weiteres Kernmerkmal. Eine narzisstische Mutter hat Schwierigkeiten, die Gefühle und Perspektiven ihrer Kinder nachzuvollziehen. Sie ist nicht in der Lage, Mitgefühl zu zeigen oder auf die emotionalen Bedürfnisse ihrer Kinder einzugehen. Stattdessen erwartet sie, dass sich die Kinder ihren Bedürfnissen und Wünschen unterordnen. Diese Empathielosigkeit ist für Kinder nur schwer zu begreifen, sie verstehen die Ursache nicht und suchen den Fehler häufig bei sich; in der Konsequenz fühlen die Kinder sich vernachlässigt und emotional unbeachtet.
Beispiel:
Ein geeignetes Beispiel zur Veranschaulichung dieser Dynamik ist eine Mutter, die sich mehr um ihr eigenes Wohl kümmert als um das ihrer Kinder: Stellen Sie sich vor, das Kind bringt beispielsweise eine schlechte Schulnote nach Hause. Die narzisstische Mutter wird diese schlechte Zensur in erster Linie als persönliche Kränkung auffassen („Wie kann mein Kind mir nur so etwas antun – ein Versager in der Schule zu sein?“) und das Kind dafür scharf tadeln, anstatt zu verstehen, warum das Kind Probleme in der Schule hat. Eine empathische Mutter würde versuchen, gemeinsam mit dem Kind nach den Ursachen und einer potenziellen Lösung zu suchen: „Hast du nicht genügend gelernt, hast du im Unterricht nicht verstanden, worum es geht, hattest du einen Blackout?“ Die narzisstische Mutter hingegen wird das Kind beschuldigen, ihr Ansehen zu beschädigen („Wie stehe ich denn da?“), anstatt zu helfen, die Ursache der Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Eine weitere Auswirkung der fehlenden Empathie ist die emotionale Erpressung. Narzisstische Mütter neigen dazu, die Gefühle ihrer Kinder zu manipulieren, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.
Beispiel:
Die narzisstische Mutter erzeugt bewusst und willentlich Schuldgefühle beim Kind, um dessen Verhalten zu kontrollieren. Sie sagt beispielsweise: „Nach allem, was ich für dich getan habe, bist du undankbar und enttäuschst mich immer wieder.“ Diese Art der Manipulation untergräbt das Selbstwertgefühl des Kindes und führt dazu, dass es ständig versucht, die Mutter zufriedenzustellen, oft auf Kosten der eigenen Bedürfnisse und Wünsche.
Insgesamt führen die Selbstzentriertheit sowie die fehlende Empathie bei einer narzisstischen Mutter dazu, dass die Kinder in einem emotional unsicheren, unsteten Umfeld aufwachsen. Sie lernen, ihre eigenen Gefühle zu unterdrücken und sich an die ständigen Forderungen und Bedürfnisse der Mutter anzupassen. Dies wiederum hat langfristige emotionale und psychische Probleme zur Folge, da die Kinder in ihrer Entwicklung (und später auch im Erwachsenenleben) oft Schwierigkeiten haben, gesunde Beziehungen zu entwickeln und ein stabiles Selbstwertgefühl aufzubauen. Über diese Aspekte wird in Kürze noch einmal ausführlich zu sprechen sein.
Kontrollbedürfnis und Manipulationsstrategien
Narzisstische Mütter haben ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle und setzen vielfältige Manipulationsstrategien ein, um ihre Umgebung zu dominieren. Diese Verhaltensweisen beeinflussen nicht nur das tägliche Leben der Kinder, sondern auch ihre langfristige Entwicklung und ihr Selbstbewusstsein, schließlich lernen sie früh, dass sie sich tendenziell eher unterordnen sollen, sie entwickeln kein gesundes Selbstbewusstsein, das sich im Idealfall im Zuge der sekundären Sozialisation auch mit dem Widerspruch gegen die Eltern herausbildet (Miller, 1981).
Das Kontrollbedürfnis einer narzisstischen Mutter zeigt sich besonders deutlich in ihrem Wunsch, jede Entscheidung und Handlung ihrer Kinder zu überwachen und zu steuern. Sie möchte sicherstellen, dass das Leben und die Handlungen des Kindes nach ihrer Vorstellung verlaufen. Dies beginnt oft schon in der frühen Kindheit und setzt sich bis ins Erwachsenenalter fort, denn narzisstische Mütter haben Schwierigkeiten damit, loszulassen, selbst wenn die Kinder bereits aus der Adoleszenz-Phase herausgewachsen sind. Eine narzisstische Mutter will beispielsweise häufig bestimmen, welche Freunde ihre Kinder haben dürfen, dabei spielen die eigene Reputation und das eigene Selbstbild der Mutter wiederum eine große Rolle: „Mein Kind spielt nicht mit solchen Kindern, gibt sich nicht mit solchen Kindern ab.“ Auch welche Hobbys die Kinder ausüben (erwünscht wäre z. B. das Erlernen eines Instruments, auch wenn das Kind kein Interesse daran hat) und sogar welche Berufslaufbahn (es soll ein Beruf gefunden werden, den die Mutter als angemessen für ihre Reputation erachtet) sie einschlagen sollen, soll im Kontrollbereich der narzisstischen Mutter liegen. Diese extreme Form der Kontrolle führt dazu, dass die Kinder wenig Raum für eigene Entscheidungen und Entwicklungen haben. Ein Kind, das in seiner Entscheidungsfindung derart beschränkt wird, wird vermutlich zu einem Erwachsenen, der schlecht Entscheidungen für sich selbst treffen kann, schließlich lernen Kinder die Übernahme von Verantwortung für eigene Entscheidungen exakt in dieser Phase.
Manipulationsstrategien sind demnach ein weiteres wesentliches Merkmal. Eine narzisstische Mutter setzt verschiedene Techniken ein, um ihre Kinder zu manipulieren und zu kontrollieren. Das Erzeugen von Schuldgefühlen, das Sie soeben kennengelernt haben, ist ein „Klassiker“ der emotionalen Manipulation, ebenso das sogenannte Gaslighting. Gaslighting(Little, 2016) ist eine häufig verwendete Methode, bei der die Mutter versucht, die Wahrnehmung und das Selbstbewusstsein des Kindes zu untergraben, indem sie dessen Erinnerungen und Gefühle infrage stellt.
Beispiel:
Ein Beispiel wäre, wenn das Kind sich an eine Verletzung oder Kränkung erinnert und die Mutter darauf mit „Das ist nie passiert, du bildest dir das nur ein“ oder „Wie kannst du mir so etwas unterstellen? Ich bin deine Mutter und würde dir so etwas nie antun“ antwortet. Diese Taktik führt dazu, dass das Kind an seiner eigenen Wahrnehmung und Realität zweifelt.
Ein weiteres Manipulationswerkzeug ist die explizite Schuldzuweisung. Narzisstische Mütter neigen dazu, ihre eigenen Fehler und Misserfolge auf ihre Kinder abzuwälzen: „Wenn du nicht so schwierig wärst, wäre unser Leben viel einfacher“ oder „Andere Kinder machen solche Probleme auch nicht, immer habe ich nur Ärger mit dir.“ Diese ständigen Schuldzuweisungen der Mutter erzeugen ein Gefühl der Unzulänglichkeit und Belastung beim Kind, das stets mit dem Gefühl lebt, nicht gut genug zu sein und für die Probleme der Mutter verantwortlich zu sein („Ich bin schuld daran, dass es meinen Eltern schlecht geht“). Dass die Übernahme einer derartigen Schuld für ein Kind emotional belastend und überfordernd ist, liegt auf der Hand.
Emotionale Erpressung ist eine ebenso häufig angewandte Methode. Eine narzisstische Mutter setzt ihre Zuneigung und Liebe häufig bewusst als Mittel ein, um das Verhalten ihrer Kinder zu steuern. Sie wird den Kindern beispielsweise ihre Zuneigung entziehen, wenn sie nicht ihren Erwartungen entsprechen, und im Gegenzug übermäßige Zuwendung zeigen, wenn die Kinder ihren Wünschen nachkommen. Diese unvorhersehbare und bedingte Zuneigung führt dazu, dass die Kinder in ständiger Unsicherheit leben und alles tun, um die Gunst der Mutter zu gewinnen. Sie erhalten das Gefühl, dass Liebe etwas ist, das man sich erarbeiten muss, bedingungslose Liebe, wie sie in einer Mutter-Kind-Beziehung eigentlich vorhanden sein sollte, ist hier nicht gegeben.
Auswirkungen
Die langfristigen Auswirkungen dieser Manipulationsstrategien sind erheblich. Kinder narzisstischer Mütter entwickeln oft einen messbaren Mangel an Selbstwertgefühl / Selbstbewusstsein und Schwierigkeiten, gesunde soziale Bindungen aufzubauen, da sie durch die narzisstische Mutter sozialisiert worden sind. Sie haben gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken und sich an die manipulativen und kontrollierenden Verhaltensweisen der Mutter anzupassen. Dies kann zu einem Leben voller Angst, Unsicherheit und emotionaler Abhängigkeit führen. Kinder narzisstischer Mütter neigen dazu, toxische Paarbeziehungen einzugehen, die ihnen selbst eher schaden als nützen.
Zudem ist die Prägung ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung und Herausbildung einer eigenständigen Persönlichkeit. Wenn Sie von einer narzisstischen Mutter geprägt wurden, haben Sie eine solche Beziehungsstruktur aufgesogen und verinnerlicht, auch wenn sie toxisch und ungesund ist. Es zeigt sich, dass Kinder narzisstischer Mütter bei der Suche nach einer Partnerin oder einem Partner häufig selbst an Menschen mit narzisstischen Zügen geraten. Intuitiv suchen sie das Vertraute, das Bekannte, und merken wiederum zu spät, dass sie sich in eine erneute narzisstische Beziehungskonstellation begeben haben. Weniger häufig, aber dennoch beobachtbar ist das Phänomen, dass Kinder narzisstischer Mütter selbst narzisstische Strukturen in ihrer Persönlichkeit herausbilden. Werden sie zu Hause von der Mutter manipuliert und emotional unterdrückt, versuchen sie, dies mit anderen Menschen aus ihrem Umfeld selbst zu tun, sozusagen als Kompensation eigener Mangelerfahrungen. Auch diese Konstellation kann sich für eine Beziehung als äußerst ungesund erweisen.
Tendenzen zum Perfektionismus und Überlegenheitsgedanken
Narzisstische Mütter neigen zu starkem Perfektionismus und Überlegenheitsgedanken, die das Leben ihrer Kinder stark beeinflussen. Diese Tendenzen führen oft zu unerreichbaren Standards und einem ständigen Gefühl der Unzulänglichkeit bei den Kindern.
Perfektionismus
bei einer narzisstischen Mutter bedeutet, dass sie extrem hohe Erwartungen an sich selbst und ihre Kinder hat. Sie glaubt, dass alles perfekt sein muss – sei es das Aussehen, die Leistungen in der Schule oder das Verhalten in der Öffentlichkeit. Diese Erwartungen sind oft unrealistisch und unerreichbar. Eine narzisstische Mutter besteht beispielsweise darauf, dass ihr Kind immer die besten Noten hat, in allen außerschulischen Aktivitäten glänzt und in jeder sozialen Situation makellos auftritt. Diese ständigen Anforderungen können dazu führen, dass das Kind unter enormem Druck steht und Angst vor dem Versagen entwickelt. Die natürliche Entwicklung des Kindes, die auch durch das Erkennen und Reflektieren eigener Fehler vorangebracht wird, kann dadurch ausgebremst werden.
Überlegenheitsgedanken
sind ein weiteres Merkmal narzisstischer Mütter. Sie sind überzeugt, dass sie und ihre Familie anderen überlegen sind. Diese Überzeugung manifestiert sich oft in einem herablassenden Verhalten gegenüber anderen und einem ständigen Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung. Eine narzisstische Mutter versucht durch ihr Auftreten und ihren Habitus, anderen Menschen gegenüber zu signalisieren, dass ihre Familie besser ist als andere, und weigert sich beharrlich, mit Menschen zu interagieren, die sie als „unterlegen“ betrachtet. Dieses Verhalten fördert eine Atmosphäre der Überheblichkeit und Isolation, in der das Kind lernt, andere zu verurteilen und sich ständig beweisen zu müssen. Ein derartiges Wettbewerbsdenken sollte im Kindesalter keinesfalls implementiert werden und kann daher schädlich für eine sorgenfreie und zugewandte kindliche Entwicklung sein.
Die Kombination aus Perfektionismus und Überlegenheitsgedanken hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und die psychische Gesundheit der Kinder. Sie lernen, dass ihre eigene Wertschätzung und die Liebe der Mutter bedingt sind – abhängig davon, ob sie den hohen Standards entsprechen und die Überlegenheit der Familie repräsentieren. Dieses ständige Streben nach Perfektion kann zu einem starken inneren Kritiker führen, der das Kind sein Leben lang begleitet. Sie fühlen sich niemals gut genug, egal, wie viel sie erreichen, und entwickeln oft ein tiefes Gefühl der Scham und Unzulänglichkeit.
Beispiel:
Ein Beispiel hierfür könnte eine Mutter sein, die von ihrem Sohn verlangt, in allen schulischen und außerschulischen Aktivitäten der Beste zu sein. Wenn der Sohn diese Erwartungen nicht erfüllt, wird er hierfür harsch kritisiert oder ignoriert („mit Verachtung gestraft“). Auf der anderen Seite wird er im Anschluss an einen erzielten Erfolg überschwänglich gelobt werden, jedoch immer mit dem Zusatz, dass noch ein kleines bisschen mehr erwartet wird, dass man sich auf dem Erreichten nicht ausruhen dürfe. Diese bedingte Liebe und Anerkennung führen dazu, dass das Kind ständig nach der Bestätigung der Mutter strebt, aber niemals das Gefühl hat, gut genug zu sein.
Zu allem Überfluss führt diese Dynamik zu sozialen Schwierigkeiten nicht nur im Mutter-Kind-Verhältnis, sondern auch im Verhältnis des Kindes zu anderen Kindern, später auch zu anderen Erwachsenen. Kinder narzisstischer Mütter haben überdurchschnittlich häufig Schwierigkeiten, gesunde Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen (Golomb, 1995). Sie projizieren die gleichen hohen Standards und Überlegenheitsgedanken auf andere, wie die eigene Mutter auf sie selbst, und isolieren sich damit selbst von sozialen Gruppen, was Einsamkeit und mangelndes Zugehörigkeitsgefühl zur Konsequenz hat. Sie haben gelernt, dass Liebe und Anerkennung an Leistung und Perfektion gebunden sind, was es ihnen schwer macht, authentische und bedingungslose Beziehungen zu pflegen.
Zusammengefasst schaffen die Tendenzen zum Perfektionismus und die Überlegenheitsgedanken einer narzisstischen Mutter eine toxische Umgebung, in der Kinder ständig unter Druck stehen und sich niemals genug fühlen. Diese Erfahrungen hinterlassen tiefe Spuren und beeinflussen ihre gesamte Lebensweise, ihr Selbstwertgefühl und ihre Fähigkeit, gesunde und liebevolle Beziehungen zu führen.
Wie Narzissmus die Mutter-Kind-Beziehung beeinflusst
Wir haben bereits gelernt, dass sich das Verhalten einer narzisstischen Mutter massiv auf die Bindung zwischen Mutter und Kind auswirken kann. Bisweilen werden diese Auswirkungen jedoch nur bedingt wahrgenommen bzw. nicht mit dem narzisstischen Verhalten der Mutter in Verbindung gebracht. Unter Umständen beschreiben Sie Ihre Beziehung zur Mutter als „angespannt“ oder „schwierig“, können die tatsächlichen Auswirkungen in ihrem Ausmaß aber nicht wirklich einschätzen. Betrachten wir also, wie sich das Verhalten narzisstischer Mütter auf die Mutter-Kind-Bindung auswirken kann.
Dominanzverhalten und Machtspiele
Narzisstische Mütter nutzen häufig Dominanzverhalten und Machtspiele, um ihre Überlegenheit und Kontrolle über ihre Kinder zu festigen. Diese Dynamik beeinflusst die Mutter-Kind-Beziehung tiefgreifend und schafft ein Umfeld der Unterdrückung und Angst.
Dominanzverhalten zeigt sich darin, dass die Mutter stets die Kontrolle über alle Aspekte des Lebens ihrer Kinder behalten möchte. Sie trifft alle wichtigen Entscheidungen, oft ohne Rücksicht auf die Wünsche oder Bedürfnisse der Kinder. Das beginnt schon im frühen Kindesalter und setzt sich oft bis ins Erwachsenenleben fort. Dieses Verhalten führt dazu, dass die Mutter bei Entscheidungen oftmals präsent ist, auch wenn sie im Entscheidungsprozess keine Rolle spielen sollte, selbst das erwachsene Kind fragt sich: „Was würde meine Mutter wollen?“ Sie kennen vielleicht die berühmte Szene aus dem Film Psycho von Alfred Hitchcock, in der der mysteriöse Hotelbesitzer aus dem Fenster schaut und seine Mutter auf einem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzen sieht. Er spricht leise zu ihr, auch wenn sie meterweit entfernt auf einer Anhöhe sitzt und ihn nicht wahrnimmt, sie hat keinerlei Einfluss auf das Geschehen im Hotel, dennoch scheint sie bei dem Hotelier omnipräsent zu sein.
Hitchcock stellt szenisch dar, wie ein erwachsener, im Grunde eigenständiger Mann noch immer derart eng an die Mutter gebunden ist, dass er sie als eine Art absolute Instanz über sich wahrnimmt und sie indirekt stetig mit im Raum wähnt. Das Gefühl von Allgegenwart und Kontrolle durch die Mutter lässt dem Kind wenig Raum für eigene Entscheidungen und Selbstentfaltung und befeuert ein ungesundes Abhängigkeitsverhältnis (Langosch, 2021).
Machtspiele sind eine weitere Taktik, die narzisstische Mütter anwenden, um ihre Dominanz zu bewahren. Sie setzen verschiedene Strategien ein, um ihre Überlegenheit zu demonstrieren und das Kind in eine unterlegene Position zu bringen. Ein häufiges Machtspiel ist das sogenannte „Triangulieren“, bei dem die Mutter Konflikte zwischen den Geschwistern oder zwischen dem Kind und dem Vater schürt, um ihre eigene Machtposition zu stärken. Dadurch, dass sie Zwietracht sät, lenkt sie die Aufmerksamkeit auf sich und verhindert, dass stabile, unterstützende Beziehungen innerhalb der Familie entstehen. Dies erfolgt meist subtil durch beiläufige Bemerkungen und Kommentare oder sogar unterschwellig durch Verhalten.
Beispiel:
Das Kind fragt, ob es einen Freund zum Übernachten einladen darf. Die Mutter lehnt dies ab, begründet dies jedoch nicht mit eigenen Argumenten, sondern schiebt den Vater vor: „Papa möchte nicht, dass andere Kinder in unserem Haus übernachten.“ Das Kind möchte diskutieren, doch die Mutter würgt die Diskussion ab: „Ich habe kein Problem damit, aber dein Vater ist in dieser Beziehung eindeutig.“ Das Kind ist also sauer auf den Vater, die Mutter spielt sich in die Rolle der Verständigen, später vielleicht sogar der Vermittlerin, behält dabei jedoch die absolute Kontrolle.
Ein weiteres typisches Machtspiel ist die wechselnde Verwendung von Belohnung und Bestrafung. Narzisstische Mütter können in einem Moment übermäßig loben und im nächsten Moment scharf kritisieren.
Beispiel:
Stellen Sie sich vor, das Kind bringt eine 2 in seiner Englisch-Klausur mit nach Hause. Die Mutter lobt das Kind zunächst: „Das ist ja großartig, beim letzten Mal hattest du noch eine 4 – du hast dich stark verbessert.“ Die Mutter ist zufrieden, da eine gute Englisch-Zensur eher dem eigenen Selbstbild und dem Wunsch nach einem hohen Status („Mein Kind gehört zu den Klassenbesten“) entspricht. Im nächsten Moment schaut sie jedoch auf die Fehler, die das Kind gemacht hat, und wird wütend. Da sie über mangelnde Empathie verfügt, kann sie nicht verstehen, wie das Kind immer wieder denselben Fehler machen kann: „Du hast ja 90 Prozent deiner Fehler nur, weil du die „past tenses“ nicht richtig verwenden kannst. Wie kann man denn nur so einen dummen Fehler immer wieder machen? Du hättest eine 1 schreiben können, aber anscheinend bist du total unfähig, aus deinen Fehlern zu lernen.“ Das Kind ist natürlich verunsichert. Ist es nun ein Versager oder ein guter Schüler? Was muss es tun, um die Mutter zufriedenzustellen?
Diese Unberechenbarkeit erzeugt ein Gefühl der Unsicherheit beim Kind, das nie genau weiß, wie es die Zuneigung der Mutter gewinnen kann. Das Kind lebt in ständiger Angst vor der nächsten Bestrafung oder Abwertung, was sein Selbstwertgefühl und seine emotionale Stabilität erheblich beeinträchtigt. In seinem Werk Überwachen und Strafen schildert der französische Soziologe Michel Foucault (1926–1984) die Auswirkungen auf Individuum und Gesellschaft, wenn die Überwachung des Verhaltens und die Strafe bei nicht erwünschtem Verhalten zu einem wesentlichen Bestandteil der sozialen Normierungen werden. Er arbeitet heraus, dass der Zustand des Überwachens und Strafen das Individuum in seiner Entfaltungsmöglichkeit einschränken und – wenn er auf die Spitze getrieben wird – sogar mit der mittelalterlichen Methode der Folter gleichzusetzen sind. Das Gefühl ständiger Überwachung, nicht wissend, wie die Reaktion ausfallen wird, geht also in die Richtung der psychischen Folter (Foucault, 1976).
Die Auswirkungen dieser Dominanz- und Machtspiele sind weitreichend. Kinder narzisstischer Mütter lernen oft, dass ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse irrelevant sind. Sie entwickeln ein starkes Bedürfnis nach Zustimmung und Bestätigung durch die Mutter, weil sie glauben, dass ihre eigene Wertschätzung davon abhängt. Diese ständige Suche nach Anerkennung kann dazu führen, dass das Kind seine eigenen Interessen und seine Identität unterdrückt, um den Erwartungen der Mutter zu entsprechen. Auch später erwartet das Kind ein hohes Maß an Anerkennung, dieses Mal von anderen, seien es Freunde, Kollegen oder die Partnerin / der Partner. Im Mittelpunkt steht der Wunsch, es anderen recht zu machen, und nicht die eigenen Bedürfnisse.
Langfristig führt dieses Verhalten zu einer dysfunktionalen Mutter-Kind-Beziehung, in der das Kind wenig Selbstvertrauen entwickelt und Schwierigkeiten hat, unabhängige Entscheidungen zu treffen. Die Kinder haben gelernt, dass Liebe und Akzeptanz an die bedingungslose Unterordnung unter die Wünsche und Kontrolle der Mutter gebunden sind. Diese Beziehungsmuster setzen sich oft ins Erwachsenenleben fort, wo die Kinder Schwierigkeiten haben, gesunde Grenzen zu setzen und sich selbst zu behaupten.
Auswirkungen auf die emotionale Entwicklung des Kindes
Erkenntnis:
Narzissmus der Mutter hat tiefgreifende Auswirkungen auf die emotionale Entwicklung des Kindes. Diese Beziehung kann das Selbstwertgefühl, die emotionale Reife und die Fähigkeit, gesunde zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, stark beeinträchtigen.
Kinder narzisstischer Mütter wachsen oft in einem Umfeld auf, in dem ihre Gefühle und Bedürfnisse wenig bis gar keine Beachtung finden. Eine narzisstische Mutter konzentriert sich in erster Linie auf ihre eigenen Bedürfnisse und erwartet, dass sich die Kinder anpassen. Diese Vernachlässigung der emotionalen Bedürfnisse führt dazu, dass die Kinder lernen, ihre Gefühle zu unterdrücken oder zu ignorieren, um Konflikte zu vermeiden und die Mutter zufriedenzustellen.
Ein direktes Ergebnis dieser Dynamik ist ein geringes Selbstwertgefühl. Kinder, die ständig kritisiert oder ignoriert werden, entwickeln das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Sie verinnerlichen die Botschaft, dass ihre Gefühle und Meinungen nicht wichtig sind. Dieses mangelnde Selbstwertgefühl manifestiert sich in verschiedenen Aspekten ihres Lebens, sei es in Form von Leistungsdruck in der Schule, Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen oder einem generellen Gefühl der Unzulänglichkeit („Ich bin nicht okay, so wie ich bin“).
Ein weiteres Problem ist die emotionale Unreife