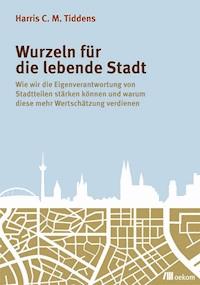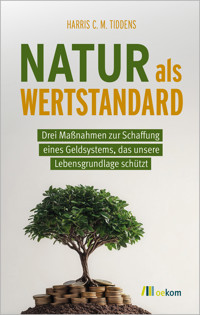
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das heutige Geldsystem trägt maßgeblich dazu bei, die Bewohnbarkeit der Erde zu zerstören. Doch eine neue Währungsordnung, die auf echten Werten beruht und bei der die Natur geschützt wird, ist möglich. Harris Tiddens stellt dafür drei Maßnahmen vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harris C. M. Tiddens
Natur als Wertstandard
Drei Maßnahmen zur Schaffung eines Geldsystems, das unsere Lebensgrundlage schützt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2024 oekom verlag, München oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, Goethestraße 28, 80336 München +49 89 544184 – 200
www.oekom.de
Layout und Satz: oekom
Lektorat: Lena Denu
Umschlaggestaltung: Sarah Schneider, oekom verlag
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9783987264214
DOI: //doi.org/10.14512/9783987263866
Menü
Cover
fulltitle
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einführung :
Geld, das kranke Nervensystem der Städte
Kapitel 1:
Holland … Holzland? Die Gründung der »Amsterdamer Wisselbank« und ihre Folgen
Kapitel 2:
Ein Geldsystem, zwei Eigenschaften
Erstes Merkmal: Eine von der realen Welt entkoppelte, mathematische Echokammer
Zweites Merkmal: Geldnutzung, ein systemisches Abschieben von Verantwortung
Verantwortlichkeiten zur Vermeidung von Entwaldung
Kapitel 3:
Die Finanzwelt – Risiko und Verantwortung
Schutz der unberührten Ökosysteme: Die Absurdität einer »End‐of‐Pipe‐Finanzierung«
Sich der Verantwortung entziehen: Die 500 größten entwaldungsrelevanten Unternehmen und ihre Finanzinstitutionen
Sich aus der Verantwortung stehlen …
Ein Blick auf das finanzielle Ausmaß der Herausforderung
Ein Beispiel aus der Finanzwelt: Versicherungen
Basel III als Symptom des heutigen Geldsystems
Fiduziares Geld?
Können gesetzliche Regelungen das Vertrauen wiederherstellen?
Kapitel 4:
Natur als Wertstandard für Geld – drei Maßnahmen
Handelbare Zertifikate für unberührte Naturräume
Verknüpfung der Geldmenge an Naturzertifikate
Finanztransaktionsabgabe zum Schutz von Naturräumen
Welche Finanztransaktionen sollen erfasst werden?
Warum eine zweckgebundene Abgabe und keine allgemeine Steuer?
Wie hoch soll die Abgabe sein?
Was sind die Ziele dieser Abgabe?
Kapitel 5:
Aus moralischer Pflicht handeln – die Rolle der Religionen
Kapitel 6:
Was nun?
Anhang:
Parlament der Religionen der Welt
Danksagung
Über den Autor
Anmerkungen
Meinen Enkelkindern Luna, Vesper, Joran, Leto, Kora & Milo ist dieses Buch gewidmet. Es ist ein Beitrag, damit sie und ihre Zeitgenossen zu zufriedenen, kritischen und lebensfrohen Urgroßeltern heranwachsen können.
Abkürzungsverzeichnis
BIZ
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
EZB
Europäische Zentralbank
FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
FSC
Forest Stewardship Council
GDFLU
Glasgow Leaders' Declaration on Forests and Land Use
ICEM
Islamic Conference of Environment Ministers
ICESCO
Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization
IFEES
Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences
IFL
Intact Forest Landscapes
IUCN
International Union for Conservation of Nature
PRI
Principles for Responsible Investment
UNCCD
United Nations Convention to Combat Desertification
UNEP
United Nations Environment Programme
UNEP – WCMC
World Conservation Monitoring Centre des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
VOC
Vereenigde Oostindische Compagnie
Einführung Geld, das kranke Nervensystem der Städte
Die Bewohnbarkeit der Erde hängt von intakten Naturräumen ab. Warum zerstören wir Menschen sie trotz aller guten Vorsätze unaufhaltsam weiter? Wir können die Ursache mit drei einfachen Maßnahmen ändern, aber dazu müssen wir die Fehlkonstruktionen unseres heutigen Geldsystems als Hauptursache begreifen.
Besonders erschreckend ist, wie langsam sich die städtische und post‐urbane Gesellschaft in Richtung eines nachhaltigen Verhaltens bewegt. Woran liegt das? Um diese verheerende Trägheit zu beurteilen, schauen wir meist auf die Eigenschaften der genutzten Güter, die Produktionsformen, den Naturverbrauch und die Dienstleistungen. Dann versuchen wir, die beteiligten Mengen und ihre Auswirkungen zu messen, um danach Verhaltensänderungen herbeizuführen, auch durch Gesetze. Der Widerstand dagegen ist enorm. Gewohnheiten sind stark und nicht leicht zu ändern. Menschen, Unternehmen, Verwaltungen usw. müssen schließlich von der bestehenden Wirtschaft leben, die diese Produkte und Dienstleistungen hervorbringt.
Welche Aufgaben hat die Wirtschaft? Es gibt eine gut beschriebene Forderung, die besagt, dass sie nur zwei Aufgaben zu erfüllen hat: Die Versorgung der Menschen und die Einhaltung der Tragfähigkeitsgrenzen der Ökosysteme.1 Die erste Aufgabe gelingt recht gut. Die zweite überhaupt nicht. Wie kann das sein?
Städte sind die massivste Entwicklung der Menschheit. Noch im Mittelalter lebten schätzungsweise 95 Prozent der Weltbevölkerung in Dörfern, die auch ohne Stadt noch gut leben konnten, in »vorstädtischen Dörfern«.2 Heute beträgt der Anteil der indigenen Bevölkerung und diesen kleinen vorstädtischen Dörfern weltweit höchstens noch 25 Prozent. Es leben 56 Prozent der Weltbevölkerung direkt in diesen sogenannten Städten, die ihr naturzerstörendes Verhalten viel zu langsam ändern. Der Rest, etwa 19 Prozent, lebt in modernen Dörfern, die vollständig von der städtischen Wirtschaft abhängig sind. Tendenz: weiter steigend.
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen diesen vorstädtischen Dörfern als alter Gesellschaftsform und den Städten? Es ist das Geldsystem. Die suburbanen Dörfer kommen noch weitgehend ohne Geld aus, die Städte und die suburbane Gesellschaft nicht.
Diese Empfehlung zielt nicht darauf ab, das Geld abzuschaffen. Das würde die Städte und moderne Gelddörfer, also drei Viertel der Weltbevölkerung, in katastrophale Schwierigkeiten bringen. Aber wir als Menschheit müssen und können den Charakter des heutigen Geldsystems rasch verändern. Dies kann durch drei relativ einfache Schritte geschehen. Wenn wir das nicht tun, werden die Städte und Gelddörfer wie ein Krebsgeschwür ihre eigene Lebensgrundlage zerstören.
Ein gutes Beispiel für das Zusammenspiel von Geldwesen, Stadt und Natur ist Amsterdam im 17. Jahrhundert. Dort entstand die erste Zentralbank Europas. Das hatte schon damals negative Folgen für den Waldbestand bis nach Riga und Bayern. Diese Art der Naturzerstörung hat sich im Laufe der Zeit verstärkt. Die Entwicklung wurde und wird durch zwei immer stärker werdende Merkmale unseres heutigen Geldsystems vorangetrieben. Es ist allgemein bekannt, dass Geld ein Tauschmittel ist, um eine Ware oder eine Dienstleistung zu erhalten. Die folgenden Aspekte geraten jedoch leicht aus dem Bewusstsein unserer Gesellschaft. Erstens: Das Geldsystem hat sich zu einer mathematischen Echokammer entwickelt, die völlig von der Natur entkoppelt ist. Zweitens: Die Verwendung von Geld bedeutet eine systemische Verschiebung der Verantwortung dafür, wie diese Güter oder Dienstleistungen entstanden sind.
Beides sind die größten Bedrohungen für die Bewohnbarkeit der Erde. Die Finanzwelt befasst sich zwar formell mit den aktuellen Risiken, aber nur unter dem Gesichtspunkt ihrer – in Geld berechneten – Gewinnmargen. Die direkte und primäre eigene Verantwortung für die Lösung der lebensbedrohlichen Probleme, vor denen wir als Menschheit heute stehen, wird dabei kaum oder gar nicht berücksichtigt.
Drei relativ einfache erste Maßnahmen können dafür sorgen, dass sich das Geldsystem der Natur unterordnet und nicht umgekehrt. Zum einen sollen jährlich handelbare Zertifikate für die Fläche der weltweit noch vorhandenen intakten Naturgebiete geschaffen werden. Begonnen werden soll mit bestehenden Naturschutzgebieten sowie der Fläche von Urwäldern, Mangroven und Mooren. Pro vier Quadratkilometer unberührte Naturfläche gibt es ein Zertifikat. Das bestehende Geldsystem soll dann mit diesem System der Naturzertifikate verknüpft werden. Die Geschäftsbanken müssten nicht nur Geld für ihre Zwangseinlagen bei den Zentralbanken hinterlegen, sondern auch diese Zertifikate. Nimmt die globale Waldfläche wie bisher weiter ab, wird das Geld teurer. Nimmt sie zu, kann die Geldmenge und damit die Wirtschaft wachsen.
Das wird aber nur gelingen, wenn die Finanzwelt sich folgende Anliegen zu eigen macht: den Schutz noch intakter Naturräume wie Urwälder, Moore und Mangroven und die Unterstützung der sie umgebenden lokalen Gemeinschaften finanziell so gut auszustatten, dass es nicht mehr attraktiv ist, sie zu zerstören.
Die Finanzierung dieser Fürsorge erfolgt durch die dritte Maßnahme, die Einführung einer zweckgebundenen Finanztransaktionssteuer. Die Europäische Kommission hat hierzu in der Vergangenheit bereits detaillierte Modelle entwickelt.
Aber der Widerstand der Finanzwelt wird sehr groß sein. Welche Kräfte können sich mit ihrer Macht messen und das Ganze durchsetzen?
Die Antwort mag überraschen. Aber nach der geldgläubigen Gesellschaft sind nicht die politischen Parteien, sondern die Religionen die größten Organisationen der Weltbevölkerung. Die Gläubigen dieser Religionen können und sollen sich auf ihre Wurzeln besinnen. So haben sich die abrahamitischen Religionen, also Christentum, Islam und Judentum, bereits in ihren alten Schriften ausführlich gegen den »Wucher«, also gegen den Machtmissbrauch von Geld, ausgesprochen. In unserer Zeit ist es jedoch notwendig geworden, das Geld in weiteren ethischen Kategorien zu betrachten. Jetzt geht es um die moralische Pflicht, die schlimmste Form des »Wuchers« zu verhindern, nämlich die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen! Die Religionen können sich erneuern. Sie können dazu beitragen, dass eine neue Geldordnung entsteht. Wenn wir weiter unsere Erde bewohnen wollen, soll der Naturstandard als neue Währungsordnung eingeführt werden, bei dem sich das Geld der Natur unterordnet und nicht umgekehrt.
Kapitel 1Holland … Holzland? Die Gründung der »Amsterdamer Wisselbank« und ihre Folgen
»Holland« bedeutet eigentlich »Holzland«. Vor dem Mittelalter waren die Niederlande von großen Waldflächen bedeckt. Mitte des 17. Jahrhunderts war nur noch weniger als ein Prozent der Fläche bewaldet. Wie es dazu kam und wie die Verbesserung des Geldwesens in Amsterdam eine Entwaldung bis nach Riga und Bayern verursachte, wird in diesem Kapitel beschrieben.
In den Niederlanden lässt sich diese Beziehung zwischen Dorf und Wald an der Anzahl der Orte ablesen, die einen Zusatz zum Ortsnamen haben, der auf den Wald hinweist. Beispiele sind »wold«, »loo«, »laar«, »holt« und »rade«. Die geographische Verteilung dieser Ortsnamen über das ganze Land zeigt, wo es zwischen 750 und 1350 noch Wald gab.
Abb. 1 Karte der Verteilung größerer und kleinerer holländischer Siedlungen mit Namen, die auf das Vorhandensein von Wald hinweisen, Zeitraum 750–1350 n. Chr.3
Anfang des 17. Jahrhunderts war von dieser ursprünglich so großen Waldfläche nicht viel übrig.
Abb. 2 Waldgebiete in Holland im 17. Jahrhundert auf der Karte der »Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura«, auch »Mercator/Hondius Atlas« genannt (1607).4
Doch wie kam es zu dieser drastischen ländlichen Veränderung in nur wenigen hundert Jahren? Durch Geld. Wehrhafte Siedlungskonzentrationen, also Städte, konnten nur entstehen, weil das Geld vor allem Nahrungsmittel, Holz und Werkzeuge zu Handelsgütern machte. Es war die seit dem Mittelalter einsetzende Urbanisierung, die von kleinflächigen Rodungen zu immer größeren Kahlschlägen führte. Es ist sicher nicht verwunderlich, dass die vorstädtischen Dörfer immer wieder Lücken in die Wälder geschlagen haben und dies auch heute noch tun. Allerdings handelt es sich dabei um kleine Flächen, die nur dem unmittelbaren Eigenbedarf dienen. Die Menschen in den vorstädtischen Dörfern roden nur kleine Teile des Waldes, um Felder anzulegen, und verwenden die Soden und das Holz aus dem Wald, um ihre Häuser zu bauen, zu kochen und zu heizen.
Damals wurde der Waldverlust jedoch so erdrückend, dass die Niederländerinnen und Niederländer ab 1600 immer mehr nassen Torf stechen und Moore trockenlegen mussten, um wenigstens ihren Eigenbedarf decken zu können. Den Tiefpunkt erreichte der Waldbestand in den Niederlanden Mitte des 17. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit war weniger als ein Prozent der Fläche der Niederlande noch mit Wald bedeckt. Selbst für einfaches Brennholz war »um 1640 der tatsächliche Holzvorrat in den Niederlanden praktisch auf null gesunken«.5
Dieses Hintergrundwissen lässt berühmte Gemälde und Stiche dieser Zeit in einem anderen Licht erscheinen.
Abb. 3 (Kahle) Landschaft mit zwei Eichen, 1641. Jan van Goyen, Rijksmuseum Amsterdam6
Abb. 4 Die (letzten) drei Bäume, 1643. Rembrandt van Rijn, Rijksmuseum Amsterdam7
Aber woher kam dann das weitere Holz, das insbesondere in Amsterdam und der Zaanregion nördlich der Hauptstadt nicht nur zum Kochen und Heizen, sondern auch zum Bau von Häusern, Schiffen, Windmühlen, Fässern und vielem mehr verwendet wurde? Warum stieg der Holzverbrauch zu Beginn des 17. Jahrhunderts so plötzlich an?
Das 17. Jahrhundert war das Goldene Zeitalter der Republik mit Amsterdam als Zentrum. Die Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) ist zweifellos die bekannteste Organisation, die mit dieser Epoche in Verbindung gebracht wird. Die Gründung der VOC im Jahr 1602 war ein historischer Moment für die Republik der Sieben Vereinigten Niederlande (1588–1795). Ihre Kaufleute schlossen sich zu einem Kartell zusammen, um östlich des Kaps der Guten Hoffnung und westlich der Magellanstraße gemeinsam Handel zu treiben. Es war die erste Aktiengesellschaft und sollte im 17. Jahrhundert zur größten Handelsgesellschaft der Welt werden.
Die VOC wird oft als das erste Unternehmen benannt, das Handelsniederlassungen in mehreren Ländern unterhielt, und das nicht in Europa, sondern insbesondere in Asien. Die VOC baute dort sogar ein Handelsnetz zwischen den verschiedenen Handelsniederlassungen auf, das bis nach Japan reichte. Dieser innerasiatische Seehandel hatte seine eigene Währungseinheit und brachte über viele Jahre hinweg große Gewinne. Dieser Handel war zwar spektakulär, vom Volumen her jedoch eher unbedeutend. Er war nicht der einzige Grund für das Goldene Zeitalter Amsterdams, denn gleichzeitig vollzog sich eine weniger spektakuläre, aber in Bezug auf das Handelsvolumen weitaus mächtigere, Entwicklung. Eine Entwicklung, die Amsterdam plötzlich zum Zentrum des europäischen Handels machte.