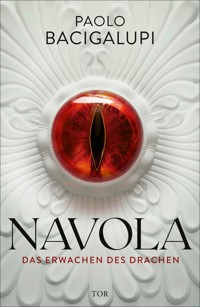
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein epischer Fantasyroman über Macht, Verrat und Magie in einer alternativen Rennaissance. "Voller Gift, Verrat und Ausschweifung. Die Lektüre von Navola ist wie in ein luxuriöses Bad aus Blut zu gleiten." Holly Black Der Stadtstaat Navola ist auf Handel gebaut. Die Paläste und Türme sind dem Reichtum ihrer Kaufleute entsprungen. Gehandelt wird mit allem: Gerste und Reis, Flachs und Wolle, Eisen und Silber, Waffen, Armeen und Menschenleben. Und über allem thront die Bank der di Regulai. Mit List, Gewalt und ihrem unerschöpflichen Vermögen verkörpert sie eine Weltmacht: Kaufleute bitten um ihre Unterstützung, Künstler um ihre Gunst, Fürsten um eine Einladung zu ihrer Tafel. Die di Regulai behaupten zwar, sie seien unpolitisch, aber mit ihrem Reichtum kaufen sie Städte und stürzen Königreiche. Schon bald soll Davico di Regulai die Macht von seinem Vater übernehmen. Sein Schicksal hängt von zwei Dingen ab. Zum einen von seiner Fähigkeit, das komplizierte Spiel der navolanischen Diplomatie zu spielen. Zum anderen von einem versteinerten Drachenauge, das sich im Besitz der Familie befindet und das weit mehr als nur ein mächtiges Symbol ihrer Macht und ein Talisman ist. Für Leser*innen von Patrick Rothfuss, Andrzej Sapkowski und George R.R. Martin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1045
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Paolo Bacigalupi
Navola
Das Erwachen des Drachen
Über dieses Buch
Der Stadtstaat Navola ist auf Handel gebaut. Paläste und Türme sind dem Reichtum ihrer Kaufleute entsprungen. Über allem thront die Bank der di Regulai. Mit List, Gewalt und ihrem unerschöpflichen Vermögen verkörpert sie eine Weltmacht. Die di Regulai geben sich gern unpolitisch, aber mit ihrem Reichtum kaufen sie Städte und stürzen Königreiche.
Schon bald soll Davico di Regulai die Geschäfte von seinem Vater übernehmen. Um die zahlreichen Intrigen gegen die di Regulai zu überleben, muss er das komplizierte Spiel der navolanischen Diplomatie meistern. Doch das ist schwerer als gedacht. Bald ist Davicos einzige Hoffnung der Talisman der Familie, das Symbol ihrer Macht: ein versteinertes Drachenauge, dessen geheimnisvolles Glühen Davico wie ein Leuchtfeuer durch den Nebel der Ränkespiele führt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Paolo Bacigalupis Geschichten und Essays sind im WIRED Magazin, in Slate, Medium, Salon.com, The Magazine of Fantasy und Asimov's Science Fiction Magazine erschienen. Sein Debütroman »Biokrieg« wurde vom TIME Magazine zu einem der zehn besten Romane des Jahres 2009 gekürt und gewann außerdem die Hugo, Nebula, Locus Awards sowie den Kurd-Laßwitz-Preis und den und den Grand Prix de l'Imaginaire. Sein Debütroman für junge Erwachsene, »Schiffsdiebe«, war Finalist beim National Book Award.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Navola: a novel« bei Alfred A. Knopf, einem Verlag bei Penguin Random House LLC, New York
Copyright © 2024 by Paolo Bacigalupi
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Guter Punkt, München, nach einer Ideee von John Gall
Coverabbildung: Sasha Vinogradova
ISBN 978-3-10-492030-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
[Motto]
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
[Motto]
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Teil 2
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Vesuneser Lied
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Der Mythos der Erostheia
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
[Motto]
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Teil 3
Die Hunde werden fett
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Die Geschichte des Königs Nemaius
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
[Motto]
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
[Motto]
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Terzi Abacassi Senzi Gattimensi
Kapitel 46
Kapitel 47
Teil 4
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
[Motto]
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Dank
Für Anjula
Teil 1
Kapitel 1
Auf dem Schreibtisch meines Vaters stand ein Drachenauge. Ein Augapfel, größer als der Schädel eines Menschen, schon ganz milchig und kristallen. Und doch loderte im Inneren ein Feuer, als wäre er noch voller Leben. Es stand neben den Federkielen auf seinem Schreibtisch, wo er Pergamente mit Schuldverschreibungen unterzeichnete und mit bevollmächtigten Händlern Verträge über Leinen, Roheisen und Neruharz, Kardamom, Seide oder Pferde abschloss. Es stand auf jenem Schreibtisch, wo er Darlehen für Schiffbau und Kriegskosten vergab. Das Drachenauge stand neben einem Dolch der Sag und dem goldenen Amtssiegel des Callarino.
Das Drachenauge hatte er jedoch gekauft, und zwar im weit entfernten Zurom.
An der Echtheit dieses Auges gab es keinen Zweifel. Es war nicht rund, wie man hätte meinen können; an seinen Seiten rankten sich noch immer zu Kristall erstarrte Drachennerven – feine Splitter, scharf wie Dolche –, die an seiner Rückseite entsprangen, so dass die Form des Auges weniger einer Kugel als einer Träne glich.
Die messerscharfen Nerven, die es wie ein Schweif hinter sich herzog, verliehen ihm den Anschein eines lodernden Kometen, wie man ihn aus Arragnalos Deckenfresken in der Rotunde der Callendra kannte oder wie er den Himmel von Losiccia bis Pagnanopol erhellte und nun auf unsere Menschenerde niedergestürzt war. Das Auge schien mit dem schieren Feuer der Gestirne zu erglühen – einer Lebenskraft, die nichts auslöschen konnte, nicht einmal der Tod.
Als ich ein kleiner Junge war, spielte ich nicht selten in der Bibliothek meines Vaters mit meinem Hund, und manchmal erhaschte ich es aus dem Augenwinkel: ein Fossil, das nicht aus Knochen, ein Juwel, das nicht aus Stein bestand.
Ich nannte meine Hündin Faulpelz, da sie sich aus ihrer Muße nur aufscheuchen ließ, um mit mir zu spielen, und mit sonst niemandem. Immer, wenn ich in der Nähe war, wedelte sie mit dem Schwanz, kam zu mir, und wir preschten über die langen Galerien im Palazzo meiner Familie. Hin und her durch ausladende Korridore, durch Innenhöfe, Säulengänge und Gärten, die breiten Treppenhäuser der Wohngemächer auf und ab und dann die eng gewundenen Wendeltreppen unseres Wehrturms hoch und wieder runter. Unser Rufen und Gebell hallte über Pflaster und Parkett, prallte von den Gesichtern meiner Ahnen auf ihren Gemälden ab und erfüllte die mit Fresken ausgeschmückten Räume mit den bemalten hohen Decken, auf denen der Stier der Regulai stets seine Kreise zog.
Wir beide tollten nach Herzenslust durch den Palazzo – und hielten dies für derart selbstverständlich, wie es nur die Jungen und die Unschuldigen können. Doch wenn wir, wieso auch immer, nur, dass wir es für nötig hielten, im Arbeitszimmer meines Vaters landeten, waren wir so still wie Diebe, die im Quartiere Sangro ihr Unwesen trieben.
Der Drache gebot Ehrfurcht, selbst von unwissenden Kindern und tapsigen Welpen.
Obgleich die Echtheit des Auges unanfechtbar war, galt dies weniger für seine Herkunft. Der Händler, von dem mein Vater es erstanden hatte, behauptete, es stamme von einem Lindwurm, der über ein Jahrhundert lang die Wüsten und die roten Felsen Zuroms heimgesucht hätte, bevor ihn schlussendlich ein großer Krieger mit einer Klinge aus reinem Diamant erschlagen habe.
Hernach habe man das Auge einem habgierigen Sultan dargebracht, um einen fürchterlichen Krieg zu verhindern und eine Prinzessin zu erretten. Doch die Geschichte barg noch vieles mehr: die strahlende Schönheit der vom Sultan gefangen gehaltenen Maid, die Lüsternheit und Schwelgerei des grausamen Herrschers, die schändlichen Hexereien, mit denen er den Krieger hinters Licht führt, die triumphale Befreiung der Jungfer samt Sprengung ihrer Ketten und dann, zum Schluss, den tragischen Verrat am heldenhaften Krieger. Den Untergang von Imperien. Das Verstreichen von Zeit, Verwehen des Sandes. Den Niedergang uralter Städte, bis nichts mehr übrig war außer Legenden …
Was jedoch unumstößlich feststand, war, dass das Auge aus dem Grabmal eines mächtigen Herrschers stammte – wobei man sich bei der Frage, ob es sich um die Ausgrabungen Gelehrter oder schiere Plünderei gehandelt hatte, gern etwas im Vagen hielt. Jedenfalls hatte diese Wendung der Ereignisse zur Folge, dass das Auge in eine Händlerkarawane geriet und auf den Handelsrouten über die eisbedeckten Pässe von Khim und Kharat und von dort über die gischtgekrönten Wellen des Oceana Cerulea in unser schönes Navola gelangte, das pulsierende Herz der Banca Mercanta für alle Breiten, die Amos Dialekte sprachen – und schließlich hierher zu meinem Vater, Devonaci di Regulai, berühmt für seinen Reichtum und Einfluss in sämtlichen Landen, die an La Ceruleas himmelblaue Fluten grenzten.
Was auch immer die Kaufleute zur Herkunft des Auges behaupten mochten, so war mein Vater doch der Meinung, dass der Drache wohl kaum der Klinge eines Helden erlegen war, sondern weit wahrscheinlicher nur seinem Alter. Falls je ein Schwert die Schuppen dieser imposanten Bestie durchbohrt hatte, dann in einer postmortalen Schlächterei und nicht im heldenhaften Kampf. Drachen ließen sich mit Menschenklingen und Ähnlichem wohl kaum bezwingen – auch nicht mit diamantenen.
Und trotzdem kaufte er das Auge, bezahlte, ganz ohne zu handeln (und sollte den Namen des Händlers noch eine Ewigkeit mit diesem Preis verbinden), dann stellte er das Artefakt auf seinen Schreibtisch. Wenn Männer zu ihm kamen, um Verträge zu unterzeichnen und Versprechen abzugeben, ließ er sie auf das Auge eines Drachen schwören. Auf diese Weise waren seine Geschäftspartner hinreichend gewarnt, dass sie es nicht mit irgendeinem Münzverleiher auf dem Quadrazzo Maggi zu tun hatten, sondern mit Devonaci di Regulai da Navola, und nichts und niemand würde ihnen helfen können, wenn er auf die Einlösung ihrer Versprechen pochte.
Mein Vater besaß das Auge eines Drachen.
Der schon lange verstorbene Sultan von Zurom hatte keins gehabt.
Der König des fernen Cheroux besaß keines.
Selbst unser eigener Callarino von Navola nicht.
Tatsächlich konnte niemand sonst von sich behaupten, eines zu besitzen. Vielleicht die Schuppe eines Drachen. Oder irgendein versteinertes Etwas, von dem jemand behauptete, es sei ein Drachenzahn. Diese furchteinflößende und in Kristall gebannte Mahnung lang vergangener Macht jedoch, das war etwas völlig anderes. Die katzengleiche Iris hatte nichts von ihrer orangen Farbe eingebüßt, wiewohl die Oberfläche trüb geworden war. Tief aus ihrem Inneren drang ein Glühen, das selbst der Tod nicht hatte löschen können.
Wann immer ich in der Bibliothek meines Vaters weilte, schien mich das Drachenauge zu beobachten. Jedes Mal, wenn ich dort eintrat, schien es mir hungrig zu folgen. Es machte mir Angst, doch, wenn ich ehrlich bin vor Amo, zog es mich auch an.
Wenn mein Vater nicht zu Hause war, sondern unterwegs auf einer seiner Reisen, um sich mit seinen Schuldnern in unserem weitverzweigten Handelsimperium zu treffen, stahl ich mich hin und wieder in seine Bibliothek und starrte es an: den milchig-trüben Schimmer seiner Oberfläche, den glutlodernden Zorn darunter, gefangen im Inneren des blinzelnden geschlitzten Katzenauges. Eines Auges, so groß wie mein gesamter Kopf, das wutentbrannt auf unser alltägliches menschliches Streben blickte. Unsere Käufe und Verkäufe von Ballen guter Champa-Wolle und Säcken voller Weizen.
Es machte mir Angst.
Es zog mich an.
Und eines Tages berührte ich es.
Kapitel 2
Vielleicht aber sollte ich Euch zunächst das Wesen meines Vaters erklären, und auch sein Geschäftsfeld. Wer waren wir, die wir den Archinomo Regulai führten? Wer waren wir, dass mein Vater ein solches Artefakt erwerben konnte?
Der Name Regulai war alt. Er reichte zurück bis in die Zeit vor Amo und hatte sich im Laufe dieser Jahre große Hochachtung erworben. Meine Vorfahren hatten die große Flut zur Zeit des alten Reiches miterlebt, als die Oceana Cerulea in ihrem Zorn Tausende hinwegfegte. Wir hatten Scuros Plagen überlebt, als diese unser Land so lange heimsuchten, bis die mit schwarzen Beulen überzogenen Leichen sich so hoch türmten wie die Häuser. Und wie so viele Navoleser waren wir in die Berge geflohen, als die große Hauptstadt Torre Amo an die Khur fiel, das Reich der Amoneser in tausend Stücke brach und sich kleine Fürsten, Priester und Straßenräuber allesamt zu Herrschern krönten und auf der Cerlueischen Halbinsel allerorten Kriege um Ruhm und Ländereien ausgefochten wurden.
Und als die Kriege endeten, kehrten wir wie so viele andere zurück in unser geliebtes Navola am Meer.
In unseren frühen Jahren waren die Regulai einfache Wollhändler gewesen, die mit den Hirten und den Dorfbewohnern in der bergigen Romiglia handelten, und dann die Ware mühsam aus der Wildnis in die Stadt beförderten, um sie in Navola an die Webergilde zu verkaufen. Spätere Generationen erlernten dann die Kunst des Abakus und Federkiels. Allmählich wandelten meine Ahnen sich von Land- zu Stadtmenschen. Wir ließen uns in der Via Lana nieder, umgeben vom Klappern der Webstühle, dem Geruch von Leinenfarbe und dem stetigen Geplapper der Mercantae, wenn diese mit der Webergilde feilschten. Wir sandten Stellvertreter in die Wildnis, um die Wolle einzusammeln, und lernten unterdessen, Verträge aufzusetzen und zu stempeln, für die wir mit unserem Namen bürgten. Wir liehen anderen Händlern Geld, vergaben kleine Darlehen, versicherten Kaufleute gegen Wegelagerei und wilde Bestien, und allmählich wurde die Macht unserer Versprechen allgemein bekannt.
Doch erst mein Urgroßvater machte uns zu einem der Archinomi unserer Stadt.
»Deiamo di Regulai«, rügte mich meines Vaters Numerari Merio, »wäre von Euren Klagen über die langweilige Arbeit eines Scriveri zutiefst gekränkt.«
Ich war damals noch recht jung, kaum älter als acht oder neun Jahre unter Amos Licht, und ich haderte furchtbar mit meinen Unterweisungen im Schreiben. Ich wollte nichts lieber als hinaus in die Sonne mit Faulpelz, meinem neuen Welpen mit seinen drollig dicken Pfötchen und dem peitschenartig wedelnden Schwanz. Stattdessen war ich gefangen im Dämmer des Scrittoriums unserer Bank, hockte neben Merio, umgeben von Scriveri, Numerari und Abaccassi, die alle eifrig mit ihren Federkielen kritzelten und klackernd an ihren Abaki hantierten. Merio schnalzte über meine Handschrift missbilligend die Zunge. »Euer Urgroßvater kannte jeden noch so kleinen Teil seines Geschäfts und verachtete keinen einzigen davon.«
Ich unterdrückte ein Gähnen.
Merio schnippte mit dem Finger an mein Ohr.
»Passt auf, Davico. Je eher Ihr fertig seid, desto eher könnt Ihr hinaus zum Spielen.«
Ich beugte mich wieder über meine Aufgaben. Ringsum verrichteten Erwachsene unverdrossen ihre Arbeit, fügten neue Zahlen in ihre Spalten ein, verbuchten Ein- und Auszahlungen für Acconti Seguratti, lasen und beantworteten die Briefe, die den ganzen Tag lang eintrafen und versandt wurden. An den Wänden des Scrittoriums türmten sich die Früchte ihrer Arbeit: Kontenbücher, Schriftwechsel, Verträge, Leitfäden für Numerari zu den Regularien des Geschäftsverkehrs und den Gesetzen des Leggus. All dies war zu Büchern gebunden, auf Pergamentrollen geschrieben, in Blätterstapeln aufgehäuft – in seltenen Fällen gar auf Stofffetzen gekritzelt –, und daraufhin nach Region, Handelsgut und Händler geordnet. Alles wurde gut verwahrt in mit Eisengittern abgesperrten Fächern, um unsere Geheimnisse vor möglichen Spionen zu bewahren.
In dieser dämmrigen und muffigen Welt des Pergaments plagte ich mich ab, kniete ungelenk auf einem Stuhl, damit ich groß genug war, um an Merios Tisch zu arbeiten, alldieweil ich schmerzlich merkte, wie vor der Tür der Tag verstrich, der Sonnenschein über den Boden kroch, wenn Amo seinen Streitwagen über den Himmel lenkte.
Jenseits des Fensters kündete ein Gewirr aus Rufen und Gebrüll, Gemecker und Gebell davon, dass auf den Straßen reges Leben herrschte. Fuhrwerke schepperten, Vieh muhte, Hähne krähten, Pfauen schrien, die Gespräche und das Lachen der Kaufleute, Bauern, Archinomi und Vianomae drangen zu mir empor. Alles lockte mich hinab mit seinen betörenden Gerüchen – reife Früchte, frischer Dung, duftende bunte Blumen –, und nichts davon durfte ich mir ansehen.
An jenem Tag bestand meine Aufgabe darin, einen Vertrag abzuschreiben, dessen Inhalt ich kaum begriff. Die Worte waren hochtrabend, die Zahlen gar noch höher, die Fachausdrücke unsäglich abstrakt und gespickt mit verborgenen Bedeutungen. Worte wie promissorio und fallimante. Wendungen wie usanza da Banca Regulai, controllar da Navola, cambio del giorno und definis da Vaz. Wenn ich daran zurückdenke, erscheint mir dieses Schriftstück heute wie ein heimtückisches schlangenhaftes Etwas, das nirgendwohin zu führen schien und schlechterdings kein Ende finden wollte.
»Euer Urgroßvater war der Auffassung, dass es keine Pflicht war, jedewede Tätigkeit seines Geschäfts auszuüben, sondern eine Ehre.« Merio spähte durch die Schlitzfenster hinunter auf die Straße, Fenster, die hoch genug waren, um genügend Licht hereinzulassen, und doch so schmal, dass sich kein Dieb hindurchzwängen konnte. »Von der niedersten und mühsamsten Verrichtung bis zur vornehmsten – alles war ihm eine Ehre.« Er sog nachdenklich an seinen Zähnen. »Tuotto lavoro degli scriveri«, sagte er. »Tuotto lavoro degli numerari.«
Er trat heran, um mir über die Schulter zu blicken und meinen Fortschritt zu begutachten. »Ebendieses Promissorium, welches Ihr gerade abschreibt und einem neuen Zweck zuführt, stammt aus der Feder von Deiamo. Eure Hand folgt seiner. Stellt Euch das vor, Davico. Ein Kontrakt, verfasst von einem Mann, der schon so lange zu Amo aufgefahren ist, und dennoch überdauern seine Worte. Seine Hand weilt noch immer unter uns, er streckt sie über drei Generationen nach Euch aus. Seine Hand ergreift die Eure …«
Die Vorstellung, dass die Hand meines toten Urgroßvater nach der meinen griff, kam mir weit weniger verzückend vor als Merio. Der Gedanke ließ mich vielmehr schaudern und an die Katakomben unter Navola denken, wo sich die Knochen alter Amoneser in tropfenden Gängen und Gewölben bis zur Decke stapelten, doch ich hütete mich davor, zu widersprechen.
»Folgt seiner Hand, folgt seiner Anmut«, sagte Merio und wedelte dabei unwillkürlich mit der Hand, während er hinter meinem Rücken rastlos auf und ab ging. »Folgt ihr und verehrt noch die kleinsten Einzelheiten von Deiamos Kunst. Und dankt Amo, dass Euch Euer Urgroßvater in ebendiesem Moment beisteht.«
Ich wusste, dass meine Freunde Piero und Cierco in ebendiesem Augenblick im Quadrazzo Amo waren und mit ihren Holzschwertern eine Spielschlacht ausfochten. Und auch Giovanni war in ebendiesem Augenblick gewiss dabei, hockte auf den schattigen Stufen der Callendra und las in einem seiner vielen dicken Wälzer. Mein Freund Tonno war in jenem Augenblick unten am Hafen und angelte nach Cerulea-Augen. In ebendiesem Augenblick backte Siana Brazzarossa in unserer Küche süße Kekse mit Ingwer und Kha-Gewürz, so wie die Gefährtin meines Vaters Ashia sie gern möchte. Und was mir noch näherging: In ebendiesem Augenblick schnüffelte Faulpelz einsam um die Stallungen unseres Palazzos herum, gekränkt, dass ich sie ganz allein gelassen hatte …
»Passt auf, Davico!« Merio schnippte wieder an mein Ohr. »Jede Kleinigkeit ist von Bedeutung! Deiamo ist weit gereist, um sein Wissen zu erweitern. Er wusste ebenso viel über die Ratten, die die Getreideschiffe von Vesuna befielen, wie über das Holz, das man benötigte, um die Webstühle zu reparieren, mit denen hier in Navola der Leinenstoff gewebt wurde.«
Merio wies auf die Bände und Papiere, die die Wände säumten. »Man kann noch immer seine Briefe lesen und sehen, wie sein Verstand arbeitete. Das Wissen, das er anhäufte. Er beschnupperte die Hälse der Frauen von Merai, um herauszufinden, welches Parfum dort gerade in Mode war. Und er trank Kamelmilch in den Zelten von Bedoz, um mehr über das Leben der Karawanenreisenden zu erfahren. Wir führen seine Tradition fort: Die Briefe, die wir schreiben, das Wissen, das wir zusammentragen …«
Er deutete in Richtung seines Pults, auf dem sich wasserfleckige oder zerfetzte Schreiben von unseren weit verstreuten Handelspartnern stapelten. »Das ist die Grundlage von allem, was Eure Familie tut, also lernt auch Ihr, so wie Euer Vater und dessen Vater vor ihm, einer nach dem anderen, vom Genie des Deiamo – auf, auf Davico. Schreibt weiter. Haltet nicht inne, nur weil ich rede. Drei makellose Abschriften, und dann könnt Ihr rausgehen und spielen. Eine für uns. Eine für den Kaufmann Sio Tosco. Und eine, die er in unserer Außenstelle in Vaz vorlegen muss, damit er seinen Kredit in Vazziani-Silberfingern ausgezahlt bekommt, um seine Pferde zu kaufen. Wusstet Ihr, dass sie ihr Silber in Fingern bemessen?«
Ich nickte.
»Und wie nennen die Leute in Vaz ihr Gold?«
»Daumen.«
»Wie viele Finger ergeben einen Daumen?«
»Zwölf.«
»Gut. Schreibt weiter. Ihr solltet in der Lage sein, mir zuzuhören und weiterzuarbeiten, Davico. Wenn ich dies tun müsste, wäre ich längst fertig …« Er verstummte. »Nai, Davico. Lettera di credo schreibt man mit zwei t.« Sein Finger fuhr hinab auf meine Arbeit, verschmierte die Tinte und ruinierte meine Abschrift. »Seht Ihr das? Zwei t. Die Kleinigkeiten zählen. Tag der Rückzahlung, Gewicht des Silbers und die zwei t. Werft das Papier weg. Fangt noch mal von vorne an.«
»Mir tut die Hand weh«, sagte ich.
Wenn ich heute, da ich älter bin und weiser, zurückblicke, vermute ich, dass ich sehr wenig abgeschrieben hatte, aber ich war jung und arglos, und es kam mir damals vor, als hätte ich mich schon Tage damit abgerackert. So empfinden Kinder. Eine Minute der Langeweile gleicht einer ganzen Stunde, eine Stunde einem Tag, und ein Tag einem gesamten Leben, und wir geben unsere Gefühle offen preis, denn wir haben die Kunst des Faccioscuro noch nicht erlernt.
Merios Stimme wurde schärfer. »Euch tut die Hand weh?«
Für gewöhnlich war Merio ein heiterer Geselle, herzlich und gelassen, wie es für einen Mann aus Pardi typisch war, mit fülligen roten Wangen und dem prallen Bauch eines Genießers, der einen Sinn für guten Wein und noch besseren Käse hatte. Doch wie es schien, hatte ich seine Geduld nun ausgereizt, denn seine Brauen schnellten in die Höhe, und seine Augen funkelten nicht mehr. »Wenn Euch die Hand weh tut, dann denkt an alle die Männer, die hier rings um Euch herum arbeiten. Sie alle arbeiten für Euch.« Er drehte sich zu den Scriveri an den anderen Pulten um. »Ist irgendjemand von euch müde?« Er deutete mit ausgestrecktem Finger auf den Mann, der uns am nächsten saß. »Du, Sio Ferro, bist du müde? Tut dir die Hand weh?«
Und natürlich sagte Sio Ferro: »Nein, Maestro.« Und alle anderen Scriveri lächelten mich nachsichtig an und beugten sich wieder über ihre Papiere.
»Diese Männer schreiben den ganzen Tag. Sie lesen den ganzen Tag«, sagte Merio. »Sio Ferro hat sein Handwerk gelernt, als er in Eurem Alter war, und er hat schon damals den ganzen Tag geschrieben. Also werdet auch Ihr dies tun. Erzählt mir nicht, dass Euch die Hand weh tut.«
Ich hütete mich davor, zu antworten, und doch war ich nicht glücklich. Ich fing auf einem frischen Blatt von neuem an, der Verzweiflung nahe, da ich nun wegen dieses einen Fehlers alles noch einmal abschreiben musste.
»Ai«, lenkte Merio schließlich ein, als er meinen elendigen Blick gewahrte. »Finis. Finis.«
Er legte seine Hand auf meine. »Legt Eure Feder weg, Davico. Kommt mit mir.« Er bedeutete mir, ihm zu folgen. »Ci. Dies ist keine Strafe. Kommt mit. Ich möchte Euch etwas zeigen. Kommt, kommt.« Er hieß mich mit einem Winken aufzustehen. »Kommt.«
Merio geleitete mich die breite Holztreppe des Scrittoriums ins Erdgeschoss hinunter, wo die Abacassi mit geschicktem Fingern schnippend und klackernd unsere Gewinne und Ausgaben berechneten. Wir schlängelten uns zwischen ihren Tischreihen hindurch und traten hinaus ins Getümmel auf der Straße.
Gleich links von uns stand das Tor zum Palazzo unserer Familie sperrangelweit offen. Merio führte mich durch einen kühlen Steingang, bis wir auf die ruhige, in Sonnenlicht getauchte Quadra Premia des Palazzos kamen, in deren Mitte ein sprudelnder Brunnen für Abkühlung sorgte.
Faulpelz erschnupperte sogleich unsere Ankunft und tollte von den Stallungen schwanzwedelnd zu uns herüber. Ich nahm sie in die Arme, ebenso glücklich, sie zu sehen, wie auch sie es war, mich zu entdecken. Sie wand und schüttelte sich, fuhr mit der Schnauze quer über mein Gesicht und leckte mir die Wangen.
Ich erwartete, dass Merio mich weiter ins Innere des Palazzos führen würde, doch das tat er nicht. Stattdessen blieb er dort mitten auf der Quadra stehen und sah mich erwartungsvoll an. Wie ein Jongleur mühte ich mich, die zappelnde Faulpelz auf dem Arm zu halten, und blickte mich um, ohne recht zu wissen, wieso er mich so ansah.
Hier waren die drei Bogentore, die hinüber zu der Quadra führten, an der unsere Stallungen lagen; dort, entlang der Außenmauer, die Unterkünfte unserer Leibgarde mit ihren unteren und oberen Galerien. Da war der plätschernde Marmorbrunnen, der Urula mit ihren Meerjungfrauen und Fischen zeigte, alle mit entblößten Brüsten, aus denen Wasser sprudelte. Das Wasser war angenehm kühl, besonders an einem so heißen Tag wie diesem. Weitere Bogengänge führten durch die gegenüberliegende Wand der Quadra und gewährten Zugang zu den privateren Gemächern unseres Palazzos, aber Merio ging nicht weiter. Stattdessen wies er auf das Fresko, das die gesamte noch verbleibende Wand der Quadra überspannte. Eine massive Mauer, die wir mit unserer Bank nebenan teilten.
»Habt Ihr Euch das jemals angesehen?«
»J…ja?«
Ich antwortete zögernd, da ich es natürlich kannte. Das Gemälde war kaum zu übersehen, über fünfundzwanzig Schritte breit und so hoch, dass ich, um es in Gänze zu betrachten, weit zurücktreten und den Hals hochrecken musste. Es zeigte die Schlacht zwischen Navola und den angreifenden Truppen aus Cheroux und Merai, und es war ebenso wenig zu verfehlen wie der Brunnen der Urula mit all den Fischen und Meerjungfrauen. Doch in dem Brunnen konnte ich mir wenigstens die Füße kühlen, und noch mehr Spaß bereitete es mir, Faulpelz mit Wasser zu bespritzen und zu ärgern. Und es war weit weniger interessant als unsere Pferdestallungen mit ihren Fohlen, Stuten und Hengsten, und obendrein dem angenehmen Geruch von Leder, dem süßen Duft von Heu und Pferdedung. Ich kannte dieses Wandgemälde schon mein ganzes Leben lang. Aber ich war auf der Hut, witterte ich in Merios Frage doch eine Falle. Selbst in diesen jungen Jahren wusste ich, wenn einer meiner Lehrer mir etwas einschärfen wollte, und ich sorgte mich immerzu darum, ob ich mich wohl daran schneiden würde.
»Was seht Ihr?«, wollte Merio wissen.
»Navola, Pardi und Savicchi kämpfen gegen Cheroux und Merai.«
»Was sonst noch?«
Ich mühte mich, mein Blick glitt über die aufeinandertreffenden Heere. Rechter Hand erstrahlte Cherouxs Angriffsziel, unsere Stadt Navola, gelegen zwischen der Mündung der Cascada Livia und dem gewaltigen Oceana Cerulea. Die Türme unserer vielen konkurrierenden Archinomi ragten weit über die Stadtmauern empor, funkelnd in der Sonne.
In Navola wusste jedes Kind, dass dies eine aufopferungsvolle und bedeutende Schlacht gewesen war, doch dieses Gemälde hatte ich nie sonderlich gemocht. Mein Freund Piero, der von Nomo Nobilii Anciens abstammte und die Kunst des Krieges liebte, sagte stets, er werde eines Tages ein großer General werden und heldenhafte Schlachten schlagen wie diese Verteidigung Navolas. Aber mir gefiel weder, wie das Blut auf dem Schlachtfeld floss, noch wie all die Toten in der Livia trieben. Es war ein grandioses Gemälde, aber auch ein unerquickliches.
»Schaut her«, sagte Merio in der Manier eines Oberlehrers. »Wir kämpfen nicht nur gegen den Einmarsch von Cheroux. Seht Ihr das, da oben am Himmel? Seht Ihr, wie Amo uns seinen göttlichen Segen und Beistand darbringt? Wie er uns mit seinem Streitwagen zu Hilfe eilt? Wir sind gesegnet von Amo und werden von ihm beschützt, denn wir sind rechtschaffen, und Cheroux ist ein Königreich der Hunde. Seht auch, wie grün das Schlachtfeld ist und wie blau das Wasser des Livia, wo Cheroux in die Enge getrieben wurde. Dies sagt uns, dass Navola gesegnet ist – mit dem Meer, dem Handel auf dem Fluss und seinen fruchtbaren Feldern, was es zu einer begehrenswerten Beute für Cheroux macht. Und schaut nur, wie die angreifenden Hunde aus Cheroux in Panik geraten, in den Fluss springen, versuchen zu schwimmen und in ihren Rüstungen ertrinken. Und hier …« Er reckte sich empor, konnte es aber natürlich nicht erreichen, da er viel zu klein und auch um einiges zu füllig war, um sein Ziel tatsächlich zu berühren. »Hier prangt das Siegel Eurer Familie, der Stier der Regulai, das unter den Bannern des Navoleser Heeres weht.«
Er sah mich erwartungsvoll an.
Ich starrte ausdruckslos zurück.
»Ci! Geschichte! Wir müssen Euch Geschichte lehren, Davico!« Er wischte sich den Schweiß von seinem kahlen Schädel. Seine Kopfhaut färbte sich in der Sonne bereits rosa, doch er schien fest entschlossen, mich zu unterweisen. Ich schmiegte Faulpelz fest an mich und versuchte, aufmerksam zu sein, während er anfing, verschiedene Fahnen und Siegel auszudeuten, darunter einige, die ich von anderen Navoleser Familien kannte.
»Archinomo di Regulai war nicht immer so angesehen«, erklärte Merio. »Vor den Zeiten deines Urgroßvaters war di Regulai lediglich der Name eines Kaufmannsgeschlechts, und Kaufleute sind oftmals nicht hoch angesehen, schon gar nicht zu jener Zeit. Damals bestimmten Archinomi Nobilii Anciens die Geschicke Navolas und begründeten dieses Anrecht damit, dass sie vom Blute der alten Amoneser waren. Sie waren es, die damals Rang, Achtung und Einfluss besaßen.«
»Wie Piero und Cierco.«
»Ja. Wie deine Freunde. Sie stammen von den alten Namen ab. Di Regulai dagegen war ein Straßenname, Vianoma. Hier aber, in diesem Augenblick, hat dein Großvater sein Banner neben denen der Adligen gehisst, die ihre Namen bis zu den Amonesern zurückverfolgen können …«
»Hat er …?«, unterbrach ich ihn.
Merio verstummte. »Hat er was?«
Ich blickte zu dem großen Wandbild auf, betrachtete die Männer, die Pferde, unser Banner, welches etwas größer als die anderen war, meinen Großvater auf seinem schwarzen Hengst Nero, mit hoch erhobenem Schwert …
»War das wirklich so? Hat es sich tatsächlich so zugetragen?«
»Wie kommt Ihr denn auf eine solche Frage?«
Ich war mir selbst nicht sicher. »Na ja … schließlich haben wir das Fresko malen lassen. Vielleicht …«
»Ja?«, ermunterte mich Merio, fortzufahren.
»Vielleicht stellen wir uns auf dem Gemälde ja nur so mächtig dar? So wie die Archinomo Furia ihre Feinde an den Mauern ihres Palazzos aufhängen, bis sie verrotten und zerfallen. Um Leute abzuschrecken.«
»Sprecht weiter.«
»Wenn Leute uns hier besuchen, schauen sie es sich an. Es ist das Erste, was sie sehen. Ich habe selbst gesehen, wie sie staunen. Und ich habe gehört, wie sie sich Dinge zuflüstern. Es bedeutet ihnen etwas. Vielleicht ist es eine Botschaft an sie. Vielleicht ist es ja eher eine Botschaft als eine wahre Geschichte.«
»Ai.« Merio strahlte und zwickte mir in die Wange. »Gerade wenn ich glaube, Ihr hättet nichts als Wolle zwischen den Ohren, blitzt dann doch ein Funken des Verstandes Eures Vaters auf.«
»Also, haben wir das Heer angeführt?«, fragte ich wissbegierig. »Gehörten wir zu den vorpreschenden Truppen?«
»Ist das von Bedeutung?«
Ich zögerte.
»Ich weiß nicht.«
»Dann denkt darüber nach. Denkt scharf nach. Ihr lest doch gerne alte Sagen. Die Tagebücher des Marcel von Bis. Avviccos Reisen. Ich weiß, Ihr mögt die Legenden der alten Götter. Sind sie wahr? Spielt es eine Rolle, ob sie wahr sind? Oder ist nur von Bedeutung, dass sie wahrhaftige Gefühle in Euch wecken?«
Ich kannte die Antwort nicht. Es freute mich, dass ich eine Frage gestellt hatte, die Merio Achtung abrang, nun aber hatte ich das Gefühl, mich wie beim Schwimmen zu weit hinaus gewagt zu haben und den Boden unter den Füßen zu verlieren.
Merio schenkte mir ein nachsichtiges Lächeln. »Denkt darüber nach, Davico. Es ist eine bedeutungsvolle Frage. Wenn ich Euch eines sagen kann, dann, dass Euer Großvater kein Feigling war. Man nannte ihn nicht ohne Grund den Stier. Er ritt in die Schlacht, und er war einer der Unterzeichner der nachfolgenden Verträge. Was den Rest betrifft, wer weiß? War sein Banner tatsächlich so groß und strahlend?« Er zuckte die Schultern. »Ein weiser Mann würde sagen, dass es wohl genügt, zu wissen, dass das Banner Eurer Familie heute so hoch aufragt und die Banner der alten Namen mit jedem Jahr ein wenig kleiner werden. Aber das ist es nicht, was ich Euch zeigen möchte. Kommt. Dort drüben, am Fuße des Gemäldes.«
Er ging an der Mauer entlang, zog mich hinter sich her bis ganz nach links, weit weg von Amo, bis wir schließlich auf meiner Augenhöhe zu einem in den Vordergrund gerückten Wald auf einem Hügel kamen, wo sich Männer auf Pferden versteckt hielten, viele davon geschickt verschmolzen mit den Bäumen, dunkle Umrisse, kaum wahrnehmbar und unheimlich. »Was tun diese Männer da?«
»Nichts.«
Auf Merios missbilligenden Blick hin versuchte ich es noch einmal.
»Sich verstecken?«
»Schon besser. Seht Ihr das Siegel auf ihren Schilden?«
»Es ist ein Wolf.«
»Ganz recht. Ein Wolf. Erkennt Ihr es?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Compagni Militi Lupari. Eine mächtige Söldnerarmee. Sie dient Cheroux als Reserve, die uns von hinten attackieren soll, während wir die regulären Truppen am Fluss in die Enge treiben. Cheroux hatte geplant, die Schlacht an diesen Ort in der Flussebene zu tragen, wo sie mit dem Rücken zum Wasser standen, und wollte uns auf diese Weise dazu bringen, anzugreifen. Die Lupari sollten aus den Bäumen hinabstoßen und uns von hinten angreifen. Uns zwischen dem Hammer von Cheroux und dem Amboss der Lupari zermalmen. Aber die Lupari greifen nicht an. Stattdessen schauen sie nur zu. Wegen dieses Mannes dort.«
Er tippte auf eine schemenhafte schwarzgewandete Gestalt, die durch den Wald schlich, das Gesicht verborgen unter einer dunklen Kapuze. In einer Hand hielt sie ein Messer, in der anderen einen Goldsack, aus dem Münzen purzelten. Allein ihr Aussehen verströmte Bosheit. »Das ist Vessio. Er war der Stilettotore deines Großvaters.«
Kurz stockte mir der Atem. »Wie Cazzetta?«
»Ganz ähnlich.«
Das war alles, was ich wissen musste. »Ich mag ihn nicht.«
Merio lachte auf, bellend und verdutzt. Er zauste mir durchs Haar. »Ich auch nicht, Davico! Ich auch nicht!« Er lachte noch ein wenig in sich hinein, dann wurden seine Züge wieder ernst. »Doch solltet Ihr auch wissen, dass Cazzetta Eurem Vater gegenüber völlig treu ergeben ist. Und ein treuer Messermann ist mit Gold nicht aufzuwiegen, ganz gleich wie unangenehm seine Erscheinung sein mag.«
Ich nickte skeptisch, wenig überzeugt.
Cazzetta ging in geheimnisvollen Aufträgen bei uns ein und aus, eine unheilschwangere Gestalt, die zu jeder Tag- und Nachtzeit auftauchte, auf einem schäumenden schwarzen Hengst namens Avinciius, siebzehn Hand hoch und eine wahre Bestie, in unseren Palazzo galoppierte. Dann stieg Cazzetta ab, warf einer Wache seine Zügel hin und marschierte los, um meinen Vater zu finden. Einmal hatte ich gesehen, wie er in sein Badegemach geplatzt war, so dass Badefrauen und Diener in heller Aufregung davongestoben waren. Ich hatte ihn mitten in einen Empfang des Callarino stiefeln sehen, schwitzend und stinkend von dem langen Ritt, worauf die Musik und sämtliche Gespräche ob seiner dunklen Aura jäh erstarben. Wann immer Cazzetta schlagartig erschien, ging mein Vater sogleich mit ihm in einen Nebenraum. Und dann verschwand Cazzetta wieder, oft noch in derselben Nacht, wie Rauch, weggetragen von derselben faulen Brise, die ihn zu uns hergeweht hatte.
Aber es war schlimmer, wenn er dablieb.
Cazzetta spielte gern grausame Spiele, und niemand litt darunter mehr als ich. Er zwang mich, meine Schnelligkeit in einem Spiel unter Beweis zu stellen, bei dem man sich auf die Hände drosch, bis meine Haut von seinen Schlägen taub war. Manchmal huschte er jäh aus der Dunkelheit hervor und bedrohte mich mit einem Stiletto, das er in einem Ärmel stecken hatte – oder dem in seinem Stiefel, oder aber einem jener kleinen Stoßdolche, die er in seinem steifen, hohen Kragen verbarg. Cazzetta erschien wie eine böse Fata, trat hinter einer Säule vor oder tauchte jäh aus dem Halbdunkel eines Bogenganges auf, und jedes Mal packte er mich und presste seine Klinge an meine Halsschlagader, und dann raunte er mir zu, ich sei doch di Regulai und müsse auf der Hut sein.
Das Schlimmste war jedoch, als Cazzetta einmal eine weiße Taube mitbrachte, die er mir schenkte. Er reichte mir den Käfig mit der Taube, dann zeigte er mir einen kleinen goldenen Daumenring mit rotem Stein. Er klappte den Ring auf, und eine winzige Nadel kam zum Vorschein. Anschließend griff er in den Käfig, versetzte der Taube einen Stich, worauf das Tier jäh umfiel und zuckend und flügelschlagend an Gift starb.
Dann gab er mir den Ring und warnte mich, ja vorsichtig damit zu sein. Der Ring war das Geschenk. Nicht die Taube.
Cazzetta war weder ein netter noch ein guter Mensch, und deshalb mied ich ihn.
Nun blickte ich auf zu diesem anderen Messermann, Vessio, der mit seinem Stiletto und seinem Sack voll Gold im Wald lauerte.
Merio sagte: »Diese Schlacht wurde nicht auf dem offenen Feld gewonnen, sondern im Schatten des Waldes. Nicht mit dem Klirren eines Schwertes, sondern mit dem Kratzen eines Federkiels. Sie wurde gewonnen, weil die Versprechen deiner Familie berühmt waren für ihre Unverbrüchlichkeit. So kalt und beständig wie das Eis des Cielofrigo.«
Wir betrachteten zusammen das Gemälde. Ich, der kleine Junge, der versuchte, das alles zu verstehen. Merio, der Numerari, der sich womöglich fragte, wie lange er gebraucht hätte, um all das Gold zu zählen, das nötig war, um sich die Treue der Lupari zu erkaufen.
»Aber wo ist Urgroßvater?«, fragte ich schließlich. »Ihr habt gesagt, Ihr würdet mir etwas über Deiamo erzählen. Aber in diesem Gemälde geht es um meinen Großvater, den Stier.«
»Nun, all das hier war das Werk deines Urgroßvaters!«
Merio trat zurück, umfasste mit einer ausladenden Geste das gesamte Bild. »Sein scharfer Verstand, seine ehernen Versprechen und seine Verträge, wie jener, den Ihr gerade abschreibt. Schaut hoch. Schaut ganz hoch in den Himmel. Seht Ihr, wie unser Gott Amo seinen lodernden Streitwagen im Dienste Navolas durch die Wolken lenkt? Jetzt schaut, wer neben ihm auf seinem Wagen steht, der geflügelte Vincii dort. Die stolze, wohlgeformte Nase, die tief liegenden Augen …«
»Deiamo?«
Nun, da Merio mich darauf hingewiesen hatte, erkannte ich ihn von anderen Bildnissen wieder. Selbst die gebeugte Körperhaltung von den langen Stunden an Schreibpult war zu sehen, nur dass er auf diesem Gemälde kraftvoll und geflügelt war und einen Lichtblitz schleuderte.
»Deiamo«, hauchte Merio. »Ganz recht. Der Stier reckt zwar das Schwert und prescht mutig in die Schlacht, doch es ist sein Vater, der Feuerblitze schleudert und zur Rechten Amos steht. Stellt Euch das vor. Der Stier gab dieses Gemälde in Auftrag, und doch stellt er seinen Vater gleich mit dem größten aller Götter.«
Merio setzte eine verschmitzte Miene auf. »Und ich kann Euch sagen, dass Garagazzo dieses Bild fast schon für Blasphemie hält.«
»Ach, wirklich?«
Merio zwinkerte ihm zu. »Aber gewiss tut er das! Achtet darauf, wenn er das nächste Mal zu Besuch kommt. Dann könnt Ihr sehen, wie das Gesicht unseres Hohepriesters hochrot anläuft. Und doch steht Deiamo standhaft da, weil Eure Familie es so will.«
Er beugte sich zu mir hinunter. »Vergesst das nie, Davico. Die wahre Macht Eurer Familie beruht auf der ungeheuren Kraft Eurer Versprechen und dem ach so mühsamen Wirken der Feder deines Urgroßvaters. Das ist die Grundlage von allem.« Dann gab er mir lächelnd einen Klaps auf die Schulter.
»Jetzt geht spielen. Morgen werdet Ihr diesen Vertrag makellos abschreiben, genauso wie es Deiamo einst getan hat.«
Geboren in einer düsteren Wohnung mit zwei Zimmern im Quartiere Lana, umgeben von klappernden Webstühlen und dem Rummel und Gebrüll der Händler, Geldverleiher und Cartalitigi, beschloss Deiamo sein Leben in einem prachtvollen Palazzo, gehüllt in Seide und geachtet von den größten Namen der Stadt. Doch obwohl er in so großem Reichtum starb, blieb er im Grunde seines Herzens immer Vianoma und sorgte sich um die Menschen von der Straße.
Es war Deiamo gewesen, der von seinem Geld überall in Navola die ersten Säulengänge errichten ließ, die den Vianomae in der Sommerhitze Schatten spendeten und sie in der Regenzeit vor Wolkenbrüchen schützten. Und er war es auch, der erstmals Arbeiter dafür bezahlte, tief zu graben und die alten Abwasserkanäle der Amoneser zu sanieren, die unter der Stadt verborgen lagen, damit der Unrat aus dem Leinenviertel weggespült wurde und alle Bürger vom höchsten bis zum niedersten durch Straßen ohne Kot und Abfall gehen konnten.
Als die Gier nach Ruhm die Archinomi von Navola erfasste und alle großen Namen einen Krieg gegen Vesuna forderten, war es Deiamo, der das Wort ergriff und sich dagegen aussprach. Er stand mitten in der Callendra und beschwor sie, dass es töricht sei, und er verlor deswegen manche Einlagen und Konten. Und als wir dennoch in den Krieg zogen und unsere Vianomae zu Tausenden in den Sümpfen von Vesuna starben, durchbohrt wurden von Pfeilen und im Moor versanken, war es Deiamo, der ein Kloster-Waisenhaus für alle Kinder bauen ließ, die ihre Väter verloren hatten. Das Kloster der Contessa Amovinci steht noch heute, und das Gemälde in der Ahnengalerie unseres Palazzos zeigte Deiamo auf der Treppe dieses Klosters, umringt von allen Kindern, für deren Wohl er sorgte.
Auf Deiamo folgte Destino, auch »der Stier« genannt, der eine so wichtige Rolle in der Verteidigung Navolas gegen Cheroux gespielt hatte. Auf seinem Gemälde in der Galerie sitzt er auf seinem Streitross Nero, der schwarze Bart von Grau durchwoben, die dunklen Augen funkelnd, das Schwert gezogen und zum Kampf bereit.
Destino handelte mit Münzen und Eisen, Flachs, Wolle und Leinen, Rüstungen und Waffen, Weizen, Gerste und Reis. Er errichtete Niederlassungen in weit entfernten Städten wie Villion und Bis, Hergard, Neft und Sottodun, und er wählte sorgfältig Vertreter aus, die diese Unternehmungen in unserem Namen führen würden. Destino war es, der mit der Banca Regulai aus dem alten Leinenviertel in einen prachtvollen neuen Palazzo umzog und erstmals als Archinomo einen Sitz in der Callendra einnahm.
Destino war nicht nur Krieger oder Kaufmann. Er war auch Kunstliebhaber und Naturfreund. Es war Destino, der den genialen Aragnallo mit der Gestaltung und dem Bau der wunderbaren Catredanto Maggiore auf dem Quadrazzo Amo betraute, wo alle namhaften Navoleser beteten, und er war es auch, der die Statuengärten rings um die Stadt stiftete, an denen sich bis heute alle Einwohner erfreuen können.
Und schließlich war da noch mein Vater, Devonaci di Regulai.
Mein Vater war weder so gütig wie Deiamo noch so tapfer wie Destino, wenngleich er beides durchaus in sich barg. Doch war er etwas ganz Besonderes, gesegnet mit einer fast schon überirdischen Intelligenz. Es hieß, er habe noch vor seinen zweiten Geburtstag angefangen, mit dem Abakus zu rechnen, und mit drei Jahren bereits Amonese Anciens geschrieben.
Brillant, scharfsinnig, wachsam, unermüdlich, unnachgiebig, furchtlos. Ich hörte, wie man ihm all diese Eigenschaften zusprach und noch so manche mehr. Ich vernahm sie von den Vianomae auf der Straße und von den Männern, die ihm in unserem Palazzo dienten, und alle sprachen sie mit Hochachtung von ihm.
Mein Vater dehnte das Geschäftsgebiet der Banca Regulai bis in die entlegensten Winkel aller Lande aus, wo man Amos Dialekte sprach und sogar darüber hinaus. Könige und Fürsten bettelten darum, an unserem Tisch zu speisen. Mein Vater war es, der Madrasalvo überredete, aus seiner Einsiedelei herabzusteigen, um den Bau der Catredanto zu vollenden, nachdem Aragnallo von seinem Schüler und Liebhaber vergiftet worden war. Madrasalvo bemalte die Kreuzgänge und Kuppeln der Catredanto ganz allein – ein Auftrag, der ihn zehn Jahre kostete und als sein größtes Werk gilt.
Mein Vater ernährte die Vianomae, als unsere Bauern in den Feldern an Scuros Pocken starben und die gesamte Ernte ausfiel, er sorgte auf unsere Kosten dafür, dass große Schiffe voller Weizen aus dem Reich der Khur nach Navola segelten, brachte die Schiffskapitäne dazu, an unserem verseuchten Hafen anzulegen und unsere Leute zu versorgen, indem er ihnen drohte, sie von allen künftigen Geschäften auszuschließen. Mein Vater blieb in unserer heimgesuchten Stadt, als andere Archinomi flohen, obwohl die Blaublüten ihn seine Frau kosteten, meine Mutter. Er errichtete für sie einen Schrein in der Catredanto Amo, wo man sie bis zum heutigen Tage finden kann.
Unser Name war Navola bis in die Grundfesten eingeschrieben; meine Ahnen hatten die Bauweise der Stadt beeinflusst, die gewundenen Straßen und schattigen Parks angelegt, viele davon benannt nach Vettern und Cousinen, Schwestern, Brüdern, Söhnen und Töchtern unseres Geschlechts. Via Gianna. Via Andretto. Giardina Stefana. Über Generationen hinweg hatten wir unseren Namen und unseren Einfluss ausgebaut.
In meiner Kindheit waren Banca Mercanta und der Name Regulai fast ein und dasselbe. Der Klang des Archinomo Regulai schallte weit über das Meer, die hakenförmige Ceruleische Halbinsel auf und ab, durch die Wüsten und die Steppen bis nach Zurom, Chat und Xim. Unser Name überquerte die gefrorenen Gipfel des Cielofrigo und gelangte bis zu den wilden Haarmännern des Nordens. Unsere Bevollmächtigten und Vertreter vergaben Darlehen, kauften und handelten, versicherten Schiffe und Waren, spionierten Herrscher aus, kauften Minen, verkauften Städte, und über allem stand mein Vater.
Aber wer war mein Vater wirklich?
Ich glaube, dass es sehr schwer ist, jemand anderen im tiefsten Herzen tatsächlich zu kennen. Was ich von ihm sah, war anders als das, was ein Münzverleiher im Quartiere Lana in ihm sah, seine Gefährtin Ashia oder selbst der Callarino von Navola persönlich.
Ich kann nicht für diese anderen sprechen. Ich kann nur sagen, dass er meiner Ansicht nach ein harter Mensch war, unerbittlich bei seinen Geschäften und unverbrüchlich in seinen Versprechen, zu mir jedoch war er stets gütig, und ich habe ihn sehr geliebt.
Außerdem würde ich sagen, dass er, obwohl er so mächtig war, diese Macht nie dazu einsetzte, andere zu demütigen. Er legte großen Wert darauf, Menschen ihren Stolz zu lassen, weshalb er höfliche Einigungen offenen Machtdemonstrationen vorzog. Er besaß die Versprechen vieler Männer, aber es war ihm nie danach gelegen, dass sie ihre Wangen an seinen Stiefeln schwärzten, nicht einmal, wenn er sie aufforderte, ihre Schwüre wieder einzulösen. Sfaccio, so nannte man es in der Umgangssprache Navolas – das Gesicht beschmutzen –, und mein Vater fand keinen Gefallen an derartiger Niedertracht. Er war nicht die Art Mensch, die grundlos das Sfaccire forderten, nicht einmal, wenn er durch Kleinlichkeit dazu gereizt wurde.
In jenen Kindheitstagen beispielsweise kam der Callarino oft in städtischen Angelegenheiten zu uns in den Palazzo. Im Gegensatz zu anderen Städten hatten wir in Navola keinen Fürsten oder König, der über uns herrschte. Stattdessen hatten wir einen Callarino. Gewählt wurde er von den Archinomi und den Vertretern der Handwerker- und Kaufmannsgilden: den Steinhauern, Ziegelbrennern, den Wollgenossenschaften, der Webergilde, der Hüttenarbeitergilde, den Oberhäuptern der Klöster und natürlich den Bezirksvertretern der verschiedenen Quartiere unserer Stadt sowie der Vianomae, die dort lebten. Einhundert Männer und manchmal auch Frauen, deren Aufgabe es war, die Geschäfte der Stadt zu leiten, mehr Republik als Monarchie, mit unserem Callarino an der Spitze.
Das Navola jener Tage war zivilisiert. Wir hatten nichts gemein mit dem brutalen Prinzipat von Gevazzoa, bewohnt vom Volk der Borragheser mit ihren Blutfehden und Racheintrigen. Wir waren klüger als das heißblütige Königreich Cheroux mit seinen waghalsigen Kriegen und seinem unersättlichen König Andreton. Und wir waren maßvoller und kultivierter als das Land Merai mit seinem Parl, der auf seinem wackligen Thron in der Roten Stadt saß und sich stets verzweifelt mühte, seine aufsässigen Verwandten in Schach zu halten. In Navola wählten die Hundert den Callarino in sein Amt, und mit ihrem Rat regierte dieser Mann umsichtig und weise. Borsini Amoforze Corso, der große Callarino von Navola, war von den Vielen auserkoren worden, und diente unserer Stadt zum Wohle aller.
Das jedenfalls sagten die Gelehrten, Geistlichen und Diplomaten.
Nun, wenn der Callarino eintraf, wurden wir nicht selten nur dadurch gewarnt, dass Merio, der Numerari meines Vaters, sich demonstrativ räusperte, denn der Callarino kam gern unangekündigt. Und er gehörte weder zu den Menschen, die geduldig warteten, noch zu jenen, die anderen grundlos ihre wertvolle Zeit opferten. Also pflegte Merio sich zu räuspern, und einen Moment später kam der Callarino schon in die Bibliothek gerauscht, als wäre es die eigene, stiefelte in seinem rot-goldenen Amtsgewand herein, so stolz und aufgeputzt, als prangte sein Name höchstselbst auf der Krone Amos.
Und was machte mein Vater?
Mein Vater sah einfach von seinen Schreiben auf, bot dem Callarino einen Stuhl an wie einem erwarteten und gern gesehenem Gast und bedeutete Merio mit einem Fingerzeig, rasch süßen Tee und bitteren Käse auftragen zu lassen.
So war mein Vater. Er war sanft, denn er besaß Macht.
Und so war der Callarino, denn er besaß keine.
Und dann, in einem Ringelreihen exquisiter Höflichkeiten, bat der Callarino – ohne explizit zu fragen – ihn um die Erlaubnis, sein eigenes Amtssiegel verwenden zu dürfen, das auf dem Schreibtisch meines Vaters stand; und mein Vater erlaubte ihm – ohne direkt einzuwilligen – dessen Verwendung.
So könnte der Callarino etwa sagen: »General Sivizza meint, die Waffen der Lupari seien stumpf.«
Worauf mein Vater dann erwidern würde: »Dies ist dem Stolz der Navolesischen Armee natürlich unwürdig. Auch unsere treuen Beschützer müssen beschützt werden. Sie brauchen Fleisch für ihre Leibeskraft sowie die schärfsten und besten Waffen für ihr Handwerk … und die Verheirateten unter ihnen zum Dank noch einen goldenen Navisoli. Der General und seine Wölfe sollen niemals das Gefühl bekommen, die Stadt wäre ihnen für ihren Schutz nicht dankbar.«
Also setzte der Callarino noch an Ort und Stelle einen Antrag für die Archinomi der Callendra auf – darunter viele, deren Versprechen mein Vater ebenso gesammelt und deren Wangen er gezeichnet hatte –, und der Callarino versah es mit seinem von roter Farbe triefenden Siegel, presste seinen Stempel mit einer Autorität aufs Pergament, die er nicht besaß, und schlug exakt jenen Betrag vor, den mein Vater zuvor genannt hatte. Und die Hundert Namen der Callendra würden darüber ab- und zustimmen, und mein Vater und andere Archinomi der Stadt würden die Steuern zahlen, die nötig waren, damit unsere Truppen allzeit in Bereitschaft waren.
Oder aber, der Callarino könnte sagen: »Die Borragheser haben einen Botschafter geschickt, und bieten an, mit uns Handel zu treiben.« Und mein Vater würde stirnrunzelnd erwidern: »Aber trauen wir Archinomo Borragha wirklich? Gevazzoa ist eine so hässliche Stadt. Populo Borragha, ein so heimtückisches Volk. Erst schmiegen sie ihre Wange an deinen Stiefel, und wenn sie aufstehen, um dir die Hand zu küssen, rammen sie dir ein Stiletto in die Rippen.« Und dann würde er ein Gesicht ziehen, als hätte er von einer Flasche schlechten Weines getrunken, womöglich einem dieser berüchtigt trüben Weine aus Gevazzoa, voller Schalen und Geläger.
In diesem Fall würde der Callarino das Thema fallen lassen und zu etwas anderem übergehen, wohl wissend, dass er keinerlei Befugnis hatte, weiter mit Archinomo Borragha zu verhandeln.
Oder aber der Callarino könnte sagen: »Der König von Cheroux möchte zwanzig Gelehrte schicken, die in den Universitätsarchiven Abschriften unseres Wissens auf den Gebieten der Banca Mercanta, Litigi und Numismatica anfertigen wollen, und würde dieses gegen deren Schriften über Architectura und Amonese Anciens tauschen.«
Und mein Vater würde antworten: »Gelehrsamkeit erhellt jedes Königreich, das sie erhält, mehr jedoch noch jenes, das sie teilt. Lasst die Gelehrten aus Cheroux anreisen, und die Lupari sollen ihnen sicheres Geleit gewähren, doch zuerst lasst Andretons Sohn zu uns kommen und auf mein Drachenauge schwören, dass er nie wieder einen Erbanspruch auf die Lande unserer guten Nachbarn in Pardi erhebt.«
All dies würde ich mitansehen, und später sollte Merio mir seelenruhig erklären, dass die Lupari von jenem Moment an, da mein Großvater sie im Krieg gegen Cheroux zum Treuebruch bewegt hatte, zu Navolas eiserner Faust geworden waren – Soldaten, die allein uns dienten und die für die Verteidigung unserer Interessen gut entlohnt wurden. Im Herzen jedoch waren sie Söldner geblieben. Sie waren zu uns übergelaufen, weil wir mehr bezahlt hatten. Was, wenn sie ein besseres Angebot erhalten sollten? Was, wenn man sie dazu bringen würde, abermals die Seiten zu wechseln? Was dann?
Die Archinomi von Navola zahlten gut, weshalb es die besten Kämpfer aller Lande Amos zu den Lupari zog. Doch waren diese Landsknechte für uns umso wertvoller, wenn sie sich in Navola Frauen nahmen und der Stadt so neue kleine Wölfe schenkten – denn dann waren sie nicht allein durch die Sonnen und Monde seiner Münzen an Navola gebunden, sondern durch ihr Blut. Dies war auch der Grund, weshalb mein Vater die Sonnen Navolas – Navisoli, unser Gold – an jene ausgab, die hier Familien gründeten. Er wollte die Compagni Militi Lupari an die Stadt binden, ihr eigenes Überleben mit dem der Stadt verknüpfen. Auf diese Weise ermutigte er die Wölfe nicht nur, für Geld zu kämpfen, sondern zugleich für das Überleben ihrer eigenen Namen und Geschlechter. Er wollte, dass sie Navoleser wurden.
So dachte mein Vater.
»Aber wieso muss der Prinz von Cheroux herkommen und auf das Drachenauge schwören?«, wollte ich wissen.
Merio zog die Brauen hoch. »Nun, weil man, wenn man einen Eid auf das Auge eines Dracchus schwört, an ihn gebunden ist, und er wird einen zu Asche verbrennen, wenn man ihn hintergeht. Ein Drachenauge schaut einem bis tief in die Seele.«
»Ist das wahr?«
Ich hatte damals große Ehrfurcht vor dem Auge und auch Angst. Beinahe so viel Angst, wie wenn Cazzetta in der Nähe war.
Merio zauste mir das Haar und lachte. »Ai, Davico, Ihr seid einfach zu vertrauensselig. Wie sollen wir Euch nur lehren, junger Prinzling, Eure aufrichtige Miene zu verbergen?« Er seufzte. »Nein, er wird Euch nicht zu Asche verbrennen, und nein, er blickt nicht in Eure Seele. Und doch bereitet es den Menschen große Angst, etwas zu berühren, das einst größer war als jeder Mensch, und wenn man einen Eid auf ein solches Artefakt schwört, spürt man es bis in die Knochen …« Merio erschauderte. »Man spürt es tief in seinem Inneren. Riten und Symbole sind genauso Teil des Versprechens eines Mannes wie sein Geldbeutel, sein Wolllager als Sicherheit oder ob seine Wange frei ist von den Stiefelspuren eines anderen. Wenn jemand das Drachenauge anrührt, beobachtet Euer Vater ihn, um zu sehen, ob er zittert. Um zu sehen, ob er zaudert. Um ein Stück weit in seine Seele zu blicken.«
Mit ernster Miene legte Merio einen Finger an sein Auge. »Es ist nicht der Drache, der mit dem Auge sieht, Davico. Es ist Euer Vater.«
Das beeindruckte mich sehr.
Der Geist der Navoleser ist ebenso verschlungen wie die Zöpfe in den Haaren ihrer Frauen.
Redensart, aufgezeichnet von Marcel Villou von Bis
Kapitel 3
»Ich will seinen Kopf! Ich will, dass man diesen Bettnässer in Stücke reißt, und ich will seinen Kopf auf einer Lanze aufgespießt vor der Callendra sehen!«
Die Stimme des Callarino hallte von den Wänden wider, als er durch die Bibliothekstür meines Vaters stürmte.
Ich war gewachsen, und wenn ich auch nicht groß war, dann zumindest groß genug, um an einem Tisch zu sitzen, ohne auf meinen Füßen zu hocken, und im Laufe der Zeit war ich, was meine Ausbildung betraf, aus Merios Obhut in jene meines Vaters übergegangen. Nun wurde oft von mir erwartet, neben ihm zu sitzen, wenn er in seiner Bibliothek arbeitete – parlobanco zu sitzen, wie wir sagen.
Es war ein alter Ausdruck, parlobanco, aus jener Zeit, als man sich bei sämtlichen Verhandlungen noch an einer groben, ungehobelten Planke gegenübersaß, auf der diverse Käsesorten, Tassen voll mit heißem, süßem Tee und Scheiben guten Rauchfleischs standen. Im Notfall genügte ein beliebiges Brett oder gar ein umgestürzter Stamm, selbst ein dreibeiniger Stuhl, wenn es denn sein musste; so lange nur ein wenig Holz und Essen zwischen den Verhandlungspartnern stand, entsprach alles den Gesetzen des Leggus.
Als der Callarino hereingestürzt kam, studierte ich jedenfalls gerade einen Schriftverkehr, den Vater mir gegeben hatte, um ihn hernach mit ihm zu diskutieren und zu lernen, wie sein Verstand arbeitete und wie er unsere Geschäfte führte. Die seltsamen Schreiben hatten mir gefallen, ich genoss das große knisternde Feuer im Kamin, Faulpelz’ leises Schnarchen, die zu meinen Füßen lag, die Wärme, die ich in der Gesellschaft meines Vaters empfand, während draußen ein kalter Winterregen an die Scheiben trommelte. Die Briefe waren wasserfleckig, die Tinte war verwischt, denn sie hatten eine beschwerliche Reise hinter sich, doch es hatte wohlige Gemütlichkeit geherrscht, bis die Bibliothekstüren aufflogen und kalten, klammen Wind und die rasende Wut des Callarino zu uns hineinließen.
»Ich will, dass die Hunde ihm die Eingeweide rausreißen, und ich will, dass all seine Pissioletto-Freunde dabei zusehen!«
Ich unterdrückte das Verlangen, mich unter den Schreibtisch meines Vaters zu verkriechen, wo Faulpelz – jäh wieder zum Leben erwacht – gerade schon verschwunden war. Ihr Fluchtversuch wirkte umso komischer, da sie mit den Jahren doch enorm gewachsen war und ihre langen Beine und ihr schlanker Körper nun in alle Richtungen unter dem Tisch hervorlugten. Sie war schon längst nicht mehr das kleine Knäuel von einem Welpen, das sie einst gewesen war.
Der Callarino warf Merio im Vorbeigehen seinen feuchten Winterumhang zu und stiefelte schnurstracks zum Kamin. Merio sah meinen Vater stirnrunzelnd an, sichtlich irritiert, so unverbrämt zum Kleiderständer degradiert zu werden, doch mein Vater bedeutete ihm mit einer besänftigenden Geste, zu gehen und den tropfnassen Umhang des Callarino mitzunehmen. Auch ich fasste dies als Aufforderung auf, das Zimmer zu verlassen, doch als ich mich erhob, legte mein Vater seine Hand beruhigend auf meine und gab mir mit einem Blick zu verstehen, dass ich bleiben und zuhören solle.
»Borsini«, sagte mein Vater. »Kommt schon. Ich nehme an, jemand behindert Euch in Eurer Amtsführung?«
Der Callarino reckte völlig selbstvergessen die Hände Richtung Feuer und rieb sich die Finger in der Wärme. »Der Hauch der Cerulea ist heute voller Eis. Die Kälte fährt mir in die Knochen.«
Mein Vater blinzelte mir zu. »Ist Euer Blut denn nicht hitzig genug, um Euch zu wärmen?«
Der Callarino drehte den Rücken zum Feuer und verzog angewidert das Gesicht. »Macht nur Eure Scherze. Doch auch Euch würde das Lachen rasch vergehen, wenn Tomas di Balcosi Euch einen Teller Scheiße vorsetzen würde.«
»Balcosi? Wirklich?«
»Glaubt Ihr mir nicht?«
»Ihr habt so viele Feinde, dass ich Mühe habe, den Überblick zu behalten.«
»Wie schön, dass ich Euch belustige.« Der Callarino wandte sich wieder dem Kamin zu. »Dieser Mann ist eine Viper in meinem Bett.« Er starrte in die Flammen, und sein Antlitz glühte so orange wie das eines Dämonen Scuros.
»Ich werde ihn vor den Augen all seiner Nomo-Anciens-Nobilii-Freunde auf dem Quadrazzo Amo in Stücke reißen lassen, das sollte ihnen eine Lehre sein.«
»Habt Ihr auch einen weniger spektakulären Vorschlag?«
»Ich kann ihn wohl kaum bei lebendigem Leibe verbrennen lassen. Zu dieser Jahreszeit ist das Holz einfach zu feucht. Nai. Es wird eine Enthauptung werden müssen. Sein Blut soll das Pflaster des Quadrazzo tränken, und seine Frau und Töchter werden mich um Gnade anwinseln.«
Erwärmt von dieser Rachephantasie kam der Callarino auf uns zu und fläzte sich in einen Stuhl gegenüber meinem Vater. Er ließ den Blick durch die Bibliothek schweifen. »Wo ist Euer Numerari geblieben? Der mit dem Käse?«
»Ihr habt ihm Euren Umhang gegeben.«
»Ach, habe ich das? Bringt er uns Tee?«
»Ich bin sicher, dass er die Küche von Eurer Ankunft unterrichtet hat«, erwiderte mein Vater trocken.
»Ihr könntet mir Cazzettas Dienste zur Verfügung stellen«, sagte der Callarino.
»Um Euch Tee zu bringen?«
»Scherzt nicht mit mir. Meintet Ihr nicht, Ihr hätten es gern weniger spektakulär? Cazzetta könnte sich in aller Stille um ihn kümmern. Ein Stiletto. In einer Seitengasse. Ein Tropfen Serpiixis in seinem Glas …«
Mein Vater funkelte den Callarino scharf an. »Eine üble Art zu sterben. Blut zu speien, ist nicht sonderlich diskret.« Er hob die Hand, um dem Callarino Einhalt zu gebieten. »Wie auch immer, Cazzetta steht ohnehin nicht zur Verfügung. Er hat einen Auftrag in der Ferne.«
Der Callarino schürzte die Lippen, enttäuscht, dass er Balcosi nicht Cazzettas mörderische Hingabe angedeihen lassen konnte. Er sah sich noch einmal in der Bibliothek um. »Bringt uns Euer Numerari denn auch Käse zum Tee?«
»Merio ist gut vertraut mit Euren Vorlieben. Er kann sich solche Einzelheiten ganz vorzüglich merken.«
»Dann sollte er Koch sein, kein Numerari. Hat man je von einem Numerari aus Pardi gehört? Ein Numerari sollte Navoleser sein. Die Leute aus Pardi können ja kaum ihre Schafe zählen.«
»Merio ist sehr gut in dem, was er tut.«
»Ich würde nie einen Pardineser einstellen. Das wäre ja, als würde ich einen Borragheser als Leibgarde verpflichten.« Der Blick des Callarino fiel auf mich, der ich neben meinem Vater saß. »Ai! Davico! Ich habe Euch gar nicht erkannt. Ich habe Euch für einen Scriveri gehalten, wie Ihr da am Schreibtisch sitzt. Wie erwachsen Ihr geworden seid!«
»Amo segne Euch, Patro Corso.« Ich verwendete die formelle Anrede, mit der ich hochrangige Männer grüßen sollte, wie es mir Aisha, der Gefährtin meines Vaters, stets befohlen hatte. Doch der Callarino winkte ab.
»Patro? Ihr nennt mich Patro wie einen Fremden? Ci. Ihr musst mich nicht so förmlich ansprechen. Nennt mich Onkel. Nennt mich Sio. Nennt mich den alten Borsini, und gut ist’s. Wir sind doch so gut wie verwandt. Solche Förmlichkeiten haben wir nicht nötig.«
Verdutzt schielte ich hinüber zu meinem Vater, doch der bot mir keine Hilfe an, also neigte ich respektvoll den Kopf und hielt mich weiterhin an Aishas Anweisungen. »Ja, Patro. Danke, Patro.«
Der Callarino schenkte mir ein breites Lächeln. »Ai! Ihr seid ein guter Junge.« Dann streckte er den Arm aus und zauste mit durchs Haar. »Ein guter respektvoller Junge. Und hochgeschossen wie Unkraut, seit ich Euch das letzte Mal gesehen habe.« Er musterte mich genauer. »Und jeden Tag werdet Ihr dem Vater ähnlicher.« Er blinzelte meinem Vater zu. »Es ist immer gut, einen Beweis zu sehen, dass ein Welpe auch der eigene ist, veri e vero?« Er lehnte sich zurück. »Ich habe meiner Dienerschaft befohlen, meine neue Frau Tag und Nacht zu überwachen. Bis sie schwanger ist, lasse ich sie nicht mehr aus den Augen.«
»Ich bin mir sicher, dass sie von Eurer Aufmerksamkeit überaus gerührt ist.«
»Gerührt oder nicht, ich werde mir jedenfalls keine Hörner aufsetzen lassen wie dieser Narr Pazziano.« Der Callarino blickte mürrisch drein. »Jedenfalls nicht noch einmal.«
»Ihr wisst bestimmt, was für Eure Frau am besten ist.«





























