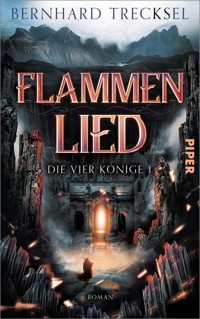6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Totenkaiser
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Clach, genannt »Totenkaiser«, ist ein Nebelmacher. Diese meisterlichen Assassinen töten im Dienste der Göttin des Mordens nicht nur den Körper, sondern können auch die Seele vernichten. Clach hat gerade einen Auftrag abgeschlossen, da erfährt er Ungeheuerliches: Seine Tötungen waren gar nicht von der Göttin sanktioniert – und damit wider ihr Gesetz! Clach macht sich auf die Jagd. Irgendjemand wird für diese Täuschung bezahlen. Doch der Totenkaiser ist längst selbst der Gejagte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Ähnliche
Bernhard Trecksel
Nebelmacher
Roman
Originalausgabe
1. Auflage
Juli 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen
der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Blanvalet Verlag,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz,
Inkcraft unter Verwendung einer Fotografie von Nico Fung
Karten: Jürgen Speh
Redaktion: Peter Thannisch
Lektorat: Holger Kappel
Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung, MünchenISBN 978-3-641-15587-2www.blanvalet.de
Was aber ist ein Nebelmacher, Mutter? Wiewohl die Welt doch schon voll Dunst, herrscht noch Bedarf nach ihresgleichen?
Schweig stille, Kind – sprich nicht den Namen aus! Sie sind die letzten ihrer Art! Aus einer Zeit, die längst musst weichen. Wüsst’ man sie zu finden, sie zu erkennen, die Scheite türmten sich – und Volk wär auf den Straßen, gefeiert würde und gesoffen, tanzen würden alle Beine – sechs Klafter hoch die Meiler, ihr unrein Fleisch rasch zu verbrennen, auf dass die Sonne wieder scheine!
Aus: Des Archons Niedergang – Theaterstück aus der Feder des Dramaturgen Thaen Sirrus, hingerichtet wegen volksverhetzender Reden, 520 adis Pentae
1. Clach
Die Herrin Pavosa Moreno war gerade einmal sechzehn Jahre alt, als sie starb. Bis zur Nacht ihres unrühmlichen Abgangs, an deren unausweichlichem Ende gleich zwei Lehren auf die Herrin warteten, war ihr Dasein stets nur von einem Prinzip geprägt gewesen: der unerschütterlichen Gewissheit, Herrin all dessen zu sein, das im Schatten der Loggia ihres Vaters lebte. Ihre Launenhaftigkeit und ihre Grausamkeit – Teil des famosen Erbes, das sie dereinst von ihrem Vater übernehmen würde – waren in diesem Teil von Argas geradezu legendär geworden, hatten sich verselbstständigt und dazu geführt, dass keiner der Menschen aus dem Viertel, egal, welchen Standes, auf die Straße ging, wenn Pavosa in ihrer Sänfte unterwegs war. Nur allzu gern befahl sie ihren Untergebenen, Passanten mit Schlägen zu malträtieren, ob diese nun den Weg rechtzeitig freimachten oder nicht. Passierte sie mit ihrem von einer Armada von Sklaven gewuchteten Gefährt die Stände von Marktschreiern, so sahen sich diese umringt von bulligen Eunuchen und der Gewissheit, um eine Vielzahl von Pasteten, Küchlein und anderer Köstlichkeiten erleichtert zu werden. Natürlich zu einem lächerlich niedrigen Vorzugspreis, falls die Herrin Moreno überhaupt je bezahlte, was ganz und gar von ihren Launen abhing. Während dann wütende, oftmals misshandelte Bürger hinter ihren Marktständen zurückblieben, geschundene Gesichter befühlten und gelockerte Zähne betasteten, wurde die junge Diva, gebettet auf samtenen Kissen und umhüllt von Seidenvorhängen, über das Kopfsteinpflaster getragen und vergrößerte ihren nicht unbeträchtlichen Leibesumfang mit den erbeuteten Naschereien.
Genau dieser Hang zu Backwerk und deftigen Happen war einer der Faktoren, die der Herrin Pavosa Moreno in dieser schwülwarmen Nacht zum Verhängnis werden sollten: Während ein Bagansa-Teppich aus edelstem Flor unter ihren teigigen Füßen nur so dahinflog und die gestrengen Gesichter ihrer Vorfahren auf den Ölschinken ihrer Dynastie vorbeirauschten, raste das verfettete Herz in Pavosas Brust und pumpte verkleisterten Sirup durch ihre Adern, die ein missliebiger Feuerteufel in Brand gesteckt zu haben schien. Ihre Lunge pfiff, Myriaden winziger Lichtpunkte tanzten vor ihren Augen ein Rondo, ragten in ihren Kopf hinein und rasten durch ihr fiebriges Gehirn. Die Welt war zu einem Tunnel geworden, dessen Ende – der rettende Ausgang – in unendlich weiter Ferne dieses Seitengangs der Loggia zu liegen schien. Sie hechelte wie ein Straßenköter mit Schwindsucht, pumpte Luft mit der Konsistenz von Rübensaft in ihre kreischende Lunge und mobilisierte sämtliche Kraftreserven ihres jugendlichen Körpers.
Sie senkte den Kopf und legte an Geschwindigkeit zu. Vor einigen Sekunden – die ihr vorkamen, als lägen sie Jahre zurück – hatte die Herrin Pavosa Moreno noch panisch um Hilfe geschrien, doch offenbar hatte niemand sie gehört. Keiner ihrer Diener kam ihr zu Hilfe. Sie war allein. Ein Schluchzer entrang sich ihrer Kehle, erklomm tapfer den Weg nach oben durch den rasenden Schmerz in ihrer Luftröhre. Wo sind nur alle? Wieso hilft mir keiner?
Die Tatsache, dass ihr niemand zu Hilfe kam, führte zur ersten Erkenntnis, die das Mädchen in dieser Nacht machen sollte: Sie war allein. Ganz allein. Nein, das stimmte so nicht ganz. Der Verfolger! Sie warf den Kopf herum, wobei einer ihrer Zöpfe ihr wie eine Bullenpeitsche ins Gesicht klatschte. Der Korridor war leer, Lüster an den getäfelten Wänden warfen unstete Schatten. Sie konnte es nicht fassen.
Sie wurde langsamer. Blieb stehen. Dann vernahm die Herrin Pavosa ein schnaubendes Lachen. Sie brauchte einige Sekunden, um zu begreifen, dass es ihr eigenes war. Sie lehnte sich an die Täfelung, brach in der Mitte ein. Sie war vollkommen ausgepumpt. Vorhin hatte Pavosa nur einen kurzen Blick auf ihren Verfolger werfen können, aber der hatte genügt, um zu wissen, warum er gekommen war. Der Mann – sie glaubte zumindest, dass es sich um einen handelte – war ein gedungener Mörder. Ein Attentäter. Die Herrin Pavosa mochte jung sein, doch unbeschlagen in den Wegen ihres Standes war sie nicht. Es hatte bereits einmal einen Anschlag auf ihr Leben gegeben, nur hatten ihre Leute damals kurzen Prozess mit der Meuchlerin gemacht. Pavosa hatte selbst befohlen, dass man den Kopf der Täterin salzen und dann auf eine Lanze am höchsten Türmchen des Palastes stecken sollte. Sie war sich damals sehr erwachsen vorgekommen in ihrer Rolle als Herrin über Leben und Tod.
Doch nun, während das Blut durch ihre Ohren rauschte wie ein Orkan, ihr Herz flatterte und der Schweiß ihr in Sturzbächen über den Körper rann, musste die Herrin Pavosa Moreno erkennen, dass sie nur ein Kind war. Schniefend und von einer Vielzahl im Widerstreit liegender Emotionen überflutet, starrte das Mädchen auf seine nackten Füße, die Hände noch immer an die weiß lasierten Holzplatten und ihren Stuck gepresst. Sie verharrte auch noch in dieser Haltung, als der Schatten auf sie fiel. Er kam von rechts, aus der Richtung, in die sie bisher geflüchtet war. Ein weiteres Schluchzen stahl sich über ihre bebenden Lippen, begleitet von einer weiteren Erkenntnis.
»Ihr wart die ganze Zeit hier, nicht wahr? Ihr habt mich gar nicht verfolgt?«, fragte sie.
Keine Antwort. Stoff raschelte. Ein seidiges Wispern, das klang, als würden sich die Leiber schwarzer Schlangen am Grund einer Grube aneinanderreiben. Er riecht nur nach Leder, fuhr es ihr durch den Kopf. Absurd. Er hat gar keinen richtigen Geruch. So als wäre er gar nicht wirklich hier … Er wird ja auch bald wieder fort sein. Wenn er fertig ist.
Es raschelte erneut. Er trat an sie heran. Sie presste die Augen fest zu, spürte seine Präsenz aber dadurch umso stärker. Aber noch stärker als die Furcht war die Stimme ihres Vaters. Ihres verhassten Erzeugers, der sie für ihre Feigheit und Schwäche verurteilte. Sie öffnete die Augen aus blankem Trotz. Trotz war etwas, worauf sie sich verstand. Pavosa blickte auf und sah ihren Verfolger vor sich. Eine mit Asche geschwärzte Lederrüstung mit passenden Arm- und Beinschienen. Kleidung, dunkler als die Nacht, die Konturen der Figur zerstreut von ihren Tränen und einem samtgrünen langen Umhang, dessen Kapuze hochgeschlagen war. Kaum erkennbar darunter die pechschwarzen, kurz geschnittenen Haare. Mehrere Tücher oder Schals verhüllten die untere Partie des Gesichts, darüber sah sie scharf geschnittene Wangenknochen, die dem Antlitz etwas von einem Milan oder einem anderen, noch grausameren Greifvogel verliehen. Die Augen waren wasserblau, schienen wie ihre zu schwimmen. Über dem linken verlief eine Messernarbe, die auf der Stirn begann und irgendwo unter den Schals vor seiner Mundpartie verschwand. Ihre Blicke begegneten sich. Pavosa ergriff das Wort:
»Wird es weht …« Weiter kam sie nicht. Ein scharfer, kalter Schmerz drang schlagartig und unerwartet in ihre Welt ein und füllte sie aus, wurde zu einem Schatten, einem allumfassenden Kosmos, der alles überlagerte. Die zweite Erkenntnis dieser Nacht brach über das Mädchen herein: Ich sterbe. Götter, ich sterbe. Eine Sturzflut panischer Ängste und widerstrebender Gefühle zerfetzte jeden klaren Gedanken. Sie hörte sich selbst einen blubbernden Laut ausstoßen, der unter anderen Umständen vielleicht sogar komisch gewesen wäre. Ihr Mund war urplötzlich voll mit einer warmen Flüssigkeit. Beiläufig registrierte sie, dass sie sich damit vollsabberte. Sie sickerte ihr über das Kinn auf die Brust, wo der Dolch steckte, den der Attentäter mit Wucht durch ihr Brustbein gerammt hatte. Obwohl ihr Mund voller Blut war, fühlte er sich grässlich trocken an. Sie roch verbrannte Haare, obwohl sie kein Feuer sah. Sie räusperte sich, verspritzte dabei karmesinrote Perlen. Sie glitzerten wie makellose kleine Rubine auf der Täfelung, fingen das tanzende Kerzenlicht ein. Ein unerträglich hoher Summton wie von tausenden Wespen war plötzlich in ihren Ohren, schwoll zu einem Dröhnen an, während die Kälte eines ungebändigten Schneesturms durch ihre Brust tobte. Sie räusperte sich noch mal. Und noch einmal. Es half nichts, ihre nasse Kehle blieb trocken.
»Nicht lange«, sagte der Mörder, und seine raue Stimme begleitete die Herrin Pavosa Moreno in die Dunkelheit.
Clach sah zu, wie der kleine Körper mit einem eigentümlichen Quietschen an der Täfelung herabsackte, an der er Schlieren hinterließ. Die Finger des Mädchens griffen ins Leere, die Augen rollten in ihren Höhlen. Dann bekam sie seinen Umhang zu fassen, krallte sich daran fest, und ein letztes Blubbern entrang ihrer Kehle. Clach ließ sich auf ein Knie neben dem Körper nieder und entzog seinen Umhang dem Griff der Sterbenden. Er holte einen kleinen Behälter aus Weidenruten hervor, in dem ein Spatz mit Sehnen fixiert war. Die Flügel waren gebrochen, eine Leistung, die selbst einem Mann mit Clachs geschickten Händen alles abverlangt hatte. Sechs der winzigen Tiere hatte er bei den Versuchen vorher getötet. Sie waren extrem filigran. Er hatte einen Raben verlangt – aus Pragmatismus und auch aus Gründen der Tradition –, aber in ganz Argas weigerten sich die Vogelhändler, die gefiederten Todesboten zu verkaufen. An Nachtigallen, Spatzen und Kolibris herrschte indes kein Mangel.
Man musste nehmen, was man bekam. Hätte es ein Leitmotiv für das Leben des jungen Mannes gegeben, den wenige in der Penta Fomor unter dem Ehrennamen »Totenkaiser« kannten, dann hätte es wohl gelautet: Man muss nehmen, was man kriegt.
Clach setzte sich im Schneidersitz neben das Mädchen. Ihr plumper kleiner Körper gab nun nur noch seltsam fiepende Laute von sich, die durchbohrte Brust hob und senkte sich unmerklich. Ein zufälliger Beobachter hätte angenommen, dem Attentäter wäre ein grausamer Fehler unterlaufen oder Clach ein Sadist. Aber dem war nicht so. Clach wusste genau, was er tat. Immer. Und er ließ niemanden unnötig leiden.
Er schlug die Kapuze zurück und zog die Tücher nach unten, die bisher die untere Hälfte seines Gesichts verborgen hatten. Dann besah er sich sein Opfer genauer. Die Augen der jungen Frau zuckten immer noch hin und her, doch sie war längst über den Punkt hinaus, wo sie noch etwas spürte. Der erste Dolch hatte sich sauber durch die Drosselgrube ihres Brustbeins gebohrt, während der andere seinen Weg zwischen ihre vierte und fünfte Rippe hindurchgefunden hatte, um die Apex ihres Herzens zu öffnen. Beide Waffen waren mit dem Gift der Culcisviper bestrichen, das eine lähmende Wirkung auf die Nerven entfaltete und zugleich die Blutgerinnung verhinderte. Mit dem Eintritt der Waffen in diese beiden neuralgischen Punkte ihres Körpers war ihr Leiden vorbei gewesen, bevor es begonnen hatte. Ihr Bauchraum war bereits voller Blut, das Gehirn war schlagartig unterversorgt worden. Sie litten niemals, wenn er tötete. Das war sein Credo, und deshalb war er der Beste.
Der Brustkorb hob und senkte sich nicht mehr. Aus dem stillen Monolog ihrer bebenden Lippen und dem leisen Räusperkonzert war ein letzter Seufzer geworden, in dem nichts als Frieden lag. Clach konzentrierte sich. Er intonierte die uralten Formeln. Arkane Worte aus einer Zeit vor dem Krieg der Erzmagi, lange bevor die Titanen gefallen waren.
»Thian! Aigh! Thian! Brolgh!«
Er selbst verstand die Worte nicht, kannte ihre Bedeutung nicht. Er kannte nur den Effekt: Die Kerzen im Korridor flackerten in seine Richtung, ihr Schein wurde merklich schwächer.
»Thian! Hestaigh Slairne!«
Der Spatz erwachte plötzlich aus seiner Starre. Er spürte, was bevorstand. Bäumte sich auf, sprengte die Schnur, die seinen Schnabel fixierte, und piepte vor Schmerz und Angst. Die Bleiglasfenster auf dem ganzen Korridor klirrten leise in ihren Fassungen, Kristalllüster an der Decke wisperten.
»Thian! Astrobh ’ni Sleed!«
Flüstern und Raunen erfüllten den Gang, als Clachs Erbe erwachte. Ein widerwärtiger Gestank nach verbrannter Milch und süßlichem Marzipan erfüllte den Flur. Clachs Herz begann zu rasen. Seine Sicht verschwamm. Ein dumpfer Schmerz breitete sich links unter seinem Brustbein und knapp unter seinem Hals aus, während die Welt dunkler zu werden schien.
»Thian!«
Clach spürte es mehr, als dass er es sah: Etwas geschah mit dem Körper der Herrin Pavosa. Eine ephemere, unfassliche Kraft schien ihr zu entweichen. Ohne Gewicht, ohne Zwänge, befreit von den irdischen Ketten. Bereit, aufzusteigen zum Firmament, den Göttern entgegen, um eins zu werden mit der Ewigkeit und dem Licht …
Es war ein kurzer Flug. Nachdem er das letzte Wort intoniert hatte, sog der Totenkaiser die Luft ein. Urplötzlich war sein Mund bis zum Bersten gefüllt, eine pulsende, endlose Kraft, die sich wie Eisfeuer in sein Fleisch brannte. Nun war er nicht mehr Clach. Er war Clach-Pavosa. Er/sie spürte ihre/seine Verwirrung, als sie von innen gegen seinen/ihren Mund drängte wie ein eingekerkertes Tier. Der Teil von ihm, der Clach war, gab ihrem Ansinnen nach. Er griff nach dem Behälter, spitzte die Lippen und blies. Der Vogel fiepte panisch. Nach drei weiteren Lidschlägen war es vorüber. Clach stellte den Behälter mit dem Spatz auf den Boden. Er fühlte sich in jeder Hinsicht leer, ausgepumpt. Die Welt war grau, das Licht ohne Kraft, die Luft frei von Gerüchen. Dennoch schnupperte er. Blase und Darm des Mädchens hatten sich hörbar entleert, aber nun roch die Luft nach gar nichts, schien keine Temperatur und keine Konsistenz zu haben. Sie war da. Und das war auch schon alles. Weder kalt noch warm. Er war erfolgreich gewesen. Wie so oft. Der Tempel würde erfreut sein. Nicht dass ihm das etwas bedeutete. Er spürte, wie sich bereits Unzufriedenheit in ihm regte, weil die Jagd so kurz, die Beute so unwürdig gewesen war.
Mit einer schnellen Geste der Klarheit reinigte er seinen Geist, bevor ihn das unerwünschte Gefühl verunreinigen konnte. Er zog die Dolche aus der Leiche, stand ohne Hast auf und griff nach dem Behälter. Der Spatz lag nun still. Seine Augen stierten in die Ferne, und über seinem Blick lag ein eigentümlicher Schleier. Clach befestigte den Behälter an seinem Gürtel und schob die blutigen Dolche in die mit Gift und Öl getränkten Scheiden. Dann schlich er durch die herrschaftlichen Korridore und Säle des Palastes und hinab ins Untergeschoss. Vorbei an schlafenden Wächtern, wobei er mit routinierten Bewegungen die Blasrohrpfeile aus Hälsen, Nacken und Armbeugen zog und sie in einer Röhre an seinem Gürtel verschwinden ließ.
Durch eines der zahllosen Fenster an der Westseite des Gebäudes schwang er sich nach draußen. Er kam im taunassen Gras auf. Der Prunkgarten lag still, umfriedet von hohen Ligusterbüschen und einer Wehrmauer. Es duftete nach den Orangenbäumen, die in voller Blüte standen. Der Morgen dämmerte bereits, das Licht der Sonne blinzelte durch die Arkanistenkuppel über der Stadt. Bald würde sie über den Nebeln stehen.
Clach griff in ein Gebüsch, zog das Wachstuch hervor mit seiner mitgebrachten Straßenkleidung und zog sich ohne Hast um. Kapuzenumhang, Lederrüstung und Handschuhe wichen einem einfachen Schnürhemd und Samthosen, die Dolche einem Rapier. Mit einem letzten Blick auf seine Stiefel und das Fensterbrett vergewisserte sich Clach, dass er keine unerwünschten Blutspuren hinterlassen hatte. Dann räusperte er sich, lockerte seine Muskeln, schulterte sein Ränzlein und entspannte seine Miene. Ein Lächeln umspielte strichdünne Lippen, als aus dem Totenkaiser ein anderer Mann zu werden schien, dessen Haltung und Gesicht die gesamte Arroganz des argasischen Landadels widerspiegelten. In der Nacht war Clach als Todesbote in dieses Heim gekommen – nun, da der neue Morgen dräute, verließ er es als Arentias, ein Duellist und Adelssproß, der lange als Geisel des Archonten von Fomor gelebt hatte. Nicht dass es einer komplexeren Hintergrundgeschichte seiner Maske bedurft hätte, aber Clach liebte diesen Teil der Jagd. Dennoch gestattete er sich erst ein Schmunzeln, als er die Grenzen der Anlage durch ihr Haupttor verlassen hatte.
Er schritt am Wachhabenden in seiner Laube vorbei, der gerade fluchend und mit unerklärlich starken Kopfschmerzen erwachte und sich hastig von dem hohen Herren abwandte, der da seines Weges ging. Sein Fußweg durch die verwinkelten Gassen und über die marmornen Terrassen von Argas führte Clach an Palmgewächsen und reich verzierten Springbrunnen vorbei. Um diese Uhrzeit waren nur Handwerker, armes Volk und betrunkene Matrosen unterwegs – und keiner von ihnen war erpicht darauf, einem verwöhnten Sohn aus gutem Hause mit einer flinken Klinge über den Weg zu laufen. So achtete auch niemand darauf, als Clach in einer Gasse neben einer Schlachterei Halt machte.
Er öffnete den Behälter. Augenblicklich gab der Spatz ein seltsames, alles andere als melodiöses Tschilpen von sich, das auf befremdliche Weise wie Schreie klang. Eine seltsame, verängstigte Intelligenz war in seine Vogelaugen getreten. Sanft griff Clach in den Käfig und legte den gefesselten Vogel mit einer ebenso sanften Bewegung auf den Abfalltonnen ab. Was dann kam, war nur noch Makulatur. Aber es musste auf natürliche Weise passieren, das war Teil des Rituals. Der Totenkaiser blickte sich um. Neugierig beäugte eine Meute zerzauster, brutal aussehender Straßenkatzen sein Tun. Als er die Gasse verließ, ging das Zwitschern des Spatzen im Geschrei kämpfender Vierbeiner unter.
Aus den Chroniken des Kataklysmus der Erzmagi, verfasst dreihundert Jahresläufe nach dem Titanensturm, Anonymus:
… am Ende waren es fünf, die dem Kataklysmus getrotzt hatten. Fünf, die zum Leid der Völker auszogen zu bestimmen, wer der Mächtigste sei, erwählt, das Fleisch zurückzulassen und aufzusteigen in das strahlende Pantheon – wiedergeboren als Gott unter Göttern. Und unter den Völkern erhob sich ein großes Klagen, denn der Krieg der Fünf hatte derart gewütet, dass mehr Tote niederlagen, als es Sterne am Himmel gibt, und ihr Blut hatte die Flüsse rot gefärbt. Aber die Fünf kannten kein Mitleid mit den Völkern, und so kam es, dass sie in ihrem Hochmut an den Grundfesten der Schöpfung rührten. Und siehe, sie erhoben die Pentae, die letzten der Titanen. Und sie banden sie mit kalter Rune und glühendem Stahl und hießen sie, ihre Festungen zu tragen. So wanderten die Pentae über die Welt, zu ihren Füßen, die die Gebeine der Erde waren, herrschte ein Gewimmel wie von Ameisen. Es waren die Krieger der Fünf, und ihre Zahl war Legion. So kam es, dass die Fünf auf den Feldern des einst fruchtbaren Reiches Aehve zusammentrafen zur letzten Schlacht. Einhundert Tage und einhundert Nächte lang tobte die Schlacht, Mann gegen Mann, Titan gegen Titan. Ungerührt vom Leid, das sie gebracht hatten, standen die Fünf in den höchsten Türmen ihrer Festen und schleuderten Zauber um Zauber. Berg um Berg ward gespalten, Meer um Meer verdampfte. Die Leichen türmten sich so hoch, dass sie den Mond berührten. Und am Ende gingen die Pentae auseinander, ein jeder für sich tödlich getroffen, und wanderten zum Sterben in die Welt, die nun nichts denn Karst und Nebel war …
Hora des Lichtfürsten, 301 adis Pentae.
2. Ormgair
Nebel. Der Nebel war überall. Seit der Zeit, von der die Seher nur noch in den Raunächten sprachen, wenn die Feuer höher loderten, sich die Stammesmitglieder um die Flammen und die Ältesten scharten und die Toten mit den Baen’sidhe durch das Firmament ritten und klagten, gab es den Nebel. Dann erklangen die Geschichten vom Großen Krieg – und wie nach seinem Ende vom Großteil der Weltenscheibe, die einst ein Paradies gewesen war, nicht mehr als eine verkarstete Wüstenei geblieben war, die beständig im Nebel ertrank. Die weichen Stadtlinge nannten die Welt seitdem die Dämmerwelt und verkrochen sich unter der Hexerei ihrer Kuppeln und meterdicken Mauern. Die Mitglieder vom Stamm der Tanleigh hingegen nannten das wilde Land, das sie bewohnten, den Amboss. Jeder, gleich ob Weib oder Balg, Krieger oder Ältester, wurde auf diesem Altar geschmiedet. Die Würdigen passten sich an. Sie wurden in dieser Hölle aus Nebel, Fels und beständigen Kämpfen gegen die feindlichen Stämme um knappe Ressourcen geformt. Die Schwachen zerbrachen auf diesem Amboss. Ihre Knochen ließ man bleichen, wo das Fleisch gefallen war, während ihre Seelen und ihre Taten ins Vergessen stürzten.
Ormgair spie aus. Er hatte dem Land seiner Vorväter über fünfzig Winter abgetrotzt und dabei das Kunststück vollbracht, weder zu den glorreichen Ahnen zu zählen, noch als Ältester zu leben. Wobei jene, die ihn kannten, den Unterschied in der Nomenklatur zwischen Krieger und Ältestem bei Ormgair vor allem einer Tatsache zuschrieben: Die Krieger, die es gewagt hatten, den alten Kundschafter mit Floskeln wie »erwürdiger Alter« oder »geehrter Ältester«‚ anzusprechen, hatten ihr Blut auf Tisch und Bank gespien, Ormgairs Dolch in den Därmen oder seine Bartaxt zwischen den Augen.
Nun stand der Mann, der nach den Maßstäben seiner eigenen Kultur bereits ein Greis war (und der sich, wenn er ehrlich war, auch manchmal so fühlte), auf einer von sporadisch verkrüppeltem Heidekraut und Disteln bewachsenen Felsnadel und ließ den Blick über das endlose Meer zu seinen Füßen schweifen. Es war ein guter Tag, das Grau schwappte heute nur so dicht wie der Rauch von nassem Holz, sodass man aus der Höhe einen Steinwurf weit zu spähen vermochte. Leichte Windböen zerfaserten es hier und da, rissen Löcher in das Gewebe, das nie die Haut tränkte, nie das Atmen erschwerte, so wie es der Nebel in den Legenden der Vorväter früher angeblich getan hatte. Der Geruch von Heidekraut und alten Feuern begleitete das Flüstern der Böen.
Ormgair fügte dem Dunst etwas Feuchtigkeit hinzu, indem er ausspie. Hätte jemand den Nebeljäger zu fragen gewagt, womit er sich sein hohes Alter erklärte, hätte ihm Ormgair vielleicht auseinandergesetzt, dass er regelmäßig die Gifte eines alten Leibes aus seinem Körper spie. Und dass er auf seine Zähne achtgab. Fragte man Ormgair, dann verreckten die Alten vor allem aus zwei Gründen: weil ihr Genörgel die Jungen in den Wahnsinn trieb, und weil sie das, was sie fraßen, nicht mehr kauen konnten.
Er selbst war für sein Alter in bemerkenswerter Verfassung. Und man sah es. Statt wie die meisten Tanleigh massig und breitschultrig, hatte Ormgair mehr von einem der Wölfe seiner Heimat: eine ausgezehrte Gestalt, gekleidet in ein gebeuteltes Kettenhemd und einen löchrigen Kilt mit einem Tartan. Knochige Schultern, von einem nachtblauen Tuchumhang nebst Pelzkragen verhüllt, dessen beste Tage schon zu Zeiten von Ormgairs Vater vorbei gewesen waren. Silberne Fibeln, die wie springende Berglöwen gearbeitet waren, hielten das zerrissene Relikt, angelaufen und geschwärzt. Ein einfacher Kurzbogen aus verleimtem Horn nebst Köcher und eine schartige Bartaxt verrieten Ormgairs Profession. Das Gesicht des Barbaren glich der Landschaft, die ihn umgab, eine perfekte Imitation aus Narbenhügeln und Faltentälern, in die wie zwei Bergseen Augen von einem solchen Grau eingebettet waren, dass man sie kaum vom umgebenden Nebel unterscheiden konnte.
Wie die Wurzeln uralter Bäume baumelte sein zu vier Zöpfen geflochtener aschgrauer Bart bis auf die Brust, der Schädel war, abgesehen von einem daumendicken Haarstreifen, dem Zeichen der Kriegerwürde, kahl. Zwei Karstlöwen sprangen über von Feindeshand vernarbte Ohren, die ausgestreckten Pranken an den Schläfen endend. Die Hautbilder seines Totemtieres waren Ormgair mit großer Kunstfertigkeit von einem der Schamanen gestochen worden, als er als junger Krieger wegen seiner untrüglichen Sinne zum Nebeljäger der Tanleigh erwählt worden war.
Der Karstlöwe war ein einsamer Jäger, der seine Beute oft tagelang zum reinen Vergnügen beschlich. Er war äußerst mürrisch, im Nebel nahezu unsichtbar und tötete sein Ziel mit nur einem Prankenhieb oder Biss. Die Weibchen lebten in Rudeln und pflegten die Jungtiere, die Männchen aber streiften einsam und übel gelaunt durch die kargen Landstriche ihrer Heimat.
Nicht nur in jener einzigartigen sozialen Hinsicht glich Ormgair diesen Bestien. Auch er hatte Beute gewittert und beschlich sie. Und eben diese Beute hatte die Felsnadel überquert, auf der er nun stand. Er hatte ihre Spuren mit der gleichen Klarheit gelesen, wie ein Gelehrter der Stadtlinge es mit seinen Büchern tun mochte. Es waren zehn. Und es waren Kreen. Diesen Verdacht hatte Ormgair bestätigt, als er letzte Nacht keine zwei Schritte entfernt von ihren schlafenden Körpern auf dem Bauch in ihrem Lager gelegen hatte. Sie hatten Wachen aufgestellt, und zehn feindliche Krieger waren durchaus eine Macht, der sich ein Mann in Ormgairs Alter und Lage nur unter einer Bedingung gestellt hätte: wenn Zeugen zugegen gewesen wären, die hernach von seinem glorreichen Tod berichteten, damit er am Firmament den Wind reiten konnte.
Doch Ormgair kämpfte stets allein, und die Kreen hatten das Land der Tanleigh heimgesucht. Ihre Gespräche am Feuer ergaben keinen Aufschluss darüber, was sie innerhalb der Grenzen des Ambosses gesucht hatten. Und so hatte der Nebeljäger beschlossen, seinerseits auf den Spuren der Bande in ihre Heimat vorzudringen. Sicher, er hätte seinen Stamm verständigen können, es wäre sogar seine Aufgabe gewesen, dies zu tun. Aber Ormgairs Zeit lief ab. Und er wusste es.
Zwar barst seine eigene Legende förmlich vor würdigen Kämpfen, doch seine unwirsche und einzelgängerische Art sorgte seit den kurzen Tagen seiner Kindheit dafür, dass Ormgair der Respekt versagt blieb, den er verdiente. Er hatte sich – von unbefriedigenden kleinen Episoden mal abgesehen – nie ein Weib genommen, keine Söhne gezeugt. Die wenigsten seiner Taten waren je von anderen Kriegern bezeugt worden, und so ungern es sich der Nebeljäger eingestand, die Meinung der anderen Stammesmitglieder war ausschlaggebend, wenn auch nur, um die Baen’sidhe zu überzeugen, das Feuer seiner Seele mit hinaufzutragen aus dem Nebel und an das Firmament. Dorthin, wo die Nachkommen der Titanen ihre endlosen Kämpfe führten. Dort, wo die Feuer ihrer Heerlager auf dem Nachtgewand der Titanenmutter erstrahlten, wo Krieg und ruhmreiche Taten niemals ein Ende fanden. Ormgair würde sich einen Platz an der Seite der Helden seines Volkes verdienen. Er würde dort oben sitzen, an ewigen Feuern, an denen kein Mangel an gebratenem Fleisch war. Er würde den Skech trinken, Geschichten erzählen und Männer töten, die nur starben, um sich am nächsten Tag wieder zu erheben und weiter zum Wohlgefallen der Titanen zu kämpfen und schließlich einer der ihren zu werden, so wie die Ahnen der Tanleigh es im Großen Krieg geplant hatten.
Man würde dereinst Lieder über ihn singen. Lieder wie über die Männer, an deren Seite er nach dem Tode streiten würde. Männer wie Gaul, den Schlächter. Oder Yngvei, der in grauer Vorzeit fünf Riesen mit nur einem Streich hingestreckt hatte. Krieger wie Ioiain, der schon als Knabe einen Säbeltiger eingeritten und den Wassertitanen Altus unter den Tisch gesoffen hatte. Ormgair Steinviper würde nicht vergessen werden. Seine Knochen würden nicht vergessen im Nebelmeer vor sich hin bleichen, von Viehzeug zernagt. Dafür würde er Sorge tragen.
Was immer diese Kreen geplant hatten, er würde es nicht nur herausfinden, sondern vereiteln. Und er würde einen von ihnen mit heimbringen, damit der Hund bei den Titanen schwor und bezeugte, was Ormgair vollbracht hatte.
Ein wölfisches Grinsen stahl sich auf des Barbaren Gesicht, gelbe Zähne blitzten.
Die Flucht seiner Feinde – denn nichts anderes war ihr Auszug aus den Ländern der Tanleigh – dauerte zwei weitere Tage und führte durch das Fußland der Krallenberge. Eine zerklüftete, von Rissen und Verwerfungen durchzogene Landschaft, in der das Purpur der Heide einen seltsamen Farbkontrast zum endlosen Zwielichtgrau des Nebels und dem Braun der Krüppeldisteln beschrieb. Wann immer der Nebel in Bodennähe aufriss, gab er den Blick frei auf Wildpfade. Knochen von Mensch und Getier ragten hier und dort aus dem Boden, verschlungen von der Erde, die Fleisch fraß und Blut soff. Die Landschaft wurde mit jeder Stunde lebensfeindlicher und Ormgair noch vorsichtiger als gewöhnlich. Er wusste, was es für ihn bedeuten würde, wenn er sich den Fuß in einem Morastloch brach. Inmitten einer solchen Umgebung wie dieser Heide war es gleich, ob er sich auf Feindesland befand. Die Räuber und Aasfresser hätten ihn abgenagt, bevor die Kreen überhaupt merkten, dass sie verfolgt wurden.
Je tiefer sie in Kreen-Land vordrangen, die Stimmen der Feinde stets als raue Echos vor Ormgair, desto feuchter wurde der Untergrund und umso mehr nahm die Zahl der Knochen zu, die den Boden bedeckten. Der Nebeljäger musste bereits mit großer Vorsicht zu Werke gehen, wollte er die Feinde nicht auf sich aufmerksam machen. Die Kreen hatten diese Probleme nicht, das Knirschen von Knochen, die von Lederstiefeln zermalmt wurden, war ihr steter Begleiter. Die Luft roch unangenehm, eine Mischung aus Schwefel und süßlicher Fäulnis, die gleich dem Wasser im Inneren einer aufgeblähten Leiche vor sich hin gärte. Die Luft stand, schien den Atem anzuhalten. Ormgair gestand es sich ungern ein, doch ihn fröstelte.
Er hatte Gerüchte über die Lichheide und das dahinter liegende Blutmoor gehört. Im Großen Krieg war dies eines der wichtigsten Schlachtfelder gewesen. Ein wimmelnder Ozean aus Kriegern hatte zu Füßen der Titanen gefochten, als diese Himmel und Erde spalteten. Zehntausende hatten ihren letzten Odem in den Boden gehaucht, der ihr Blut getrunken hatte, als wäre es süßer Skech, bis selbst sein endloser Durst gestillt war. Zurückgeblieben waren nur die Heide und das Moor.
Jede Blüte war die Seele eines Toten, dem ein Ritt ans Firmament versagt geblieben war, das Wasser des Moores hingegen das Blut, das nicht versickern wollte. Der Ort galt den Tanleigh als verflucht. Ormgair, der zeitlebens allein an den seltsamsten Orten und gegen Bestien gekämpft hatte, gestand es sich nur ungern ein, aber er konnte nachvollziehen, warum. Aber es war zu spät. Er war zu tief vorgedrungen, um noch zu kapitulieren.
Mit vor Misstrauen zusammengekniffenen Augen setzte er einen Fuß vor den anderen, stieg behutsam über moosige Schädel, die teilnahmslos zu ihm heraufgrinsten. In einer Augenhöhle stierte ein Laufkäfer aus Facettenaugen zu ihm empor, einen zuckenden Regenwurm in den vor Gift triefenden Mandibeln. Der Harnisch des Insekts schimmerte wie eine Öllache. Als Ormgairs Schatten sich auf die Szenerie legte, zerrte der tödliche Ritter seine Beute in die Finsternis im Inneren des Schädels. Der Kreislauf von Leben und Sterben, vollzogen im kleinsten Maßstab.
Ormgair zog die Nase hoch. Er hätte am liebsten ausgespien, angewidert von der Unabänderlichkeit der Dinge. Er würde nicht der Wurm sein. Er würde nicht sterben, zur Beute des Lebens werden, bevor er gehandelt hatte.
Er merkte kaum, dass sich seine Hände um den Griff seines Schlachtbeils legten und er die Waffe zog. Solcherart folgte er seiner Beute. Ein Karstlöwe mit nur einem einzigen tödlichen Fang.
Die Luft war mittlerweile noch kälter geworden. Der Abend kündigte sich an. Das Land hatte deutlich mehr von einem Sumpf als einer Heide. Die Schatten missgestalteter Bäume und ihrer zerfetzten Ruinen erhoben sich aus dem Untergrund wie die Klauen der Untoten in den Legenden. Weiden, den Schatten riesiger Spinnen gleichend, wiegten sich leise hin und her. Der Boden gab hier und dort ein leichtes Blubbern von sich, blähte sich, spie Wolken stinkender Gase aus. Es roch nach faulenden Eiern. Der Nebel waberte gelblich und war teils so dicht, dass Ormgair die Hände zum Gesicht ziehen musste, um sie zu sehen. Etwas, das er gern vermieden hätte. Es war, als schlösse sich ein Käfig um jeden einzelnen Zoll seiner Handknochen, dessen Inneres aus rotglühenden Nadeln bestand.
Ormgair gab ein unhörbares Winseln von sich. Es war, als zöge man ihm die Knochenhaut ab. Ormgair Steinviper wurde klar, dass er auf seiner selbst auferlegten Mission eine Sache unterschätzt hatte: sein Gebrechen. Im Dorf wusste nur Skjorn davon, der Seher. Es wurde mit jedem Winter schlimmer, aber Heilkräuter und die Trockenheit des Amboss’ verhinderten, dass die Symptome seiner alten Knochen ihn überwältigten. Hier aber, knapp eine Woche strammen Marsches vom Dorf entfernt und der klammen Luft des Sumpfes ausgeliefert, biss sein Leiden urplötzlich und mit aller Macht zu.
Es hatte in den Händen begonnen, doch auch die anderen Gelenke folgten nach überraschend kurzer Zeit. Der Nebeljäger murmelte Schutzsprüche zu den Titanen, auch wenn solche Bettelei vergeblich und würdelos war. Es brachte nichts: Minuten nachdem das peinvolle Gewitter in seinen Händen seinen Anfang genommen hatte, folgten die Knie und Hüften dem Aufruf zur Rebellion. Als hätte ein sadistischer Kobold glühende Sandkörner in seine Gelenke gespritzt, die gnadenlos zwischen den sich bewegenden Knochen schmirgelten und bissen. Es waren Qualen, die einem weniger abgehärteten Mann als dem Nebeljäger Tränen in die Augen getrieben hätten. Ormgair knirschte mit den Zähnen. Er verschloss seinen Geist so gut er konnte vor den Schmerzen, folgte seiner Beute weiter. Unbeirrbar.
Die Dunkelheit kam nahezu unvermittelt. Es wurde fast schlagartig dunkel. Ormgair hörte, wie die Kreen mit bärbeißigen Stimmen sprachen. Er verstand ihre verfluchte Zunge nur zum Teil, konnte aber auch so erkennen, dass sie frotzelten. Er hörte, wie sie im dunklen Zwielicht Äste vom Totholz brachen und zusammentrugen. Sie würden für die Nacht rasten. Das war einerseits gut, aber andererseits nahm es ihm den Fokus, den Kitzel der Jagd.
Sein Körper signalisierte ihm nur Augenblicke später, was er von Müßiggang und Stillstand in der feuchten Luft hielt. Diesmal taten die Schmerzen es der Nacht gleich: Sie waren schlagartig wieder da. Ormgair stieß ein scharfes Zischen aus, als schartige Glasscherben seine Gelenkknochen zu häuten schienen. Er gab ein hündisches, unkriegerisches Winseln von sich und verfluchte sich noch in derselben Sekunde. Nicht nur, weil es ihn verraten konnte, sondern vor allem auch, weil er diesen Zustand als würdelos empfand.
Die Schmerzen zwangen ihn in die Knie, eine Bewegung, die sein alternder Körper ihm mit weiteren Qualen vergalt. Er atmete tief durch und ertrug es. So verharrte er, ohne ein Gefühl für die Zeit, die dabei verstrich. Langsame, kontrollierte Atemzüge, bei denen er betont gegen seine gespitzten Lippen blies, sowie sanft rollende Bewegungen jedes einzelnen Gelenks dämpften den Schmerz nach einer Weile, die eine Minute oder ein Äon gewesen sein mochte, auf ein gerade so erträgliches Maß.
Er schlug die Augen auf, hockte auf protestierenden Knien inmitten wabernder, wattedicker Nebelfetzen und horchte auf sein rasendes Herz. Es war das einzige Geräusch in dieser Nacht. Ansonsten war es vollkommen still geworden. Die Luft waberte, aber es gab keinen Wind. Er hörte keinen Nachtvogel. Kein Insekt sang in der eisigen Luft. Nichts.
Ormgairs Kopf flog förmlich herum, und sein Blick stieß dorthin, wo sein untrüglicher Orientierungssinn die Feinde vermutete.
Kein Schimmer eines Feuers durchdrang den Nebel. Keine Stimmen erklangen. Sie mussten weitergezogen sein, während er wie ein Balg an der Zitze hier gelegen und sein Schicksal beklagt hatte. Der Nebeljäger der Tanleigh, der wie ein altes Weib greinte. Nur weil er zu schwach und zu alt geworden war, um Schmerz und Leid wie ein aufrechter Mann zu begegnen. Mit einer solchen Legende würde er wohl kaum als einer der Helden zum Firmament hinaufgeführt werden. Mit einer solchen Legende konnte ein Mann froh sein, wenn er irgendwo in der Wildnis verreckte. Vergessen und …
Der Gedanke riss unvermittelt ab, und der Instinkt übernahm. Es war nur eine Ahnung aus jenen urzeitlichen Tiefen, in denen der zivilisierte Mensch sein inneres Tier begrub. Aber Ormgair war ein Tanleigh, und Tiere standen seiner von Krieg und Mord erfüllten Natur näher als die Menschen.
Er warf sich zur Seite und stieß dabei einen gequälten Laut aus, als die grellen Wachfeuer in seinen Gebeinen zu neuem Leben erwachten. Zwanzig Zoll kalter Stahl zuckten wie ein Blitz durch die Dunkelheit, spalteten den Nebel und den Baumstumpf, gegen den sich der Nebeljäger gelehnt hatte. Späne flirrten durch das urplötzlich von Fackeln überstrahlte Geschehen. Sie gingen in der diesigen Finsternis auf wie Miniatursonnen, ihr Licht fraß sich in seine Augen.
Ormgair zückte sein Beil, noch während er sich ungelenk abrollte. Sein Hieb peitschte nach der Stelle, wo er den Arm des Angreifers vermutete. Dieser musste noch immer damit beschäftigt sein, seine Waffe aus dem Griff des Baumstumpfes zu lösen. Ein schwerer Rückschlag in seiner Waffenhand, begleitet von einem Aufschrei und einem knorpeligen Knirschlaut, verriet ihm, dass er etwas getroffen hatte. Er beschirmte die Augen mit der freien Linken. Um ihn herum loderten Fackeln.
Ein junger Krieger in Fellrüstung lag zu seinen Füßen und stieß einen gellenden Schrei aus. Das milchige Blau des Knochens, von Ormgairs Axt aus dem bebenden Fleisch seines zerstörten Ellenbogens geschält, hatte im Schattentanz der Fackeln etwas Unwirkliches.
Sie gönnten ihm keine Atempause und schon gar keine Zeit, seine Augen an das Licht zu gewöhnen. Durch gespreizte Finger sah er Schemen, Stahl in den Fäusten und Stahl auf ihren Oberkörpern. Äxte, Lang- und Breitschwerter. Einige schienen Rundschilde zu tragen, in deren Schutz sie Saxe und andere Kurzschwerter mit erhobenen Schultern aufpflanzten. Er hörte, wie weiter hinten einer von ihnen einen Pfeil auf die Sehne nockte.
Das war es also. Die Kreen hatten ihn auf ihrem Boden ertappt. Auf verfluchtem Land. Aber er wollte verdammt sein, wenn er sich unter Wert verkaufte.
Er roch das Blut des Knaben, den er zum Krüppel geschlagen hatte. In der Ferne donnerte es, und es flackerte am Himmel. Mit jedem Blitz, der jenseits des Nebelozeans durch das Firmament kochte, pulste neuer Schmerz durch seine Gebeine. Gut. Es mochte zwar kein Sterblicher zugegen sein, um seinen würdigen Tod zu bezeugen.
»Zumindest die Titanen werden sehen, wie ich euch Hunden die Herzen aus der Brust schneide!«, röhrte Ormgair und stürmte los. In vollem Lauf rammte er sein Knie in das Gesicht des wimmernden Knaben. Der Schmerz war unbeschreiblich, aber das Töten auch unendlich befriedigend.
Mit einem scharfen Knacken schnellte der Schädel des Kreen zurück, sein Genick grub sich in den Baumstumpf – und in einen holzigen Astrest, der wie die Parodie einer Zunge aus dem Mund des Sterbenden austrat.
Die anderen Gegner ließen ihm keine Zeit für weitere Überraschungsangriffe. Sie umkreisten ihn, einer Meute Wölfe gleich, die einen verwundeten, alten Puma gestellt hatte. Und sie unterschätzten ihn.
Noch immer geblendet, schwang Ormgair sein Beil im Kreis, um seine Gegner auf Abstand zu halten. Ein scharfer Schmerz schoss durch seinen Oberschenkel, als ein Speer sein Ziel fand. Der Nebeljäger biss die Zähne zusammen. Die Pein war geradezu lachhaft, verglichen mit den Teufeln in seinen Knochen. Sein Gegner, der Ormgairs Laut falsch auslegte, verließ den schützenden Blendring der Fackeln, um sich aus einem besseren Winkel in den Speer stemmen zu können und den alten Barbaren so in die Knie zu zwingen. Ein tödlicher Fehler. Und sein letzter. Er hielt respektvollen Abstand zur Axt, merkte aber zu spät, wie Ormgairs beschirmende Linke zum Gürtel herabfuhr. Der Scout riss seinen Dolch aus der Scheide und ließ ihn blitzartig vorschnellen. Er spürte einen weichen Widerstand, gefolgt von einem Aufschrei und trügerischer Härte – dann war es vorbei. Sein Gegner ging zu Boden, wälzte sich einige Sekunden, während blutiger Schaum aus seinem Mund quoll. Dann lag er still, Ormgairs Andenken ragte aus dem, was vom Augapfel übrig war. Eine klare Flüssigkeit mit der Konsistenz von Eidotter und Blut sammelte sich wie Sickerwasser um den Griff der Klinge, an der Hirnmasse vorbeischäumte, als wäre sie von Eigenleben erfüllt. Der Mund des Sterbenden öffnete und schloss sich. Ein Karpfen, den man an Land geworfen hatte.
Die anderen schlossen den Kreis um den Nebeljäger. Ormgair, der seine Gegner wieder sehen konnte, ging in Verteidigungsstellung – eine lächerliche Geste, die nur der Wahrung seines eigenen Stolzes diente. Als sie sich brüllend auf ihn warfen, schrie auch er aus voller Kehle, katapultierte seinen Körper, der nur noch aus rasendem Blut und dumpfen Schmerzen zu bestehen schien, nach vorn. Sein Beil fand ein Gesicht. Es biss. Es trank. Dann spürte er, wie die Waffen seiner Feinde ihr Ziel erreichten. Dumpfe Einschläge, taub und rostig. Zu spät merkte er, dass sie es nicht darauf abgesehen hatten, ihn zu töten. Als ihn etwas Schweres an der Schläfe traf, wich die Kraft aus seinen Beinen. Die Welt fiel zur Seite. Einer der Feinde stand an einer Wand, die sich urplötzlich neben ihm aus dem Boden erhoben zu haben schien.
»… muss wohl … hingefallen … sein …«, raunte der Nebeljäger. Seine Lippen schmeckten brackiges Wasser. Er roch die Erde und all die toten Dinge, die seit Äonen in ihr moderten, während sein Bewusstsein auf wattigen Dünsten davonzutreiben schien.
Der Kreen, der über ihm stand, bleckte die Zähne, wandte sich zu seinen Kameraden und blaffte etwas, das Ormgair kaum verstand, weil das Blut in seinen Ohren rauschte. Ein Wasserfall, der mitten durch jeden klaren Gedanken fuhr. Er grinste. Kicherte debil. Eine letzte Verhöhnung seiner Erzfeinde. Oder einfach nur sein fiebriges Hirn? Alles einerlei.
Da hob der Krieger über ihm sein Schwert und schlug zu.
Finsternis senkte sich über Ormgairs Welt, bis es kein Quäntchen Licht mehr gab.
Und Ormgair fiel.
Aus den Chroniken des Kataklysmus der Erzmagi, verfasst dreihundert Jahresläufe nach dem Titanensturm, Anonymus:
Doch lange, nachdem die drei Unterlegenen tödlich getroffen zurückkrochen, um abseits der Schlacht zu verenden, ihre erzmagischen Peiniger ausgebrannt vom Konflikt mit ihren Feinden, waren es noch zwei, die standen, wo Zehntausende gefallen waren. Zwei mit Wunden ohne Zahl und dem Willen, die Schlacht zu entscheiden. Hier stand Argas, dessen Fleisch war wie das Feuer und die flüssigen Steine, die da in der Erde sind, und sein Odem war der Tod und sein Kopf der Kopf eines Drachen. Seine Zitadelle war solcherart errichtet, wie sie im tiefen Süden bauen: Verkrustet mit kunstvollen Türmchen und Minaretten war sie, eingebettet in Wäldern aus Palmen und Zypressen, die von der Hitze seines Fleisches gespeist wuchsen – ein glitzernder Palast aus Gold und Lapis, gekommen aus einem fernen und unbekannten Reich, den der Titan tausendfach tausend Meilen getragen hatte, im Namen des Magiersultans Abid’Masr.
Und dort stand Fomor, dessen Fleisch und Gebeine gehauen waren aus den Bergen dieses unseres Landes Aehve. Tannenwälder ohne Zahl waren auf ihm und Steine. Und er war Bär und Wolf und aller Fels dieser Welt. Vier Arme hatte er, jeder so lang, wie die breitesten Flüsse sind. Und auf seinen Schultern ruhte die mächtigste Feste, die das Land je gesehen hatte, und auf ihren Mauern aus Granit und Stahl stand Vortigern, der Tyrann von Khael. Und so standen sie sich gegenüber, und nichts würde mehr so sein, wie es war.
Hora des Lichtfürsten, 301 adis Pentae.
3. Morven
Es gab Menschen, die behaupteten, dass man in Panzerhandschuhen weniger spürte. Dass man durch das kalte Metall, das Innenfutter und wattierte Polster kaum etwas ertasten konnte. Dass man maximal den Griff eines Schwertes oder die Zügel eines Streitrosses als eine Art Gegendruck wahrzunehmen vermochte. Morven hätte diesen Menschen gern etwas anderes erzählt. Sie kniete in diesem Moment auf Marmor, der weißer war als die Unschuld selbst. Den Blick starr zu Boden gerichtet, blickte sie auf ihre Finger, die umschlossen von gepanzerten Scharnieren auf dem endlosen Weiß ruhten. Sie wirkten fremd. Wie sprungbereite tückische Insekten. Dabei waren es ihre eigenen Hände. Es mochte mit dem Flimmern in Morvens Blick zu tun haben. Mit all dem Wasser. All dem Zorn, der sich in ihren Augen in Bächen gesammelt hatte und die Welt verschwimmen ließ. Hier kniete sie. Spiegelte sich im Marmor, auf dem das Licht der unzähligen Laternen tanzte, die das Sanktum in ein orangerotes Glühen tauchten. Eine Templerin des Lichtfürsten. Eine Kriegerin durch und durch, kampferprobt und schwertgeweiht. Gewandet in ihre kostbare Brünne, in Panzerschienen und schlohweiße Roben, die auf geschickte Weise mit der Rüstung zu einem perfekten, makellosen Ganzen verbunden waren. Auf der Brust prangte die stilisierte, von zwei Händen gehaltene Fackelsonne des Lichtfürsten. Eine stattliche junge Frau mit rabenschwarzen, mittellangen Haaren und Augen, so unergründlich wie Gletscherspalten. Sie wusste, dass sie keine klassische Schönheit war. Dafür war ihre Nase einen Tick zu scharf gekrümmt, der Körper einen Tick zu muskulös und die Lippen im Kontrast einen Tick zu voll. Ich bin einen Tick zu sehr die Tochter meines Vaters. Zu stolz. Dieser verdammte Stolz! Sie knirschte hörbar mit den Zähnen.
»Morven! Habt Ihr Eure Aufgabe verstanden?« Die Stimme war so hart wie Adamant, jede Spur von Mitgefühl oder Verständnis durch ein ganzes Leben des Tempeldienstes beseitigt. Abgeschliffen.
Morven blinzelte die Tränen der Wut und der Schande weg. Zumindest versuchte sie es. Langsam, kontrolliert hob sie den Blick. Sah zur Hochmeisterin ihres Ordens auf.
Malvine ragte vor dem Hochaltar des Lichtfürsten auf wie ein Fels, vollbrachte das Kunststück, selbst zwischen den Beinen der Monumentalstatue des Gottes größer auszusehen als das Standbild. Alles an ihr verlangte ihrem Gegenüber Respekt ab. Eine Frau, die siebzig Winter gesehen und überlebt hatte – und die nach wie vor an jedem Morgen im Solar die bleiche Sonne auf schmerzenden Knien begrüßte, um ihre gepeinigte, vernarbte Hülle danach rüsten zu lassen, als wäre sie keine Greisin, sondern noch immer eine junge Kriegerin.
Morven verehrte die Hochmeisterin. Umgekehrt war sie sich nie sicher: Malvine schien nicht zu lieben, nichts zu verehren außer dem Lichtfürsten. Sie war das perfekte Vorbild. Eine heilige Streiterin, die ihr ganzes Leben in den Dienst der Sache gestellt hatte. Ohne Zweifel. Ohne Fehl.
Musste sie auch durchmachen, was ich durchmachen muss? Musste sie ihre eigene Würde verkaufen? O Lichtfürst, ich erflehe demütig eine Antwort! Wann, o Lichtfürst, wann wird die Illusion enden und mein Leben den Kurs einschlagen, den ich selbst vorgebe?
»Templerin Morven!«
Diesmal war Malvines Stimme ein Fallbeil.
»Ich habe gehört, Hochmeisterin.« Morvens eigene, gehauchte Stimme konnte mit ihrem dunklen Timbre nicht den kalten Zorn verschleiern, der ihr Herz rasen ließ.
»Das sehe ich. Aber habt Ihr auch verstanden?«
»Ich verstehe, dass der Auftrag wichtig ist, den Ihr mir gebt. Ich verstehe, dass er von höchster Bedeutung für die Kirche ist, Hochmeisterin. Aber ich verstehe auch, dass er ein Politikum ist. Eine Schmähung meiner persönlichen Ehre, geeignet, die Aufmerksamkeit meines Vaters zu erregen, um mich auf diese Weise …«
»Genug! Eure persönlichen Wehwehchen müssen zurückstehen, Templerin Morven! Der Mann ist von Stand, und wir müssen uns den Realitäten beugen – der Adel füllt unsere Säckel! Blickt Euch um!«
»Herrin, seht Ihr nicht, dass diese … diese Bitte nichts mit der Kirche zu tun hat? Der Mann hat so viel Geld, er könnte auch eine Armee an Mietlingen bezahlen. Stattdessen will er nur eine Templerin. Eine. Und die soll ausgerechnet ich sein?«
Malvines Stimme und Gesicht wurden sanfter. »Kind, ich sehe, welche Probleme euch dieser Auftrag bereitet. Wähnt mich nicht blind oder gar verschlossenen Herzens. Ich weiß natürlich, dass Falcatt ein Emporkömmling ist, der um die Aufmerksamkeit Eures Vaters ringt. Ganz Fomor tut dies. Er ist schließlich der Archont. Aber Ihr geht in einer Sache fehl: Ihr denkt, Ihr wäret noch seine Tochter – und das macht Euch angreifbar. Doch Ihr tragt nun seit sieben Wintern das Habit. Der Lichtfürst ist Euer Vater. Fleischliche Verbindungen sind ohne Belang, streift sie ab.«
Mit diesen Worten war die Audienz beendet gewesen. Es war beschlossene Sache: Morven würde Baron Falcatt am kommenden Morgen ihre Aufwartung machen und ihn einige Tage bei ausgedehnten Besuchen in der Penta begleiten. Der Adelsspross würde aus der Sicherheit der Oberstadt herabsteigen, um Zunfthäuser und Gelehrte persönlich aufzusuchen. Warum er in Fomor, der Penta, in der der Adel derart verhasst war, ein solches Risiko einging, blieb Morven jedoch unbegreiflich.
Ihr Atem kondensierte stoßweise in kleinen Wölkchen, während sie ihre Runden über die Wehrmauern der Ordensfeste lief. Die Wut hatte in den letzten Stunden nicht nachgelassen – im Gegenteil, der Zorn über ihr ungerechtes Los nagte in ihren Eingeweiden. Ein bösartiges Wiesel, das sich verbissen hatte und ihre Gedanken nicht mehr freigab. Sie hatte deswegen keinen Schlaf finden können, war aufgestanden und hatte sich eine Tunika für einen Dauerlauf übergeworfen. Bald würde sich die Sonne erheben und der Tag ihrer Schande anbrechen.
Malvine wusste nicht, dass Morven Falcatt aus den Tagen ihrer Jugend und auch aus späteren Audienzen an der Seite des Archonten kannte. Er war ein ebenso geckenhafter wie grausamer Mann, der keine Gelegenheit ausließ, sich andere zum Feind zu machen. Ginge es ihm nur darum, Morven zu entwürdigen, er hätte andere Mittel und Wege gehabt. Nein, es war offenkundig, dass er ihre entfernte Bekanntschaft nutzen wollte, um das Gehör des Archonten zu finden.
Viel Glück. Selbst als er mich noch nicht in den Tempeldienst verhökert hat, hatte Vater keine Zeit für mich. Ich sehe den Mann nur noch alle paar Jahre, und dann behandelt er mich wie jede andere Untertanin auch.
Sie wandte sich den Zinnen zu, um den Sonnenaufgang zu betrachten, wobei sie abwechselnd die Füße gegen das leicht erhöhte Innere einer Schießscharte stemmte, um ihre übersäuerten, schmerzenden Muskeln zu dehnen. Sie blickte in die Tiefe. Hundert Fuß unter ihr erwachte die Burg langsam zum Leben, winzige Gestalten glitten im trüben Licht des Morgens über den Hof.
Morven verzog grimmig das Gesicht. Sie brauchte kaltes Wasser, dann musste sie sich rüsten. In doppelter Hinsicht. Wenn Falcatt sie als Leibwächterin wollte, sollte er seinen Willen haben. Aber beim Lichtfürsten, er würde keine Freude daran finden.
»Wir beide werden eine Menge Spaß miteinander haben, Templerin.« Falcatt thronte auf seinem gepolsterten Lehnstuhl – ein hohlwangiger und viel zu blasser Mann in Morvens Alter, der mehr Ähnlichkeit mit einem Reptil als mit einem Menschen hatte. Ein Reptil, das irgendein Narr in vierzig Pfund Brokat und Gold gekleidet hatte.
Vor Morvens geistigem Auge machten sich Bilder breit. Ein Tritt gegen eines der Schwanenhalsbeine des Stuhls. Falcatt, der zu Boden ging. Morven, die das abgetrennte Stuhlbein mit Wucht auf den Schädel des jungen Barons niederfahren ließ. Sie schüttelte den Kopf eine Spur zu vehement, um die alles andere als unerwünschten Gedanken zu zerstreuen. Lichtfürst, schenke deiner Dienerin Langmut und Zuversicht.
»Habe ich etwas Falsches gesagt?«, fragte Falcatt. Er vollbrachte das Kunststück, ehrlich besorgt zu wirken.
»Nein … nein, das ist es nicht«, log Morven. »Ich bin nur etwas verwundert. Über Eure Wahl, M’lord. Ein Mann Eures Standes, Eures Vermögens könnte doch problemlos hundert fähige Krieger anheuern. Ihr aber vertraut auf eine einzige Templerin des Lichtfürsten. Mich würde interessieren, warum?«
Ein süffisantes Lächeln huschte über Falcatts Gesicht. So flüchtig, dass Morven sich anschließend fragte, ob es überhaupt da gewesen war.
»Sagen wir einfach, ich habe meinen Glauben gefunden.« Falcatt griff nach einem Dekanter und goss sich mit überraschender Eigenständigkeit Wein ein.
Er bot auch ihr Wein an, doch Morven hob abwehrend die Hand. »Danke. Nicht im Dienst.«
»Endet Euer Dienst auch einmal, Templerin Morven? Kennt Euer Leben auch Freuden, die nicht im Gebet liegen? Oder in profanen Dingen wie dem Klingenspiel? Es gibt andere Spiele, müsst Ihr wissen.«
Ihr entging die Anspielung nicht. Nicht dass sie es nicht gewöhnt gewesen wäre. Als Frau im vollen Ornat einer Kriegerpriesterin war sie es gewohnt, dass Männer ihre Muskeln spielen ließen und sie herausforderten. Sie beschloss, Falcatt nicht den Gefallen zu erweisen, auf seine plumpen Versuche einzugehen.
»M’Lord, was ist so wichtig, dass Ihr einen Besuch der Gemeinenviertel erwägt, noch dazu nur mit einer einzigen Leibwächterin?«
»Ihr fürchtet ein Politikum, nicht wahr, meine Liebe? Ihr müsst annehmen, es ginge um die Gunst des Archonten.«
War sie so durchschaubar? Der Mann war ein Geck, aber offenbar kein Idiot.
»Wenn Ihr mich nicht wegen meiner Verwandtschaft zum Archonten ausgesucht habt und Euch keine politischen Interessen bewegen, was ist dann der Grund?«
»Templerin, mit Verlaub, das geht Euch nichts an. Die Kirche hat Euch für diese Aufgabe freigestellt, ich habe einen nicht unwesentlichen Betrag für Eure Dienste gezahlt.« Er erhob sich, und ein unangenehmer Ausdruck trat in seine Augen. Das Reptil war nie fort gewesen. Es hatte sich nur versteckt. »Nun werdet Ihr brav sein. Tun, was ich sage. Und mein Leben verteidigen. Nicht dass ich mit Anschlägen auf meine Person rechnen würde, wenn ich lediglich einige Bekannte besuche und ein paar Geschäfte tätige.«
Morven durchbohrte Falcatt mit ihrem Blick, spießte ihn förmlich an seinen Thron. Ihre Kiefermuskeln arbeiteten. Doch sie sagte kein Wort, sondern verneigte sich lediglich.
»Haltet Euch bereit, Templerin, wir brechen in einer Stunde auf!«
Wenn es einen tieferen Sinn hinter Falcatts Geschäftsreise durch die bürgerlichen Viertel der Penta Fomor gab, so erschloss er sich Morven nicht. Sie hatten auf Falcatts mondänem Anwesen eine Kutsche bestiegen und waren dann in die eigentliche Penta herabgefahren. Wie alle Pentae war auch Fomor die Zusammenballung einer Unzahl schäbiger Fachwerkhäuser, ringförmig umschlossen von trutzigen, mehr als zweihundert Fuß hohen Wehrmauern. Die Viertel des Adels und der Zünfte bildeten gemeinsam mit dem Palast des Archonten eine Anhöhe im Stadtzentrum. Unzählige rotgeschindelte Spitztürme und Festungsanlagen, eine Nabe aus schwarzem Stein in der Mitte eines Rades aus Armut und Überbevölkerung. Legionen dämonisch grinsender Wasserspeier stierten auf das Elend tief zu ihren Pranken. Über allem spannte sich der Nebelschild der Arkanistengilde, eine gigantische Kuppel aus milchigem Halbschimmer.
Vor Jahren, als Morven noch jünger gewesen war, hatte sie den Archonten bei einem seiner sowohl seltenen als auch gefährlichen Ausflüge zur Penta Argas begleitet. Bei ihrer Rückkehr, umgeben von der Sicherheit eines ganzen Heeres und ausgestattet mit Nebelsteinen, hatte Morvens Vater einen Vorhang im Inneren des Achtspänners beiseite gezogen. Er hatte ihr die Stadt von einer Anhöhe aus gezeigt und war die Viertel mit dem Finger abgefahren wie auf einer Landkarte. Nach dem strahlenden Glanz und dem protzigen Reichtum von Argas war Morven Fomor wie die schäbigste Schneekugel der Welt vorgekommen. Ein schwarzes Ding wie aus einem düsteren Märchen, voller Stacheln und eingefroren in einer Kugel aus eitergelbem Milchglas.
Nun rollten sie über die Plateaustraßen, aus denen sich Fomors mittlere Ebene zusammensetzte. Obschon hier wohlhabende Bürgerhäuser und das eine oder andere feine Geschäft standen, waren die Probleme der Penta bereits in einer solchen Gegend unleugbar. Das Kopfsteinpflaster war beschädigt, abgemagerte Straßenköter und andere Tiere wühlten in Abfallhaufen, wo man nur hinsah. Die ostentativ verzierte Kutsche passierte einen Tiefbrunnen, und Morven sah, dass einige gut ausgerüstete Söldner der Eisernen Kompanie in der Nähe standen und darauf achteten, wer sich vom knappen Wasser nahm. Einige rostbraune Flecken auf dem Kopfsteinpflaster, an denen Sägemehl haftete, legten nahe, dass nicht jeder dazu befugt war. Gut betuchte Reisende ließen sich in Sänften oder einfacheren Kutschen fahren. Selbst jene, die zu Fuß unterwegs waren, hatten zumindest Personal dabei, das vor ihnen mit speziellen Besen den Unrat aus geleerten Nachttöpfen entfernte.
Morven seufzte. Wie lange noch, bis der Hunger diesmal nach der Penta greifen würde? Das zweite Jahresdrittel näherte sich dem Ende. Bald würde der Eisenwinter seine Klauen in den Kontinent schlagen.
Das Geschaukel der Kutsche ließ ihre Gedanken davontreiben, lullte sie ein. Sie legte ihren Kopf gegen das Glas der Scheibe, während ihr Blick über die Welt außerhalb der Kutsche glitt. Sie hatte keine Ahnung, wohin sie unterwegs waren, und wenn sie ehrlich war, interessierte es sie auch nicht. Dies war bereits der fünfte Weg, den sie durch das Viertel nahmen. Falcatt war bislang viermal ausgestiegen und hatte sie zum Haus eines Bekannten mitgenommen, wo sie jedes Mal die gleichen ungläubigen Blicke erntete, wenn Falcatt sie als seine Leibschützerin vorstellte. Dann hatte sie gewartet, während der Baron hinter verschlossenen Türen seine »Geschäfte« tätigte. Raues Gelächter war dahinter zu hören, und wenn er schließlich herauskam, roch er Mal um Mal stärker nach Branntwein.
Als die Kutsche abrupt hielt, riss es Morven aus ihren Gedanken. Sie wandte sich zu Falcatt. »Wie lange noch? Wie viele dieser Besuche noch, M’lord? Die Kutsche ist viel zu auffällig, mittlerweile dürfte jeder gesehen haben, dass Ihr im Viertel seid.«
»Gut, gut! Darauf baue ich! Dies ist der letzte Termin. Danach sind wir fertig, Ihr könnt mich dann nach Hause geleiten und seid offiziell entlassen. Aber seid unbesorgt, meine Liebe: Ich werde der Hochmeisterin berichten, dass ich sehr zufrieden mit Euren Diensten war.« Er lächelte.
Morven war verblüfft, wie ehrlich es aussah. Sosehr sie sich auch anstrengte, sie konnte keine Spur von Spott oder Häme in diesem Lächeln ausmachen. Keinen Versuch, sie zu manipulieren. Und den Archonten hatte Falcatt in der ganzen Zeit nicht einmal erwähnt.
Sie entspannte sich etwas. Ihre Barrieren sanken. Was auch immer sie erwartet hatte, was an diesem Tag geschehen würde, es war nicht eingetroffen. Sie öffnete die Tür des Achtspänners und stieg aus. Sie hatten vor einem Herrenhaus gehalten, dessen Prunk schon vor Jahrzehnten verblasst war.
Sie ging auf Falcatt zu, der auf der dem Haus zugewandten Seite der Kutsche den Sitz seiner Kleidung prüfte und sich durch die Haare fuhr. Er wandte sich ihr zu und lächelte noch immer.
Das war der Moment, als Morven über Falcatts Schulter hinweg die Bewegung in der Gasse sah. Und begriff, dass sie zu langsam sein würde.
Aus den Chroniken des Kataklysmus der Erzmagi, verfasst dreihundert Jahresläufe nach dem Titanensturm, Anonymus:
Und siehe, zu der Stunde, da wahrhaft alles verloren schien, tat sich der Himmel auf. Und Sturmtosen und Kriegsgeschrei verstummten, da die Welt selbst in ihren Todeswehen zitterte. Und die letzten beiden der Fünf hielten inne, wie auch ihre titanischen Vasallen.
Alles in der Schöpfung, ob lebend oder tot, blickte zum Firmament empor. Und eine Lanze aus Licht, groß wie hundert Säulen, fuhr zwischen die Kämpfer und trennte sie. In diesem Moment fuhr ER wie ein Blitz vom Himmel nieder und wandte sich gegen die letzten der Fünf, die an SEINEM Firmament gerührt und SEINE Geduld herausgefordert hatten. Doch groß war ihre Macht, und in ihrem Wahn setzten sie sich zur Wehr gegen IHN. Und sie verschlangen SEIN Licht, wie die Schlange die Maus verschlingt, und fraßen sich fett daran, bis SEIN Glanz durch ihr Fleisch glühte und die Sonne blass wurde.
Und als sie solcherart gemästet waren in SEINEM Glanz, da verlachte ER sie und sprach ein Wort, und SEINE Herrlichkeit fegte sie vom Angesicht der Welt. Und ihre Titanen brachen zusammen, wiewohl sie hinfielen wie Tote und sich nur wenig regten. Da sprach ER ein weiteres Wort, und auf Erden war ein Heulen und Zähneklappern, denn ER ließ uns im Dunkel der kommenden Tage zurück. Seit diesen Tagen errichten wir IHM wieder Tempel, wie es vor Äonen, vor den Tagen der Gottesmörder geschehen war. Und wir heißen IHN den Lichtfürsten oder den Leidenden Stern – unseren Erlöser und Verdammer.
Hora des Lichtfürsten, 301 adis Pentae.
4. Greskegard
Was macht sie da drinnen? Solange er auch darüber nachdachte, eine Antwort auf seine Frage entzog sich ihm. Für wirklich ernsthafte Geschäfte war ihr Aufenthalt im Mund des Toten zu kurz. Vielleicht hat sie etwas zwischen seinen Zähnen entdeckt? Etwas, das sie … reizt? Er beobachtete fasziniert, wie die Fliege zum dritten Mal in nicht einmal fünf Minuten auf den blassblauen Lippen landete. Eier legt sie nicht. Oder? Naturkundler müsste man sein. Das Insekt bewegte sich einige Sekunden lang in erratischen Mustern über die erstarrte Klamm eines Mundes, der vor wenigen Stunden noch geschwätzt, geküsst und gegessen hatte. An Letzterem konnte es keinen Zweifel geben. Er selbst hatte sich über den Mund der Leiche gebeugt, hatte das Abendmahl (Kohl; es stank abartig) gerochen. Und er hatte auch den bittersüßen Geruch wahrgenommen, der über dem eigentlichen Gestank lag.
Die Fliege verschwand wieder im Mund. Vielleicht richtet sie sich häuslich ein? Weiß sie nicht, dass ihr Häuschen voller Gift ist? Oder ist es ihr einfach egal? Was bei den Göttern macht sie da? Die Leber der Leiche war so stark vergrößert, dass sie sich deutlich durch das geplatzte Wams abzeichnete. Langweilig. Irgendeine Variante von Bitterkelb, zweifelsohne. Dass der Tote neben einem Misthaufen in seinem eigenen Erbrochenen lag, erhärtete die Vermutung, machte sie für Fennek Greskegard auch ohne genaue Untersuchung zu einer Tatsache.
Irgendein toter Landadeliger. Unbedeutend. Wieder die falsche Spur. Wieder wochenlange Nachforschungen und eine weitere vergebliche Reise inklusive der lästigen Formalitäten beim Grenzübertritt. Irgendwo zu seiner Rechten schwadronierte immer noch der Büttel. Greskegard hatte seine »Ausführungen« in den Hintergrund seines Bewusstseins gedrängt, sodass sie zu der Bedeutungslosigkeit eines nächtlichen Zirpen von Zikaden oder eines Froschkonzerts herabgesunken waren.
Die Fliege kehrte aus ihrem kleinen neuen Reich zurück. Sie flog ab, kam diesmal aber nicht weit. Sanftleben war kein Freund kleiner, harmloser Dinge. Sie reizten ihn zu maßloser Gewalt. Er holte aus und zermatschte das Insekt an einer der Bretterwände des Misthaufens. Dann betrachtete er die breiige Masse eingehend, in der noch ein Beinchen auf- und abzuckte wie der Bogen eines Geigers.
»Hö! Hab dich!«
Greskegard musterte seinen Assistenten. Den glatzköpfigen Hünen als vierschrötig oder ogergleich zu bezeichnen, wäre einem Kompliment gleichgekommen. Er war ein wandelndes Gebirge aus teigig-grauem Fleisch, muskelbepackt wie ein Menschenaffe und in etwa so stark. Sein Gesicht glich dem eines Faltenhundes. Ein tumber Ausdruck lag darauf. Sanftlebens Augen waren trübe Münzen, die in Fettwülsten verschwanden.
Die meisten Leute unterschätzten ihn. Ein tödlicher Fehler. Die schmuddelige Schürze, der wuchtige, an das Instrument eines Fleischers erinnernde zweihändige Kriegshammer auf seinem Rücken und der Gürtel voll kruder Werkzeuge, die einer ganz besonderen Art der Befragung vorbehalten waren, hätten eigentlich Warnung genug sein müssen, ebenso wie seine beinahe schon unnatürliche Körpergröße von über siebeneinhalb Fuß, die seine barbarische Herkunft preisgab.
Greskegard hatte ein Wort gefunden, das seinen Diener perfekt umschrieb: effizient. Er war eine höchst ökonomische Kreatur, die nur dann in einem Sturm aus hektischer Energie agierte, wenn sie etwas oder jemandem Leid zufügen konnte, und ansonsten ihre Kapazitäten schonte.
»Was denkt Ihr, M’lord?« Der Büttel sprach ihn auch noch an.