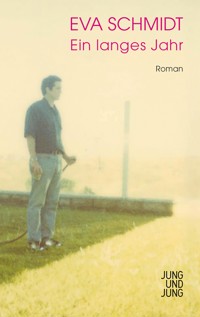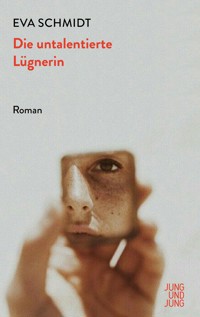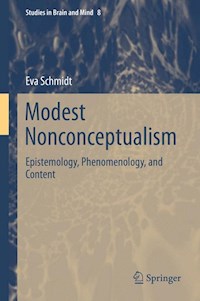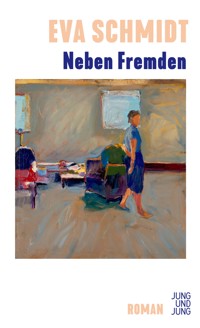
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eva Schmidt erzählt so eindringlich wie nüchtern von Abschied und Verlust, aber auch von der Suche nach Verbundenheit und Nähe. Rosa war Krankenpflegerin, seit sie in Pension ist, hat sie nur mehr wenig mit Menschen zu tun. Die einzige Freundin ist eine ehemalige Kollegin, die Nachbarn halten sie auf Distanz, dabei möchte sie nur helfen. Das Verhältnis zur Mutter war nie gut, es wird nicht besser, seit diese auf Hilfe angewiesen ist und die Tochter mehr und mehr zu vereinnahmen versucht. Und auch einen Mann gibt es, aber der ist verheiratet. Als er überraschend stirbt, bleibt Rosa nur der Campingbus, den er ihr einmal geschenkt hat. Doch was soll sie damit? Ist er eine Chance auf ein anderes Leben, vielleicht die letzte? Als sie den Aufbruch wagt, erreicht sie ein Brief von ihrem Sohn, der vor Jahren den Kontakt zu ihr abgebrochen hat. Er wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben – nun weiß sie immerhin, wo er lebt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva Schmidt
Neben Fremden
Roman
Jung und Jung
»Du glaubst, wenn du morgens aufwachst, dass das Gestern nicht zählt. Dabei zählt nichts anderes. Was gibt es denn außerdem noch? Dein Leben besteht aus den Tagen, aus denen es besteht. Aus nichts anderem. Du glaubst vielleicht, du könntest weglaufen, deinen Namen ändern und was weiß ich noch alles. Noch mal von vorn anfangen. Und dann wachst du eines Morgens auf und starrst die Decke an, und rate mal, wer da liegt?«
Cormac McCarthy, No Country for Old Men
Ich ließ Kaffee aus der Maschine, gab Milch und Zucker in die Tasse und nahm sie mit auf den Balkon. Es war kalt, die Temperatur war über Nacht spürbar gesunken. Das Thermometer, das Fred vor Jahren an der Hauswand befestigt hatte, zeigte zehn Grad. Ich hatte kaum geschlafen, war vom Regen, der gegen die Scheiben prasselte, von den Gewittern, die über dem See kreisten, und dem Hagel, der hart auf die Fenstersimse schlug, immer wieder aufgewacht. Als ich gegen Morgen hinausschaute, dachte ich, es habe geschneit, doch inzwischen waren die weißen Flecken im Gras neben dem Uferweg wieder geschmolzen. Ich trank den Kaffee im Stehen, zündete eine Zigarette an, wärmte abwechselnd die eine, dann die andere Hand an der warmen Tasse.
Von unten hörte ich Stimmen. Als ich mich über die Brüstung beugte, sah ich die beiden, die unter mir wohnten, auf ihrem Balkon. Sie hatte einen Mopp in der Hand und wischte Wasser in den Ablauf. Sie trug Gummistiefel und einen Pullover mit viel zu langen Ärmeln. Ihn hörte ich Möbel, vermutlich Gartenstühle, hin und her rücken. Er beschwerte sich, dass die Polster nass geworden waren, warf ihr vor, sie am Vorabend nicht hineingeräumt zu haben.
Reg dich ab, sagte sie, während sie durch das schmutzige Wasser stapfte, das sich über dem Abfluss staute.
Gleich darauf fiel etwas zu Boden, es hörte sich an, als würde Porzellan zerspringen.
Kannst du nicht aufpassen?, schrie sie, während er laut vor sich hin fluchte.
Ich kannte die beiden nur vom Sehen, von Begegnungen im Stiegenhaus, vor dem Lift oder im Keller. Man grüßte kurz, mehr nicht. Die Frau hatte zwei Kinder, ein hübsches Mädchen mit langen schwarzen Haaren und einen Jungen, sechzehn, siebzehn Jahre alt, mit schwarzen lockigen Haaren, der mir durch sein ungeschicktes Verhalten schon ein paarmal aufgefallen war. Ich sah ihn hin und wieder im Laden, wenn er für seine Mutter einkaufte. Er zappelte mit Armen und Beinen, konnte keinen Moment ruhig stehen, stieß mit dem Einkaufswagen gegen die Regale, riss im Gehen Dinge mit oder ließ etwas fallen. Ich sah ihn manchmal vom Fenster aus, wie er im Hof über seine eigenen Füße stolperte.
Soviel ich wusste, war der Vater der Kinder Spanier, die Mutter, eine Deutsche, war früher verheiratet gewesen, aber vielleicht auch nicht. Sie trug meistens Jeans, manchmal weit geschnittene Kleider, die lockigen Haare entweder offen oder nachlässig zu einem Pferdeschwanz gebunden, rosafarbene Clogs mit aufgesteckten Peace-Zeichen. Im Gegensatz zu ihr sah der Mann, der seit ein, zwei Jahren bei ihr wohnte, nicht besonders gut aus. Er war nicht der Vater der Kinder, irgendjemand hatte mir das erzählt.
Normalerweise verließen wir das Haus gegen halb neun. Dann waren die Kinder aus dem Wohnblock in der Schule oder im Kindergarten, die meisten Bewohner bei der Arbeit, und der Frühverkehr auf der Bundesstraße hatte sich etwas beruhigt. Doch es regnete nach wie vor, und der Wind peitschte die jungen Bäume, die man vor Kurzem zwischen der Bahnlinie und dem Uferweg gepflanzt hatte, in alle Richtungen. Die Fähre, die weit draußen auf dem Wasser zum anderen Ufer unterwegs war, war vor dem Grau der tiefziehenden Wolken kaum erkennbar.
Es war fast zehn, als wir uns schließlich auf den Weg machten. Wir gingen um den Wohnblock herum, überquerten Straße und Schienen, spazierten am Ufer entlang Richtung Stadt. Don hinkte ein wenig, es sah aus, als würde er die Hinterläufe nachziehen. Ich machte mir Sorgen um ihn.
Fred hatte Don auch gemocht. Er hatte sich um ihn gekümmert, wenn ich keine Zeit hatte, war mit ihm in den Wald gegangen, hatte ihm sein Fressen zubereitet und frisches Wasser hingestellt. Aber letzten Endes hatte Fred wie alle anderen gedacht: dass Don am Ende nur ein Hund war.
Deshalb erzählte ich nie jemandem, wie viel er mir bedeutete. Weder Fred noch Margreth, und schon gar nicht meiner Mutter, die ich zwar hin und wieder anrief, aber nur weil sie meine Mutter war, nicht weil ich sie mochte oder mich gern mit ihr unterhielt. Sie selbst meldete sich nie, sie fand, dass es meine Pflicht war, mich um sie zu kümmern. Sobald wir am Telefon miteinander sprachen, warf sie mir alles Mögliche vor. Dass ich sie nur selten besuchte, sie nie zum Essen einlud, sie nicht zum Einkaufen oder auf eine Runde durch das Dorf begleitete.
Früher war ich geselliger. Margreth, die behauptete, meine Freundin zu sein, habe ich mir nicht ausgesucht. Wir hatten uns auf der Arbeit kennengelernt, dann für Jahre aus den Augen verloren, bis wir uns eines Tages zufällig wiederbegegneten, kurz nachdem ich pensioniert worden war. Seither kam sie ab und zu auf Besuch. Wenn es nach ihr ginge, würden wir uns häufiger treffen.
Wir könnten ins Kino gehen, meinte sie neulich, oder uns abends mal in eine Bar setzen und etwas trinken.
Das geht nicht wegen Don, sagte ich, er ist alt und nicht mehr gern allein.
Dann nimm ihn einfach mit, sagte sie, worauf ich erwiderte, er sei nicht gern unter Fremden.
Es war eine Ausrede, ich hatte einfach keine Lust, mit Margreth in Kaffeehäusern oder in Bars zu sitzen, und ins Kino ging ich nicht, weil ich mich in einem Raum voller Menschen nicht wohlfühle und ständig das Gefühl habe, einer von ihnen könnte plötzlich einen Anfall bekommen, tot umfallen oder jemanden erschießen.
Es war nicht schwer, Margreth von etwas zu überzeugen, sie von einem Vorhaben oder einer Meinung abzubringen. Sie wirkte unsicher, sobald sie sich zu einem Thema äußern sollte. Ihre Sätze begannen häufig mit: Ich sage immer, oder: Emil hat gesagt. Emil war Margreths Mann. Sie waren seit mehr als dreißig Jahren verheiratet, und soweit ich Emil kannte, sprach er über das Allernotwendigste hinaus nicht gerade viel.
Emil hat gesagt, ein Hund kommt ihm nicht ins Haus, weil er die Scheiße anderer frisst, sagte Margreth irgendwann einmal.
Wir hatten gar nicht über Hunde gesprochen, aber Don hatte Margreth im Vorbeigehen mit seiner Schnauze berührt und ein wenig an ihr geschnuppert. Ich war mir sicher, dass Emil nie so etwas gesagt hatte, weil weder für Margreth noch für ihn je ein Hund zur Debatte gestanden hatte. In ihrem Haus, in dem ich nur einmal war, war es so sauber, dass man vom Fußboden essen konnte, und es roch nach Chlor. In Wahrheit war es so, dass sich Margreth vor allem, was mit Exkrementen und anderen Ausscheidungen zu tun hatte, ekelte. Wie sie all die Jahre als Altenpflegerin überstanden hatte, war mir ein Rätsel. Obwohl sie ohnehin nur Teilzeit gearbeitet hatte und in den Jahren, als ihre Kinder heranwuchsen, gar nicht.
Wir gingen über den Marktplatz. Es regnete nicht mehr, inzwischen schien sogar die Sonne. Ich stellte mich bei einem kleinen Händler an, bestellte Kartoffeln, Tomaten und Äpfel. Am Fischstand kaufte ich ein Filet vom günstigsten Fisch, ließ es in grobe Stücke schneiden. Danach gingen wir weiter, stiegen langsam die steile Straße hinauf, die ins Villenviertel und auf den Friedhof führte. Auf Freds Grab brannte eine Kerze. Jemand, vermutlich sein Sohn oder seine Tochter, aber bestimmt nicht seine Frau, hatten sie hingestellt. Sie hatten die Pflege des Grabs übernommen, weil sie Freds Wohnung, das Geld und die Aktien geerbt hatten. Seine Frau, von der er zwar schon lange getrennt lebte, aber nie geschieden worden war, bekam die Witwenpension.
Ich zupfte an den Pflanzen, die in einer Schale wuchsen. Es gab nicht viel zu tun. Kaum verwelkte Blätter, keine abgefallenen Blüten. Es waren pflegeleichte Pflanzen, die Trockenheit vertrugen und nicht gegossen werden mussten.
Eines Abends, wir saßen am Tisch in meiner Wohnung, hatten etwas gegessen und ein Glas Wein getrunken, fragte Fred: Sollen wir vielleicht heiraten?
Warum?, fragte ich zurück.
Aus finanziellen Gründen, antwortete er. So würde ich im Fall, dass ihm etwas passieren sollte, zumindest einen Teil seiner Pension bekommen, wenn auch nicht die Wohnung und das Geld, das er bereits seinen Kindern vermacht hatte.
Hätte er gefragt: Willst du mich heiraten?, oder: Möchtest du meine Frau werden?, hätte ich vielleicht Ja gesagt.
Im Park setzte ich mich auf eine Bank. Don hatte sich bereits hingelegt. Ich packte den Fisch aus, der unangenehm roch, schaute dem Hund zu, wie er die Happen vom Papier löste, bevor er sie verschlang. Als er damit fertig war, knüllte ich alles zusammen und steckte es in einen Abfalleimer. Meine Finger rochen jetzt nach Fisch. Ich hatte vorgehabt, ein wenig in dem Buch zu lesen, das in meiner Tasche steckte. Ich hatte es mitgenommen, weil ich gern im Freien las. Don hätte sich währenddessen ins Gras legen können, Hauptsache, wir waren an der frischen Luft. Das Buch hatte ein amerikanischer Schriftsteller geschrieben, der schon lange nicht mehr lebte. Er hatte es vor mehr als fünfzig Jahren geschrieben, es waren Kurzgeschichten, eine davon handelte von einer Frau, die ihren Mann in einer Lungenheilstätte besucht. Sie weiß, dass er sterben wird. Freunde, bei denen sie vorher zum Essen war, fahren sie ins Krankenhaus, auch ein Mann, mit dem sie seit einiger Zeit zusammen ist, begleitet sie. Sie sitzt mit ihm auf der Rückbank des Wagens, wo er sie ständig küsst und umarmt. Eigentlich wäre sie lieber mit dem Bus gefahren, aber weil das Essen zu lange gedauert hatte, war es spät geworden, deshalb hatte sie das Angebot angenommen. Während sie bei ihrem Mann in der Klinik war, würden die Freunde und ihr Liebhaber in einer Bar auf sie warten.
Die Frau hat den Mann, mit dem sie ein Verhältnis hatte, vielleicht gar nicht geliebt. Vielleicht konnte sie das Alleinsein nicht ertragen. Ihr Mann war in den vergangenen Jahren immer wieder in der Klinik gewesen, diesmal würde er nicht mehr zurückkommen. Wenn er tot wäre, könnte sie ihn auch an den Sonntagen nicht mehr besuchen, so, wie sie es bisher gemacht hatte. Dann wäre sie erst recht allein.
Ich hatte die Geschichte schon zweimal gelesen. Am meisten war mir in Erinnerung geblieben, wie sie sich im kalten Flur der Klinik von ihrem Mann verabschiedete, ihm dabei den Bademantel enger band, der ihm viel zu weit geworden war, ihn zurück in sein Zimmer schickte, damit er sich nicht erkältete, ihm noch eine Weile nachsah, draußen in der Kälte weinte, schließlich aber mit den Freunden, die sie abholten, feiern ging und den Mann, den sie auf der Rückfahrt Darling nannte, am Ende mit nach Hause nahm.
Als Fred starb, war ich nicht dabei. Es geschah überraschend, niemand hatte damit gerechnet. Fred hatte eines Morgens gerade das Haus verlassen, in dem er wohnte, als er tot umfiel. Sein Herz hatte einfach aufgehört zu schlagen. Es war seine Tochter, die mir die Nachricht überbrachte.
Sie rief mich an und sagte, mein Vater ist tot. Sie können ihn in der Aufbahrungshalle ein letztes Mal sehen, aber wagen Sie es ja nicht, auf die Beerdigung zu kommen.
Ich hatte seine Tochter einmal kennengelernt, wenn auch nur zufällig, als ich mit Fred in einem Café saß, während sie an uns vorbeiging. Fred lief ihr nach, bat sie, mitzukommen, um mich kennenzulernen.
Sie kommt ganz nach ihrer Mutter, seufzte er, nachdem sie sich bereits nach wenigen Minuten wieder von uns verabschiedete, noch bevor sie sich richtig hingesetzt hatte.
Mach dir nichts draus, sagte ich.
Ich hatte seine Ex-Frau noch nie gesehen, in Freds Wohnung gab es ein einziges Foto von seinen Kindern, aber keines von ihr. Einmal fuhr ich mit dem Bus in die Gegend, in der er früher mit seiner Familie gelebt hatte. Es war ein schönes Haus mit einem schattigen Garten voller Hortensien, Buchsbäumen und Rosen. Die Zweige einer großen Weide senkten sich bis zum Boden, darunter stand eine steinerne Bank. Ich schlenderte langsam am Zaun entlang, wechselte auf die andere Straßenseite, betrat ein Café, bestellte einen Espresso und fand einen Platz am Fenster mit Blick auf das Haus, in dem Freds Frau und sein jüngster Sohn noch immer lebten.
Fred hatte nur selten über seine Kinder gesprochen und so gut wie gar nicht über seine Frau und die Gründe, die zu ihrer Trennung geführt hatten. Einmal sagte er, er habe es nicht mehr ausgehalten.
Was hast du nicht mehr ausgehalten?, fragte ich.
Alles, erwiderte er nur.
Die Frau, mit der er bis zu seinem plötzlichen Tod noch immer verheiratet gewesen war, unterschied sich nicht sehr von anderen Frauen dieses Viertels, das sich auf einer Anhöhe über dem Stadtzentrum und der Altstadt befand. Die Häuser dort waren alle in einem ähnlichen Stil erbaut. Große, villenartige Ein- und Mehrfamilienhäuser mit Erkern, verglasten Veranden, weitläufigen Gärten. Ein paar einzelne Neubauten nahmen sich dazwischen wie Fremdkörper aus.
Ich saß länger als zwei Stunden in dem zu einer Bäckerei gehörenden Café, aß ein Stück Kuchen, trank Tee und schließlich ein Glas Sekt, als Freds Frau endlich aus ihrem Haus kam, das Gartentor öffnete, auf den Gehsteig trat und Richtung Innenstadt ging. Sie trug Schuhe aus Lackleder, ein gut sitzendes, kariertes Kostüm, die Haare korrekt geschnitten und geföhnt. Ich weiß nicht, warum ich sie unbedingt sehen wollte.
Ich hatte Fred vor Jahren an meinem Arbeitsplatz kennengelernt. Seine an Alzheimer erkrankte Mutter lag auf meiner Station, und als ich ihr Zimmer betrat, um die Einnahme ihrer Medikamente zu kontrollieren und den Blutdruck zu messen, saß Fred an ihrem Bett. Ich sah nicht viel von ihm, er hatte die untergehende Sonne gerade im Rücken. Vielleicht war es der Duft seines Rasierwassers, das mich an das meines Vaters erinnerte, ein ziemlich gewöhnlicher Geruch nach Bergamotte, Sandelholz und Leder, vielleicht die Ruhe, die er ausstrahlte, oder es war eine dieser chemischen Reaktionen, die, während ich die Manschette des Blutdruckgerätes um das Handgelenk seiner Mutter wickelte, meinen Puls sekundenlang in die Höhe schnellen ließ. Ich weiß nicht, was Fred dabei empfand. Ein paar Wochen später, als wir eines Abends nach einem Restaurantbesuch auf einer Bank an der Uferpromenade saßen, sagte er, er habe sich vom ersten Augenblick an zu mir hingezogen gefühlt. Er sagte nicht, ich habe mich in dich verliebt, nur, ich fühlte mich zu dir hingezogen.
Ich wusste nichts über ihn. Ich glaube, Fred hatte seine Mutter an diesem Nachmittag zum ersten Mal besucht. Die alte Frau erkannte niemanden mehr, Tag für Tag saß sie entweder in ihrem Fernsehsessel vor dem laufenden Apparat oder in einem Rollstuhl am Fenster, ließ sich bei gutem Wetter auf ihren Balkon oder in den Garten des Seniorenheims schieben. Sie lebte in einer Welt, in die wir keinen Einblick hatten, sprach mit niemandem, teilte uns nicht mit, was in ihr vorging. Ich hatte jeden Versuch, mit ihr ins Gespräch zu kommen, aufgegeben, nur ein Stofftier, das sie den ganzen Tag in den Armen hielt, ein hässliches, zerzaustes Ding, in dem mit Mühe eine schwarze Katze zu erkennen war, brachte sie manchmal zum Sprechen. Dann brabbelte sie vor sich hin, unverständlich für jeden, der mithörte. Manchmal klang es liebevoll, manchmal traurig, einmal, als sie die Katze weit von sich wegschleuderte, überraschend zornig.
Freds Mutter blieb nicht lange bei uns im Heim. Sie starb eines Nachts, als ich gerade Dienst hatte. Es war nicht vorauszusehen gewesen, neben ihrer fortgeschrittenen Demenz hatte sie keine ernsthaften Erkrankungen. Während sie die letzten Wochen ihres Lebens bei uns verbrachte, hatten Fred und ich bereits ein Verhältnis. Ich stand kurz vor meiner Pensionierung, er war achtundsechzig. Ein Jahr bevor wir uns kennenlernten, hatte sich Fred von seiner Frau getrennt. Er wohnte mitten in der Stadt, in einem Haus, in dem auch sein Unternehmen untergebracht war. Ein paar Wochen nach unserer ersten Begegnung habe ich ihn dort besucht.
Er hatte mich eingeladen, umarmte mich, als ich kam, überreichte mir einen Blumenstrauß und führte mich durch die Wohnung, die aus einem Wohnzimmer, einer großen Terrasse, einem Schlafzimmer mit Bett und Schrank, einem Badezimmer und einer chromglänzenden Küche bestand. Sie wirkte genauso unbenutzt wie das Wohnzimmer, in dem es außer einem riesigen Fernsehapparat nicht viel mehr gab als eine Polstergruppe samt Tisch, der Tisch voll mit Zeitungen neben einem Stapel ungeöffneter Post, zwei Gläsern und einer Flasche Champagner in einem Sektkübel. Das war alles, keine Bilder, keine Bücher, keine Topfpflanzen, nicht einmal ein Aschenbecher. Ich setzte mich auf eine Seite des Sofas, Fred auf die andere. Er entkorkte die Flasche, schenkte die Gläser voll, wir stießen an und tranken.
Ich geh mal eine rauchen, sagte ich nach einer Weile, stand auf, schlüpfte in meinen Mantel und trat auf die Terrasse. Es war Winter, im Norden hing eine graue Wolkenwand über dem See. Ich fror, blieb aber, bis von der Zigarette nur noch der Filter übrig war. Als ich zurückkam, saß Fred noch immer auf seinem Platz. Er trug eine Anzughose, hellbraune Leder-Slipper und ein weißes Hemd. Wenn er mich in meiner Wohnung besuchte, kam er in irgendeiner abgetragenen Hose, Hemd und Pullover, groben Schuhen. Er machte es sich bequem, streckte sich auf dem Sofa aus, zog die Füße auf die Sitzfläche oder legte sie auf den Couchtisch. Jetzt saßen wir beide da, jeder in einem der weichen Polster der riesigen Couch versunken, suchten nach Themen für eine Unterhaltung, fielen uns vor lauter Befangenheit ständig ins Wort. Nach und nach leerten wir die ganze Flasche. Wir tranken, um die Stille auszufüllen, knabberten die Nüsse, die Fred in einer Schale serviert hatte, unterhielten uns über Belanglosigkeiten und schauten gleichzeitig fern. Immer wieder stand ich auf, ging auf die Terrasse, rauchte. In dieser Nacht sollte ich bei Fred übernachten, so war es ausgemacht, doch ich wollte nach Hause. Unten, in der Seitenstraße, in der sich der Eingang zu Freds Büro befand, fuhr ab und zu ein Auto vorbei. Ich stand da, sah den Rauchwolken nach. Manchmal wandte ich mich um und schaute ins Wohnzimmer, sah Fred auf der Couch sitzen. Er saß in derselben Haltung da, in der ich ihn ein paar Minuten vorher verlassen hatte. Er rührte sich nicht, starrte unentwegt vor sich hin. Es sah aus, als würde die Zeit in diesem Raum ohne Vorhänge während meiner Abwesenheit stillstehen. Ich wusste nicht, wovor ich Angst hatte. Ich sah Fred in seinem weißen Hemd in seiner Wohnung sitzen, das war alles.
Unten fuhr wieder ein Auto vorbei, es war das dritte, seit ich mir die letzte Zigarette angezündet hatte. Sie war zur Hälfte abgebrannt. Wenn noch ein Auto vorbeifährt, bevor sie aufgeraucht ist, dachte ich, wird alles gut. Aber weder fuhr ein Auto vorbei noch wusste ich, was gut werden sollte. Zurück im Wohnzimmer erklärte ich Fred, dass ich gern nach Hause fahren würde, sagte aber nicht, warum. Da er zu viel getrunken hatte, um selbst zu fahren, bestellte er ein Taxi. Er kam mit nach unten, öffnete die Tür, als der Wagen hielt. Wir umarmten uns nicht wie sonst, wenn wir uns voneinander verabschiedeten. Das Taxi wendete im Hof, fuhr, ehe es wieder in die Straße einbog, an der Einfahrt vorbei. Fred stand im Licht der Türbeleuchtung. Sein Gesicht war fast so weiß wie das Hemd.
Den siehst du bestimmt nicht wieder, dachte ich, als ich in dieser Nacht nach Hause kam. Doch schon am nächsten Tag haben wir uns wieder getroffen. Ich weiß nicht, was Fred über den Abend in seiner Wohnung dachte, ob es ihm ähnlich ergangen war wie mir, wir haben nie darüber gesprochen. Von da an trafen wir uns nur noch bei mir, das war auch für Don, der nicht gerne auswärts schlief, die bessere Lösung. Fred, der die Leitung seines Büros bereits an seinen Sohn abgegeben hatte und deshalb über mehr Freizeit verfügte als ich, bot mir an, sich untertags hin und wieder um den Hund zu kümmern. Ich stimmte zu, obwohl es mir nicht leichtfiel, mich von Don zu trennen. Eigentlich brauchte ich keinen Hundesitter. Seitdem Don bei mir lebte, begleitete er mich täglich zur Arbeit, hielt sich während meiner Dienste im Gemeinschaftsraum oder im Garten der Anlage auf, leistete den Heimbewohnern Gesellschaft, begleitete die, die noch halbwegs gehen konnten, auf ihren Spaziergängen.
Wie es uns gelang, noch am Abend unserer ersten Begegnung miteinander ins Bett zu gehen, ist mir heute noch ein Rätsel. Ich nehme an, es lag an unserem Alter. Man macht sich nichts mehr vor, denkt, man hat nicht mehr so viel Zeit. Inzwischen, seitdem er nicht mehr lebt, frage ich mich manchmal, was uns beide verbunden hat. Was ich am meisten vermisse, ist sein Lachen. Ich bin von Natur aus eher ernst, ließ mich aber von seinem Lachen anstecken. Wir lachten über andere, über uns selbst, über das, was einer dem anderen gerade erzählte. Eines Abends, wir kannten uns gerade ein paar Wochen, gestand er mir, dass er an Sex gar nicht so interessiert sei, wie es den Anschein haben mochte. Seine zeitweilige Lustlosigkeit, versicherte er mir, habe jedoch nichts mit mir zu tun, sondern, wie er vermutete, mit einem Mangel an Testosteron, einer altersbedingten Kraftlosigkeit oder einer Lebererkrankung, die er sich in jungen Jahren zugezogen hatte.
Ich finde Sex gar nicht so wichtig, sagte ich.
Er sah mich stirnrunzelnd an. Nein?
Ich schüttelte den Kopf, überlegte kurz, was ich sagen sollte. Es war gar nicht so einfach.
Irgendwie mag ich mir gar nicht vorstellen, wie ich dabei aussehe, sagte ich. Aber vielleicht liegts nur am Alter. Man bekommt Falten, hier und dort hat man ein paar Pfunde zu viel, das Gewebe wird schlaff.
Du siehst gut aus für dein Alter.
Ich weiß nicht.
Doch.
Wir schauten einander an. Fred machte so ein ernstes Gesicht. Vielleicht fühlte er sich schlecht, dachte, ich wäre von ihm enttäuscht.
Ich fand es immer ein bisschen anstrengend, sagte ich. Auch als ich jünger war.
Er nickte wieder, blies dabei die Backen auf, ließ die Luft herausploppen.
Wir saßen nebeneinander auf der Couch, tranken ein Glas Wein und schauten nebenbei einen Film im Fernsehen. Fred massierte mir die Füße, er nahm dazu etwas Öl. An manchen Stellen übte er mehr Druck aus, es tat ein bisschen weh, doch ich mochte es. Um ehrlich zu sein, konnte ich gar nicht genug davon bekommen. Fred sagte, bei den Schmerzpunkten handle es sich um Ablagerungen, mit der richtigen Technik ließen sie sich wegmassieren. Dabei würden sie sich auflösen und vom Körper ausgeschieden werden. Er kannte sich damit aus.