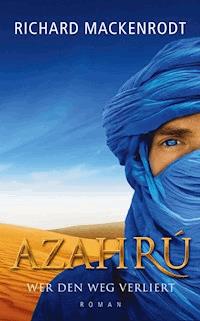4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Ganz klar das fantasievollste Buch, das ich in den letzten Jahren gelesen habe. Die Parallelität der beiden Welten erinnert mich manchmal ein bisschen an Stranger Things – nur dass Nekton einfach noch ein paar Klassen besser ist. Wie du in der zweiten Hälfte die Spannungsschraube hochdrehst, bis zum Äußersten – das habe ich noch nie erlebt, vollkommen unfassbar. Dazu kommt, dass Nekton auf sehr angenehm unaufdringliche Weise eine wunderbare Botschaft transportiert: Passt auf die Erde gut auf, ihr habt nur die eine. Das Buch ist visionär. Aufregend. Überwältigend. Klug. Episch. Komplex. Einfach mindblowing. Dazu auch noch sehr unterhaltsam. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage: Nekton, Band 1, Die Prophezeiung: Meisterwerk. Absoluter Meilenstein. Ich hatte beim Lesen so oft Gänsehaut. Ich sage euch nur: Nehmt euch Zeit, wenn ihr anfangt, es zu lesen, oft weglegen werdet ihr's nicht können. Es gibt wirklich nur eines, das mir an dem Buch überhaupt nicht gefällt, aber mal so gar nicht: dass nicht ich es bin, die es geschrieben hat." Daniila Beser ("Sonnenvögel") Ein gigantisches Rechenzentrum in Berlin ist unter Zuhilfenahme von K.I. in der Lage, die Zukunft auf hochkomplexe Weise virtuell hochzurechnen. Doch damit nicht genug: Menschen können mit allen Sinnen an diese Maschine angeschlossen werden und so gewissermaßen "in die Zukunft reisen". Das brisante Projekt, streng geheim, befindet sich noch in der Testphase. Selbst Zoë, die Tochter des Entwicklers, weiß nichts davon. Trotzdem gelingt es ausgerechnet ihr, die Reise in so ein virtuelles Multiversum anzutreten. In der Zukunft, in der sie landet, hat der Mensch unseren Planeten, wie wir ihn kennen, längst zugrunde gerichtet. Nach einer Naturkatastrophe epischen Ausmaßes befindet sich fast die gesamte Erde unter Wasser. Die letzten verbliebenen Menschen kämpfen gegen eine finstere Macht. Während Zoë dort nun an der Seite der Rebellen für das Gute kämpft, entbrennt im Hier und Jetzt ein erbitterter Kampf um die unfassbar wertvolle virtuelle Zeitmaschine. Wird Zoë jemals in ihr wirkliches Leben zurückkehren können? Und will sie das überhaupt? Nekton, Band 1: Die Prophezeiung ist der erste Teil einer Trilogie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
RICHARD MACKENRODT
NEKTON
BAND 1
DIE PROPHEZEIUNG
nach einer Idee
von Jan Birck
Prolog
Das Meer funkelt wie eine Truhe voller Smaragde. Kein Windhauch kräuselt das Wasser. Und doch beginnt die Oberfläche sich zu bewegen. Ganz leicht nur. Ein Fisch, der unerkannt seine Bahnen zieht? Kleine Blasen steigen auf. Und vergehen. Lautlos. Dann geht es auf einmal sehr schnell: Etwas kommt hervorgeschossen, türmt sich auf. Eine Stirn, ein Kopf. Nasses, langes Haar fällt über schmale Schultern. Zierliche Finger tasten ins Leere. Augen, grün wie Frühlingsmoos, weit aufgerissen, obwohl das Salz in ihnen brennt. Ein Mund schnappt laut nach Luft.
Sie paddelt umher. Blickt in alle Richtungen. Hustet. Es ist ihr Herz, das da so hämmert. Sie versteht das nicht. Was geschieht hier? Wie ist sie hergekommen? Was ist los? Ein Gedanke schießt ihr durch den Kopf. Ein Traum. Ist es ein Traum? Es muss doch ein Traum sein! Aber so echt? So wahrhaftig? Sie spürt die Kälte des Wassers. Schmeckt das Salz auf der Zunge. Das Sonnenlicht, gleißend reflektiert, schmerzt in den Augen. Sie muss blinzeln, muss strampeln, damit sie nicht untergeht. Sie versucht sich an frühere Träume zu erinnern, hat sie so etwas schon einmal erlebt? Aber ihr fällt keiner ein. Wie kann das sein? Es muss doch Träume geben, an die sie sich erinnert. Denk nach, schnell! Wenn es ein Traum ist, wo wird sie nachher aufwachen? Wo ist sie zu Hause? Sie weiß es nicht! In ihr ist kein Bild von einem Zuhause! In ihr ist... gar nichts! Sie weiß nicht, wer sie ist. Sie hat für sich selbst keinen Namen. Soll sie um Hilfe rufen? Doch wer soll sie hören? Sie verschluckt sich, hustet Salzwasser. Sie bemerkt, dass sie nichts anhat. Sie versteht das alles nicht. Warum geschieht das, wer hat ihr das angetan? Soll sie schwimmen, in irgendeine Richtung, in der Hoffnung, etwas zu finden, das Rettung verspricht? Oder lieber auf demselben Fleck bleiben, um Kraft zu sparen? Sie versucht sich zu erinnern, wann sie Schwimmen gelernt hat und wo. Doch da ist nichts. Sie sieht vor ihrem inneren Auge kein einziges Gesicht, nicht einmal ihr eigenes. Sie wird sterben, ohne zu wissen, wie sie aussieht, ohne zu wissen, ob es jemanden gibt, der sie vermissen wird.
Sie schreit, so laut sie kann. Wieder und wieder. Bis ihr Hals immer rauer wird. Schreien bringt nichts. Sie muss Kräfte sparen. Die Bewegungen von Armen und Beinen auf das Nötigste beschränken, gerade so, dass sie nicht untergeht. Und auf ein Wunder hoffen. Sie sieht die Gänsehaut auf ihren Oberarmen, ihr wird kalt. Sie versucht an etwas zu denken, das ihr ein gutes Gefühl geben könnte, irgendetwas. Aber ihr fällt nichts ein. Ein Schluchzen steigt aus ihrer Brust empor, das Salz ihrer Tränen vermischt sich mit dem des Meeres. Sie ist ein Stecknadelkopf mitten im ewigen Ozean.
TEIL I
DAS MÄDCHEN IM ROLLSTUHL
Zoë
Der neue Deutsch- und Sozialkunde-Lehrer kam mitten im Schuljahr. Sein Vorgänger war krank geworden und konnte nicht mehr unterrichten. Die Klasse musterte den Neuen mit der Art von Neugier, mit der man auf besseres, wärmeres Wetter hofft, nachdem man einen kalten, dunklen Winter überstanden hat. Der Vorgänger war alt und streng gewesen. Niemand an der Schule hatte ihn jemals lächeln sehen. Seine Stimme hatte nach verrostetem Rohr geklungen, sein Wortschatz schien irgendwo im letzten Jahrhundert steckengeblieben zu sein. Der Neue war in jeder Hinsicht anders, nicht älter als Mitte dreißig, trug Jeans und grinste schalkhaft, wenn er sprach. Er stellte sich vor, erzählte kurz, aus welcher Stadt er stammte und was er in seiner Freizeit so trieb, dann forderte er die Schüler auf, sich ebenfalls kurz vorzustellen.
»Wer möchte denn anfangen?«
Auf so eine Frage meldete sich nie jemand. Was man dann von sich gab, konnte ja peinlich werden. Der Lehrer war darauf vorbereitet, noch ein oder zwei Sätze nachschieben zu müssen, so in der Art von: Keine Angst, ich beiße nicht. Doch eine Hand schoss sofort nach oben. Es war das Mädchen im Rollstuhl, das sich meldete.
»Bitteschön«, erteilte der Lehrer ihr das Wort.
»Ich heiße Zoë«, sagte sie. »Zoë Kamp. Wenn der Name irgendwo geschrieben steht, wissen Viele nicht, wie man ihn ausspricht. Sie denken dann, es heißt Zö. Oder Zo. Oder sogar Zoo, mit langem O, weil sie glauben, das am Ende ist ein Dehnungs-E. Andere finden es cool, den Namen englisch auszusprechen und sagen Souie. Oder Souey. Legitim wäre So-e, mit weichem S.Das ist mir aber zu soft, deswegen heiße ich lieber Zo-e, mit scharfem Z und einem E wie in egal. Auf dem E liegen zwei Punkte, die sogenannten Tremata. Man nennt sie auch Trennpunkte.«
»Du scheinst deinen Namen zu mögen«, sagte der Lehrer und lächelte.
»Er stammt aus dem Griechischen und bedeutet Leben«, erwiderte Zoë. »Aber ich glaube, ich schweife ab. Deswegen mach ich’s kurz.«
»Zu spät«, brummte einer in der letzten Reihe.
Zoë ließ sich nicht irritieren. »Wie ich in den Rollstuhl gekommen bin, haben Sie sowieso schon in der Zeitung gelesen. Wobei die meisten Journalisten damals die Tremata vergessen haben, oder sie wissen gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Manche sagen, ich rede manchmal ein bisschen viel...«
»Ist mir noch nicht aufgefallen«, bemerkte der Lehrer und schmunzelte.
»... aber das liegt nur daran, dass ich den Bewegungsdrang, den ich nicht ausleben kann, verbal zu kompensieren versuche. Sagt mein Therapeut.«
»Du bist in Therapie?« Das hier ging schon jetzt weit über die kleine Vorstellungsrunde hinaus, die der Lehrer im Sinn gehabt hatte. Natürlich wusste er, wer Zoë Kamp war. Jeder kannte den Namen ihres Vaters, und seit dieser traurigen Sache vor ein paar Jahren kannte man auch den seiner Tochter.
»Ich war. Mein Vater dachte, ich würde sowas brauchen.«
»Inzwischen gehst du nicht mehr hin?«
»Ich gehe nirgendwo hin, Herr Gerber«, antwortete Zoë.
»Natürlich nicht«, sagte der Lehrer. »Entschuldige.«
»Kein Ding«, entgegnete sie. »Sowas rutscht einem schnell mal raus. Machen Sie’s wieder gut und geben Sie mir einfach bei der nächsten Klausur eine Note besser.«
Ein paar der Mitschüler lachten angesichts dieser kleinen Frechheit.
»Nur ein Scherz«, fügte Zoë hinzu, »ich schreib sowieso immer Einsen.«
»Vielen Dank, Zoë«, sagte der Lehrer und gab sich Mühe, ihren Namen so auszusprechen, wie sie ihn sich vorstellte. Er hatte die Vornoten der Klasse bereits überflogen und wusste, dass sie die Wahrheit sagte.
Bastian, der neben ihr saß, lächelte Zoë verstohlen an. Er hätte sich niemals als Erster gemeldet, in hundert Jahren nicht. Er bewunderte sie, aber das würde er ihr nicht sagen. Als ihr bester Freund wusste er, dass sie weder bemitleidet noch angehimmelt werden wollte.
Früher war Zoë immer vom Chauffeur durch die Gegend gefahren worden. Morgens zur Schule, mittags zurück nach Hause zum Kamp Tower. Der Chauffeur, meistens der überaus freundliche Herr Stöger, hatte sie dann aus dem Rollstuhl gehoben, auf den Rücksitz der Limousine gesetzt, den Rolli zusammengefaltet und in den Kofferraum gelegt. Am Ziel dieselbe Prozedur in umgekehrter Reihenfolge. Zoë hatte das immer gehasst. Diese Rumsitzerei, das ganze Aufgehoben-und-Umhergeschleppt-Werden. Wie einen Blumentopf. Ganz zu schweigen vom Bodyguard im schwarzen Anzug, der auch immer dabei gewesen war. Bei den Fahrten hatte er neben Herrn Stöger gesessen, und wenn sie ankamen, war er als Erster ausgestiegen und hatte die Umgebung gesichert. Unter dem Jackett ein Holster, darin eine Pistole.
»Ich will einen anderen Rollstuhl«, hatte Zoë verkündet, an einem Frühlingstag vor gut zwei Jahren. Ihr Vater hatte erst sie fragend angesehen, dann den Rollstuhl.
»Stimmt was nicht damit?« hatte er gefragt.
»Das Ding ist okay. Solange es keine Treppen gibt.«
»Aber?«
»Ich möchte den Schulweg alleine zurücklegen.«
»Du weißt, wie weit das ist?«
»Siebeneinhalb Kilometer.«
»... die mitten durch die Stadt führen. Eine Kreuzung nach der anderen. Viele hohe Bordsteine. Für so eine Strecke brauchst du über eine Stunde. Deine Arme wären anschließend so müde, du könntest keinen Stift mehr halten.«
»Er müsste halt elektrisch sein.«
»Du wolltest keinen elektrischen. Hast gesagt, das ist was für alte Leute.«
»Ich hab’s mir anders überlegt. Es gibt Modelle, die schaffen fünfzehn Stundenkilometer, da brauche ich nur halb so lang.«
Christian Kamp hatte sich einen Stuhl genommen und sich zu ihr gesetzt. »Gut«, hatte er gesagt. »Einverstanden. Aber du bekommst Begleitung.«
»Brauch ich nicht.«
»Ich kann dich nicht alleine auf die Straße lassen, jeden Tag. Das würde sich herumsprechen.«
Zoë hatte leise geseufzt. »Natürlich. Du bist der reichste Mann von ganz Berlin. Für einen kurzen und wunderschönen Augenblick hatte ich das mal ganz vergessen.«
»Man würde dich entführen, Zoë«, hatte er gesagt. »Vielleicht nicht am ersten Tag. Aber irgendwann ganz sicher. Wir befinden uns mitten in Berlin, hier leben mehrere Millionen Menschen. Darunter – grobe Schätzung – ein paar tausend Spinner, Kriminelle und Psychopathen. Eines Tages hält vor dir ein Lieferwagen, ein paar vermummte Typen springen raus, schieben dich rein, und dann halten sie dich irgendwo gefangen, bis ich ihnen zahle, was sie haben wollen. Das kann ich nicht riskieren.«
»Ich will aber keine Begleitung.«
»Zwei gut trainierte Bodyguards, mehr nicht. Einer läuft vor dir, der andere dahinter. Beide sind bewaffnet.«
»Natürlich sind sie das.« Die Bitterkeit in Zoës Stimme war unüberhörbar gewesen.
»Wir können gleich los«, hatte er vorgeschlagen, »und dir den neuen Rollstuhl besorgen.«
»So will ich das nicht«, hatte Zoë gesagt. »Kannst du vergessen.«
»Dann lass uns überlegen, was wir tun können, Schatz.« Er musterte seine Tochter. Sie wusste, dass er recht hatte. Aber das machte es nicht besser. Niemals würde sie ihm zum Vorwurf machen, was damals geschehen war, drei Wochen vor ihrem zehnten Geburtstag. Niemals. Ihre Mutter hatte das zu oft und zu lange getan, immer und immer wieder, bis Zoë angefangen hatte, sich die Ohren zuzuhalten, sobald sie Mama auch nur von Weitem kommen sah. Papa hatte sich gegen die Tiraden nie zur Wehr gesetzt, weil er selbst sich noch viel größere Vorwürfe machte. Was damals geschehen war, hatte alles verändert. Ein halbes Jahr später hatte Papa den Konzern verkauft, den er immer als sein Lebenswerk bezeichnet hatte. Das hatte in der Öffentlichkeit große Wellen geschlagen, alle hatten sich gefragt, wie viele Milliarden er dafür wohl bekommen hatte.
Zoë wusste, er würde alles für sie tun, was in seiner Macht stand. Und in seiner Macht stand eine Menge. Aber wenn es um ihre Sicherheit ging, war er zu keinen Kompromissen bereit.
»Du beschäftigst die besten Wissenschaftler, Papa. Die besten Techniker. Du kannst mir den krassesten Rollstuhl bauen lassen, den es gibt. Den besten auf der ganzen Welt. Tausendmal besser als zwei noch so gut trainierte und bis an die Zähne bewaffnete Bodyguards.«
Christian Kamp hatte sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen können. Seine Tochter mochte keine Kompromisse. Genau wie er.
»Weißt du noch, damals?«, hatte er gefragt. »Wir waren gerade im Silicon Valley – Mama, du und ich – und du warst fünf Jahre alt.«
»Papa, du lenkst ab.«.
»Damals wolltest du ein Hoverboard. Du hattest diesen uralten Film gesehen, Zurück in die Zukunft, mit dem schwebenden Skateboard. Ich habe versucht, dir zu erklären, dass es das in der Form noch gar nicht gibt, nur im Film. Aber du wolltest das nicht hören, du wolltest, dass ich es bauen lasse, oder du würdest nie mehr dein Gemüse aufessen.«
»Damals war ich ein kleines Kind mit zwei gesunden Beinen«, hatte sie gesagt. »Heute bin ich zwölf, querschnittgelähmt vom dritten Halswirbel abwärts und wünsche mir einfach nur, ich könnte mich ein bisschen normaler fühlen. Ich weiß, ich werde niemals meine Beine bewegen können, und wenn du jemand anders wärst, würde ich die Klappe halten und mein Schicksal einfach akzeptieren. Aber du bist nun mal Christian Kamp. Der Mann, der Träume wahr werden lässt. Deswegen flehe ich dich an: Bitte, Papa, bau mir den Rollstuhl, der in jedem Gelände zurechtkommt, der einen Angreifer abwehren kann, und den du überwachen kannst, ganz egal, wo wir beide uns gerade befinden. Bau mir den Rollstuhl, der mich unabhängig macht von Chauffeuren, Bodyguards und Leuten, die glauben, sie müssten mir die Tür aufhalten. Bitte bau mir einen Rollstuhl, wie die Welt noch keinen gesehen hat.«
Max
Nach der letzten Stunde fuhr Zoë durch die Fußgängerzone nach Hause. Bastian stand hinten auf dem Trittbrett und hielt sich fest. Hier gab es eine Menge angesagter Läden, Touristen aus aller Welt schleppten bunte Einkaufstüten und schossen Selfies. Zoës Rollstuhl verfügte über eine hochentwickelte Sensorik, die es ihm ermöglichte, einen Weg durch das Getümmel zu finden, ohne gesteuert zu werden. Zoë konnte jederzeit das Steuer übernehmen, wenn sie wollte. Es gab nur einen einzigen Menschen, der in der Lage war, sie daran zu hindern – ihr Vater. Christian Kamp konnte den Rollstuhl steuern, ganz egal wo er sich gerade befand. Von dieser Möglichkeit hatte er aber noch nie Gebrauch gemacht. Seine Tochter kam mit diesem Fahrzeug, das sie sich so sehr gewünscht hatte, fantastisch zurecht, und er wollte unter allen Umständen vermeiden, dass sie sich bevormundet und eingeschränkt fühlte.
»Holen wir uns ein Eis«, sagte Zoë.
»Geht klar«, erwiderte Bastian.
»Max, wir fahren zum Buffonacci«, erklärte sie.
»In Ordnung, Zoë«, sagte eine freundliche, männliche Stimme, die aus dem Nichts zu kommen schien. Im nächsten Moment änderte der Rollstuhl die Fahrtrichtung und bog nach links ab. Zoë war verrückt nach Zitrone-Basilikum und das Buffonacci war ihre Lieblings-Eisdiele. An einem so heißen Tag wie heute, was gab es da Schöneres als eine knusprige Waffel mit dem besten Eis weit und breit?
»Die Schlange ist aber ganz schön lang«, sagte Bastian, als sie sich dem Buffonacci näherten.
»Wenn an einem Sommertag vor einer Eisdiele keine Menschenschlange steht«, entgegnete Zoë, »dann taugt sie nichts. Spielen wir die Partie weiter, während wir warten?«
Der Rollstuhl stellte sich brav ans Ende der Schlange.
»Warum nicht«, meinte Bastian, obwohl er schon wusste, dass er verlieren würde.
Zoë bat den Rollstuhl, die laufende Schachpartie aufzustellen. Unter der Bedienkonsole des Rollstuhls schob sich ein rechteckiges Brett hervor. Es nahm eine schwarzweiße Musterung an und Hologramme wuchsen daraus empor, die aussahen wie Schachfiguren.
»Bastian ist am Zug«, sagte die freundliche, männliche Stimme aus dem Nichts, und fügte hinzu: »Ich denke, er wird die Partie verkacken.«
»Danke, Max«, erwiderte Bastian und grinste schief.
Zoë hatte dem Rollstuhl einen Namen gegeben, weil sie fand, dass er einen verdient hatte. Er machte ihr Leben seit zwei Jahren interessanter, spannender und angenehmer. Zoës Vater und seine Leute hatten ihre ganze Energie in dieses Gerät gesteckt, das Fahrzeug, Computer und Roboter in einem war. Dieser Rollstuhl war alles, was Zoë sich erhofft hatte, er stellte das Maximum dessen dar, was ein Roboter in ihren Augen sein konnte. Deswegen hatte sie ihn Max genannt. Er war über sein eigenes WLAN mit dem Internet verbunden und somit in der Lage, jegliche irgendwo verfügbare Information zu verwerten. Er hatte sogar so etwas wie eine eigene Meinung, die man wiederum programmieren konnte. Zoë hatte das Meinungsprofil von Max auf linksliberal eingestellt, mit kritischer bis respektloser Haltung gegenüber Autoritäten. Eben so, wie Zoë sich selbst auch sah. Schließlich wollte sie sich mit ihrem Rollstuhl weder langweilen noch ständig Grundsatzdiskussionen mit ihm führen. Den Humorlevel von Max hielt sie meistens auf siebzig Prozent. Nur manchmal, wenn er ihr zu zynisch wurde, fuhr sie ihn runter auf fünfzig.
Bastian machte seinen Zug, und während Zoë anfing, darüber nachzudenken, ob sie mit dem Läufer oder dem Springer ziehen sollte, ließ Bastian den Blick über die Passanten schweifen. Auf einmal rief er:
»Schau mal, die Dame!«
Zoë musterte irritiert die weiße Dame, die zu ihren Spielfiguren gehörte, und dann die schwarze. Sie wusste nicht, was Bastian ihr sagen wollte. Er deutete mit der ausgestreckten Hand in die Menge.
»Da!«
Zoë folgte seinem Blick und sah eine alte Frau, die sich an den Riemen ihrer Handtasche klammerte. Ein dünner, junger Kerl mit Mütze und Sonnenbrille hatte die Tasche gepackt und versuchte sie ihr zu entreißen.
»Loslassen!«, schrie sie.
»Lass doch selber los!«, blökte er zurück. Er drückte der Frau eine Hand ins Gesicht, mit der anderen zerrte er an der Tasche. »Jetzt mach schon!«, beschwerte er sich. Beim nächsten Ruck gaben die Finger der Frau nach, sie stürzte auf den Asphalt. Den Dieb interessierte das nicht, er klemmte sich die Tasche vor den Bauch und lief davon.
»Max, wir verfolgen den Dieb«, sagte Zoë. »Full Speed.«
Max ließ das Schachbrett verschwinden und drehte sich um knapp neunzig Grad. Bastian hatte gerade noch genug Zeit, um auf das Trittbrett zu springen und sich festzuhalten. Max startete eine Slalomfahrt zwischen den Passanten, mit einem Tempo, das dafür sorgte, dass die Umstehenden ihnen ungläubig hinterher glotzten. Der Rollstuhl schoss auf ein Grüppchen zu, schlug kaum eine Handlänge vor der Brust eines Mannes einen abrupten Haken und schlängelte sich an den Menschen vorbei. So etwas hatten die Leute noch nicht gesehen.
»Schnappt ihn euch!«, rief einer. Bastian sah noch aus dem Augenwinkel, dass mehrere Passanten sich zu der gestürzten Frau hinunterbeugten. Zoë dagegen hatte nur noch Augen für den Dieb. Der sprang auf eine Vespa, hängte sich die Tasche um den Hals, startete den Motor und schoss mit seinem Fahrzeug auf die Straße.
»Mist!«, rief Bastian.
»Max, wir benutzen die Straße«, sagte Zoë. Der Rollstuhl befolgte die Anweisung ohne jede Verzögerung, fädelte sich zwischen zwei Autos in den Verkehr ein und beschleunigte. Sowohl Zoë als auch der auf dem Trittbrett stehende Bastian wurden ohne ihr Zutun angeschnallt. Der Dieb wiegte sich in Sicherheit. Dass er verfolgt wurde, hatte er noch gar nicht bemerkt. Mit zufriedenem Lächeln cruiste er locker dahin, als etwas neben ihm auftauchte, mit dem er nicht gerechnet hatte.
»Lass die Tasche fallen!«, rief Zoë zu ihm hinüber. »Oder es gibt Stress!«
Der Dieb brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass neben ihm zwei Kinder mit einem Rollstuhl fuhren. Dann riss er das Steuer herum und bog ab, im sicheren Gefühl, seine seltsamen Verfolger würden nun abreißen lassen müssen. Er wusste nicht, dass das, womit er es zu tun hatte, nur aussah wie ein Rollstuhl, in Wirklichkeit aber ein Hochpräzisionsfahrzeug war, wie es kein zweites gab. Bremsscheiben aus Carbon, wie sie sonst nur in Rennwagen und Militärflugzeugen verbaut wurden. Ein dreihundert Kilogramm schweres Akkupack, das zum einen dafür sorgte, dass Max auch durch eine Vollbremsung bei schärfster Kurvenfahrt nicht umgeworfen wurde, und zum anderen dafür, dass er in der Lage war, in einskommazwei Sekunden von null auf vierzig Stundenkilometer zu beschleunigen. Es war für Max eine denkbar leichte Übung, noch rechtzeitig die Kurve zu kriegen und dem Dieb zu folgen, der sich durch sein waghalsiges Manöver nur einen Vorsprung von wenigen Metern erarbeiten konnte. Kurz darauf waren Zoë und Bastian mit ihm schon wieder gleichauf.
»Haut ab!« rief er ihnen zu. »Verpisst euch!«
»Und wenn nicht?!« Zoës Stimme klang herausfordernd. Ihre Augen funkelten. Das Ganze machte ihr Spaß, ihr Vertrauen in Max war grenzenlos. Bastian dagegen schwitzte. So etwas war nichts für ihn, aber bei Zoë musste man eben immer mit allem rechnen. Außerdem war er ja selber schuld, schließlich war er es gewesen, der sie auf den Diebstahl aufmerksam gemacht hatte. Aber was hätte er machen sollen? Den Mund halten? So ein Feigling war er nun auch wieder nicht! Der Dieb beherrschte den Motorroller ziemlich gut, er bog in voller Fahrt ab auf eine Treppe, die hinunter in eine U-Bahn-Station führte. Auch Max steuerte ungebremst auf die Treppe zu.
»Ach du Scheiße«, murmelte Bastian.
»Festhalten, Leute«, sagte Max. Und schon kachelte er die Treppe hinunter, als würde er das jeden Tag machen. Sein hydropneumatisches Federungssystem war mit einer Kamera gekoppelt – so wusste Max immer schon ein bis zwei Sekunden im Voraus, wie der Untergrund beschaffen sein würde, und konnte sich darauf einstellen. Fast erschütterungsfrei raste er über die Stufen, ohne dass seine beiden Passagiere besonders durchgeschüttelt wurden. Ganz im Gegensatz zum Dieb, dem am Fuße der Treppe fast der Döner hochkam, den er vor einer halben Stunde verzehrt hatte. Trotzdem nahm er auch noch die zweite Treppe, die hinunter zu den Gleisen führte, vorbei an verdutzten Fahrgästen, die ihm entgegenkamen. Sie starrten ihm noch entgeistert hinterher, als sie es erneut über sich rumpeln hörten und fassungslos zusahen, wie auch noch ein Rollstuhl mit zwei Jugendlichen zwischen ihnen hindurch schoss. Der Dieb hatte offensichtlich einen Plan. Einen wahnsinnigen zwar, aber immerhin war es ein Plan. Er sprang mit dem Roller hinunter ins Gleisbett. Das Fahrzeug ächzte, als wolle es auseinanderfallen, aber es hielt. Der Dieb stauchte sich den Steiß, das Hinterrad brach zur Seite aus, aber er brachte den Roller wieder unter Kontrolle und fuhr mit voller Geschwindigkeit in den Tunnel, wo er von Dunkelheit umfangen wurde. Max folgte ihm und sprang ebenfalls auf die Gleise. Während der Dieb den Schutz der Dunkelheit bevorzugte, schaltete der Rollstuhl seine Frontscheinwerfer an, die den finsteren Tunnel in blendend helles Licht tauchten. Dem Dieb gefiel nicht, wie die Sache sich entwickelte. Verdammt, es war doch nur die Handtasche einer alten Dame. Wenn er Pech hatte, befand sich darin nur ein bisschen Kleingeld! Und deswegen so ein Aufriss. Dabei wollte er heute mal eine ruhige Kugel schieben, nur zwei, drei alte Knacker beklauen und dann in der Eckkneipe abhängen und ein paar wohlverdiente Feierabendbiere zischen. Sein Hintern tat weh wie Hölle, vom Sprung ins Gleisbett. Was waren das überhaupt für blöde, kleine Kinder, die da hinter ihm her waren? Die würden schon noch sehen, was sie davon hatten.
»Max, bitte identifizieren: Fahrzeug und Zielperson«, sagte Zoë.
Zwei Atemzüge später antwortete der Rollstuhl: »Der Motorroller wurde vor drei Tagen in Charlottenburg als gestohlen gemeldet. Die Gesichtserkennungsprogramme ergeben keinen eindeutigen Treffer.«
»Wegen der Mütze und der Brille?«
»Richtig, Schätzchen.«
»Max, du sollst mich nicht so nennen. Das ist politisch total inkorrekt. Ich schraub an deinem Profil rum, wenn du damit nicht aufhörst.«
Sie kamen dem Dieb auf seinem Motorroller immer näher. Trotzdem lächelte er grimmig, denn er sah das Licht, das am Ende des Tunnels von der Wand reflektiert wurde. Eine U-Bahn kam ihnen entgegen. Gleich würde diese nervige kleine Verfolgungsjagd beendet sein. Mit einem kleinen Sprung setzte er den Roller neben die Schienen und hielt sich dicht an der Wand. Die Scheinwerfer des Triebwagens wurden sichtbar, der Zug kam direkt auf sie zu. Der Dieb wusste: Sein Fahrzeug war schmal genug, um ungeschoren vorbei zu kommen – dieser bescheuerte Rollstuhl, oder was immer das auch war, das ihn verfolgte, war aber definitiv zu breit. Wenn die Kinder rechtzeitig absprangen, würden sie sich retten können, ihr Fahrzeug aber würde zerschmettert werden. Dumm gelaufen, Leute. Er konzentrierte sich darauf, möglichst nah an der Wand entlang zu fahren, und als die U-Bahn näher kam, stoppte er den Roller und lehnte sich gegen die kühle Mauer. Der Luftzug des Triebwagens, der an ihm vorbeidonnerte, riss ihm fast die Mütze vom Kopf.
Max hatte das Problem bereits sehr früh erkannt: Schon bevor der Dieb das Licht der nahenden Scheinwerfer erkannte, spürten die Sensoren des Rollstuhls die leichten Erschütterungen, die durch den Boden liefen und den Zug ankündigten. Einen Sekundenbruchteil später hatte Max die Tunnelpläne der Berliner U-Bahn heruntergeladen, und auf seiner Festplatte begann ein komplexer mathematischer Rechenprozess, der folgende Frage zu lösen versuchte: Würde er die nächste Ausbuchtung im Tunnel, die zu einem der zahlreichen Notausgänge führte, rechtzeitig erreichen? Oder würde Max gezwungen sein, eine Hundertachtzig-Grad-Drehung zu vollführen und dem Zug davonzufahren? Letzteres würde zweifellos gelingen, aber vermutlich zur Folge haben, dass man den Dieb auf dem Motorroller nicht erwischen würde. Max brauchte keine zwei Sekunden, um den Rechenvorgang komplett auszuführen. Es würde knapp werden, aber es würde funktionieren – vorausgesetzt, die Tunnelpläne stimmten. Max beschleunigte die Fahrt und hielt frontal auf den Triebwagen zu, ganz so, als habe er sich zu einer Kollision in voller Fahrt entschieden. Bastian fing an zu schreien, und auch Zoë wusste – zum allerersten Mal – nicht mehr, ob sie ihrem Rollstuhl noch vertrauen sollte. Unmittelbar vor einem möglichen Zusammenstoß führte Max eine Neunzig-Grad-Drehung aus, so abrupt, dass Bastian die Brille vom Gesicht gerissen wurde. Max und seine Passagiere schienen gegen die Tunnelwand zu krachen – aber die Vertiefung war genau an der richtigen Stelle. Unmittelbar vor der Notausgangs-Tür mit dem beleuchteten Schild darüber kamen sie zum Stehen. Sie rissen die Köpfe herum. Hinter ihnen tobte kreischend die U-Bahn durch den Schacht. Ihr Luftzug verpasste Zoë und Bastian für ein paar Sekunden Sturmfrisuren, dann sahen sie die Rücklichter des Zuges, der schnell vom Tunnel verschluckt wurde.
»Ich hab mir fast in die Hose gemacht«, stammelte Bastian.
»Siehst lustig aus ohne Brille«, sagte Zoë.
Bastian hatte noch nicht einmal Zeit, das Gesicht zu verziehen, da wurde er schon wieder in den Gurt gedrückt. Max rollte zurück zwischen die Schienen und nahm die Verfolgung wieder auf.
Der Dieb ließ sich jetzt Zeit. Er war zufrieden. Noch nie hatte ihn jemand auf der Flucht erwischt. Er war eben einfach der Beste. Im nächsten U-Bahnhof stoppte er den Roller, stieg auf die Plattform und zog das Fahrzeug in aller Seelenruhe hinauf. Gut hatte er das gemacht. Nur der Hintern schmerzte. Ob die Kinder das wohl überlebt hatten? Er würde es morgen in der Zeitung lesen. Es war nicht seine Angelegenheit, er hatte nicht darum gebeten, verfolgt zu werden. Aus dem Schacht drangen Geräusche. Irgendein merkwürdiges Gerumpel. Aber es klang nicht wie eine U-Bahn, dafür war es zu leise. Das Licht von Scheinwerfern leuchtete auf. Der Dieb stöhnte leise.
»Och nö«, sagte er. »Das muss doch jetzt wirklich nicht sein.
Max kam aus dem Tunnel gefahren, als wäre nichts gewesen. Die Gesichter der beiden Kinder waren ein bisschen staubig.
»Mann, seid ihr hartnäckig«, murmelte der Dieb. Ob er wollte oder nicht: Jetzt bekam er Angst vor den beiden. Und vor dem Höllengefährt, mit dem sie unterwegs waren. Er ließ den Roller los und flüchtete zu Fuß. Die Rolltreppe hoch, zwischen den Leuten durch, noch eine Rolltreppe, schon war er oben. Er keuchte. Der blöde Döner lag ihm im Magen. Der Hintern jaulte vor Schmerz. Da drüben war diese riesige Baustelle, er lief darauf zu.
Max erreichte das obere Ende der Treppe und lokalisierte den Dieb, der auf den Bauzaun zulief. Die Tasche der alten Dame baumelte ihm am Rücken. Er sprang an den Zaun, seine Finger krallten sich zwischen die schmiedeeisernen Streben, und behände wie ein Affe kletterte er daran empor, das schmerzende Gesäß, so gut es ging, ignorierend. Er ließ sich auf die andere Seite fallen, während Max, Zoë und Bastian vor dem Zaun zum Stehen kamen. Bastian kniff die Augen zusammen, ohne Brille konnte er nur noch schemenhaft erkennen, was vor sich ging.
»Na, ihr kleinen Deppen?«, spottete der Dieb. »Das war’s dann wohl.«
»Materialsperre lösen«, sagte Zoë.
»Hä?« machte Bastian. Er wusste nicht, dass Max darauf programmiert war, keinen Schaden anzurichten und nichts zu zerstören. Die Materialsperre zu lösen, bedeutete, diesen Teil seiner Programmierung außer Kraft zu setzen. Max fuhr einen stählernen Arm aus und begann damit ein Loch in den Zaun zu schneiden. Dem Dieb klappte der Mund auf. Er drehte sich weg, stolperte und fiel fast über die eigenen Beine. Der Anblick des Stahlarms mit der Schere, die durch das dicke Metall drang wie ein Messer durch die Butter, war zu viel für ihn. Er lief davon, zwischen Baggern, turmhoch aufgeschichteten riesigen Betonplatten und einem dreißig Meter hohen Kran. Während Wut und aufkommende Panik in ihm wetteiferten, versuchte er, irgendwo auf dieser Großbaustelle etwas zu finden, das ihm weiterhelfen konnte.
Das Loch im Zaun war schnell groß genug für Max.
»Kopf einziehen, Bastian«, sagte er. Bastian tat, wozu der Rollstuhl ihn aufforderte, und schon rollten sie quer über die Baustelle. Gearbeitet wurde heute nicht, außer ihnen war niemand hier. Eine Stimme meldete sich, aber es war nicht die von Max. Es war Zoës Vater. Auf dem Monitor der Bedienkonsole erschien sein Gesicht. Zoë konnte sehen, dass er in seinem Büro saß, im 239. Stock des Kamp Towers, in über neunhundert Metern Höhe. Christian Kamp schien beunruhigt.
»Wo bist du?«, fragte er. »Ist das eine Baustelle?«
Kamp standen zwei Blickwinkel zur Verfügung, zum einen sah er Zoë, zum anderen hatte er Zugriff auf Max’ Frontkamera. Ein dritter Monitor zeigte ihm eine Landkarte mit einem pulsierenden blauen Punkt darauf, der den Aufenthaltsort von Max zeigte.
»Bei uns ist alles okay!«, versicherte Zoë. Doch ihre Stimme war ein bisschen zu hektisch und ein bisschen zu laut.
»Was machst du denn in Moabit?« wollte er wissen. »Und lüg mich nicht an, Zoë, bitte.«
Max steuerte das Ende der Baustelle an. Der Dieb stand wieder am Bauzaun. Er keuchte schwer, war total ausgepumpt und hielt sich das schmerzende Steißbein. Die andere Hand klammerte sich kraftlos an den Metallstreben fest. Er würde in absehbarer Zeit nicht noch einmal über den Zaun klettern können. Er saß in der Falle.
»Max, bleib stehen«, sagte Zoë. Der Rollstuhl verlangsamte seine Fahrt und kam zum Stillstand.
»Wer ist das?« Kamps Stimme wurde hart. »Du sagst mir sofort, wer das ist.«
»Er hat einer Frau die Handtasche geklaut, Papa. Er ist ein mieser, kleiner Dieb. Wir wollen nur, dass die Frau ihre Tasche wieder bekommt.«
Kamp zog scharf Luft ein. »Zoë, spinnst du? So geht das nicht, du kannst nicht einfach...«
»Es ist ein bisschen ausgeufert, okay, aber wir meinen es doch nur gut.«
»Schatz, du bist nicht die Polizei, und Max ist kein Streifenwagen. Ich muss dir jetzt die Kontrolle über ihn entziehen.«
Sie schrie entsetzt auf: »Neein!!«
»Du lässt mir keine andere Wahl.«
Der Dieb keuchte noch immer. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann griff er in seine dünne Jacke und holte etwas hervor.
»Was tut er?« wollte Bastian wissen, der es ohne Brille nicht genau sehen konnte. »Was hat er da?«
»Es ist eine Pistole«, erwiderte Zoë ungläubig. »Er richtet sie auf uns.«
»Schluss mit lustig«, sagte der Dieb und kam zwei Schritte näher.
»Max, ich übernehme jetzt«, sagte Kamp mit tonloser Stimme.
»Geht klar, Chief«, erwiderte Max. Seine Materialsperre wurde dadurch automatisch wieder aktiviert.
Im selben Moment löste Bastian seinen Gurt, verließ das Trittbrett und baute sich vor dem Rollstuhl auf.
Zoë verlor die Fassung: »Basti, was machst du denn da? Bist du irre?«
»Du wirst ihr nichts tun, hörst du?«, sagte Bastian und kniff die kurzsichtigen Augen zusammen.
»Bastian, zurück an deinen Platz!«, rief Kamp. »Damit Max sich zurückziehen kann!«
»Tu, was er sagt, Basti, bitte!«, flehte Zoë.
Der Dieb richtete die Waffe nun auf Bastians Kopf. Er kam noch näher, mehrere Schritte. Obwohl erst vierzehn Jahre alt, war der Junge ein paar Zentimeter größer als der Mann, der ihn bedrohte.
»Sieh mal einer an«, sagte er, »jemand will den Helden spielen.«
»Papa, gib mir die Kontrolle zurück«, zischte Zoë. »Jetzt!«
»Willst du wissen«, fuhr der Dieb fort, »wie sich das anfühlt, wenn man die Mündung einer Smith & Wesson an die Birne gedrückt bekommt?«
Bastian schwieg. Sein Atem ging schwer, durch den offenen Mund. Der Dieb drückte ihm den Lauf auf die Mitte der Stirn.
»Das hat was, oder? Du halbe Portion. Schön kühl. Angenehm bei der Hitze. Aber das Beste ist das leise Klicken, wenn sie entsichert wird.« Er hielt den Lauf gegen Bastians Stirn gedrückt, und mit der anderen Hand bewegte er den Sicherungshebel.
»Max«, flüsterte Kamp, »ich gebe Zoë die Kontrolle zurück.«
»Materialsperre lösen!«, bellte Zoé. »Entwaffne ihn!«
Es wäre zwar übertrieben zu behaupten, was dann geschah, sei mit bloßem Auge kaum zu erkennen gewesen – aber es geschah doch sehr, sehr schnell und überrumpelte alle Beteiligten. Max ließ den Greifarm hervorschnellen, dicht vorbei an Bastians Kopf. Eine stählerne Hand umschloss die Pistole, richtete den Lauf nach oben und zerquetschte die Waffe, als wäre sie aus Pappe. Trotzdem löste sich noch ein Schuss. Er ging nach schräg oben und traf ein dickes, stählernes Halteseil, was aber keine weiteren Folgen zu haben schien. Der Dieb starrte zitternd auf seine Hand. Sie war unversehrt. Sein Gesicht nahm schlagartig eine kalkweiße Farbe an. Viel gesünder sah Bastian auch nicht aus.
»Ihr... ihr seid ja vollkommen behämmert«, stammelte der Dieb. Er zog sich die Tasche vom Rücken und ließ sie in den Staub der Baustelle fallen. Dann machte er mit erhobenen Händen einen weiten Bogen um Zoë, Bastian und Max, um schließlich im gestreckten Galopp davonzulaufen. Niemand sagte etwas, auch Kamp nicht. Deswegen hörten alle dieses Schnalzen, wie von einer Peitsche. Zoë und Bastian blickten nach oben. Das stählerne Halteseil war gerissen, und kurz darauf folgte ein zweites Schnalzen. Und ein drittes. Ein viertes. Die gerissenen Seile schwangen durch die Luft wie ein in Aufruhr geratenes Schlangenloch. Die riesigen Betonplatten, die von ihnen zusammengehalten worden waren, gerieten ins Rutschen. Langsam zunächst, doch dann immer schneller, bewegten sie sich mit Donnergrollen auf die Kinder mit dem Rollstuhl zu.
»Max«, stammelte Zoë: »Rückzug. Aber nur mit Bastian. Sofort!«
Bastian starrte wie eine Statue auf die gewaltigen Betonmassen, die sich auf ihn zubewegten, als er vom Greifarm am Kragen gepackt und hochgehoben wurde. Max brachte Zoë und Bastian aus der Reichweite der niederstürzenden Platten, die auf dem Boden zerbarsten und mit voller Wucht gegen den Kran schlugen. Ein schrilles Quietschen drang ihnen bis ins Mark, und durch den aufsteigenden Betonstaub hindurch sahen sie etwas, das sie nicht wirklich begriffen: Der Kran begann sich zu neigen. Das hatte zur Folge, dass sein Schwenkarm sich in dieselbe Richtung zu drehen begann. Langsam. Schneller. Dann, mit durchdringendem Knirschen, hörte der Kran auf, sich zu neigen. Zoë atmete schon durch. Doch es knirschte erneut, und der Kran gab vollends nach. Er stürzte. Der Schwenkarm traf zuerst auf der Straße jenseits der Baustelle auf und knickte ab. Der Kran begrub den Bauzaun unter sich und ein paar Autos, die direkt neben der Baustelle parkten. Alles verschwand unter einer Staubwolke epischen Ausmaßes. Zoë und Bastian starrten auf die Katastrophe, wobei nur Zoë sie in voller Schärfe zu sehen bekam.
Bastian sagte: »Wenn man seine Brille schon mal wirklich brauchen könnte, liegt sie kaputt in irgendeinem U-Bahn-Schacht.«
Das Geheimnis
Leugnen war zwecklos. Mehrere Überwachungskameras in den beiden U-Bahnhöfen hatten die skurrile Verfolgungsjagd zwischen dem Motorroller und dem Rollstuhl dokumentiert, und ein U-Bahn-Gast hatte ein Wackelvideo davon gedreht, wie Max aus dem Gleisbett gesprungen und die Treppe hinaufgefahren war. Diese Bilder waren innerhalb weniger Minuten auf allen Sendern und Social-Media-Kanälen zu sehen, genau wie die Aufnahmen der Baustellen-Überwachungskamera. Christian Kamp besprach mit Rebekka Dorn, der Leiterin seiner Rechtsabteilung, was jetzt am besten zu tun sei. Die junge Anwältin riet ihm zur Flucht nach vorne. Wer Rebekka nicht kannte, hätte sie für eine Jura-Studentin halten können, die im Kamp Tower gerade ein Praktikum absolvierte. Aber Kamp wusste genau, was er an ihr hatte. Während die Polizei noch herauszufinden versuchte, wer der Schütze und wer die beiden Jugendlichen waren, rief er die nächste Dienststelle an. Wenige Minuten später betraten zwei Polizeibeamte in Zivil den Kamp Tower und fuhren in den 240. Stock. Der Aufzug legte die 941 Meter in fünfzehn Sekunden zurück, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa zweihundert Stundenkilometern entsprach. Es handelte sich um den schnellsten Personenaufzug der Welt, konstruiert von einem Wissenschaftler, den Kamp von der NASA abgeworben hatte. Aber das interessierte die Polizisten nicht, sie waren hier, um Licht in den desaströsen Vorfall auf der Baustelle in Moabit zu bringen. Kamp bat sie auf die Dachterrasse, weil er wusste, dass es auf die meisten Menschen eine besondere Wirkung hatte, vom höchsten Punkt der Stadt hinunter zu blicken. Viele, die zum ersten Mal hier oben waren, wurden irgendwie demütig und empfanden Probleme, die ihnen eben noch sehr bedeutungsvoll vorgekommen waren, auf einmal als winzig klein und nahezu belanglos. Es war ein Trick, der oft funktionierte. Kamp hatte hier schon viele Besprechungen abgehalten und Verhandlungen geführt, mit Menschen, die sich vom Rundumblick einfach nicht losreißen konnten. Im Osten konnte man bis nach Polen schauen, im Südwesten fast bis nach Magdeburg. Das Leben fühlte sich leichter an, ob man wollte oder nicht. Die beiden Beamten stellten sich vor als Kriminalhauptkommissarin Grün und Kriminaloberkommissar Wiesner. Die Frau hatte also das Sagen, woran sie auch keinen Zweifel ließ. Sie tauschte mit Kamp einen festen Händedruck und begrüßte ihn freundlich. Ihre liebenswürdige Erscheinung ließ in ihm – und auch in Zoë und Bastian – zunächst die Hoffnung aufkommen, das Verhör werde unkompliziert verlaufen. Alle setzten sich hin, außer Zoë, die sowieso schon saß, und dem Assistenten der Kommissarin, der, wie magisch angezogen, zum brusthohen Geländer ging und staunend in die Tiefe blickte.
»Wow, was für eine Aussicht«, sagte er. »Das musst du dir mal ansehen.«
Sylvia Grün ignorierte die Aufforderung des Kollegen. Sie hatte eine Menge Fragen und nicht die Absicht, sich durch irgendetwas ablenken zu lassen. Die Videos, die sie gesehen hatte, ließen darauf schließen, dass dieser bemerkenswerte Rollstuhl in der Lage sein musste, mindestens vierzig Stundenkilometer schnell zu fahren. Zulässig war aber laut Straßenverkehrsordnung nur Tempo zwanzig.
»Wollen Sie denn gar nichts wissen über den Handtaschendieb?«, fragte Christian Kamp. »Und über die Vorgänge auf der Baustelle?«
»Alles zu seiner Zeit«, antwortete die Kommissarin. »Dazu komme ich gleich.«
Zoë mochte die Frau irgendwie. Sie schien eine zu sein, die sich nichts vormachen ließ. Hübsch und trotzdem knallhart, so wie Polizistinnen gerne in Filmen dargestellt wurden.
Bastian hingegen fühlte sich von ihr in die Ecke gedrängt, obwohl sie ihn bisher noch gar nicht angesprochen hatte. Er war fest davon überzeugt: Wenn er log, würde sie es sofort merken. Wie gut, dass er sie ohne Brille nur so undeutlich sehen konnte.
»Zuerst möchte ich wissen, was dieser Rollstuhl alles kann«, sagte die Kommissarin. »Außer viel zu schnell zu fahren.«
»Er ist ein ganz normaler Rollstuhl«, antwortete Kamp mit dem allerunschuldigsten Lächeln, das er im Angebot hatte.
»Ist das eine Hammer-Aussicht«, bemerkte Kommissar Wiesner, der noch immer mit leicht geöffnetem Mund am Geländer stand.
»Auf dem Baustellenvideo«, fuhr die Kommissarin ungerührt fort, »ist leider nicht zu sehen, wie der unbekannte Mann, die Jugendlichen und der Rollstuhl auf das Gelände gelangt sind. Wir haben nur ein Loch im Bauzaun gefunden, und etwas an diesem Loch ist auffällig.«
Sie machte eine Pause, um ihrer Scharfsinnigkeit angemessenen Raum zu geben.
»Was denn?«, fragte Kamp.
»Da ist ein einzelner Mann«, sagte sie, »der verfolgt wird und auf das Baustellengelände flüchten will. Wenn er nun ein Loch in den Bauzaun schneidet, wird dieses Loch nicht sonderlich breit ausfallen. Es wird schmal sein, gerade so, dass er hindurch passt.«
»Ich habe das Loch in den Zaun geschnitten«, log Zoë schnell. »Ich hatte eine elektrische Metallschere dabei«
»Ach ja?« Die Kommissarin wandte sich ihr zu. »Wofür denn?«
»Bevor wir gehen, musst du dir das aber schon noch anschauen«, sagte Kommissar Wiesner. »So eine Aussicht auf Berlin hast du noch nie...«
»Kannst du dich endlich mal da losreißen? Wir führen hier eine Ermittlung.« Die Stimme von Sylvia Grün wurde scharf. Ihr Kollege ließ das Geländer los, als sei es auf einmal glühend heiß geworden, kam näher und blieb neben ihr stehen.
»Setz dich hin«, sagte sie. »Wenn du da rumstehst, das macht mich nervös.«
Gehorsam nahm er neben ihr Platz und lächelte schweigend. Zoë war ihm insgeheim dankbar, denn das Geplänkel zwischen den Kriminalbeamten hatte ihr Zeit gegeben, sich eine kleine Geschichte zurechtzulegen.
»Ich wollte eigentlich auf den Schrottplatz«, behauptete sie. »Um dort ein paar Blechteile von alten Autos zu besorgen, für ein Kunstwerk, wissen Sie. Eine Installation aus Blech und Stahl, es soll etwas werden, das die Völker der Welt darstellt in all ihrer Vielfältigkeit und Großartigkeit. Ein Hilferuf der Menschlichkeit in einer grausamen, dunklen Zeit.«
Zoë hatte fast ohne Punkt und Komma geredet, und die Polizisten starrten sie nun prüfend an.
»Sowas machen Sie?«, fragte Wiesner.
»Sie können ruhig Du sagen. Wir sind vierzehn. Ich fange mit dieser Art Kunst gerade erst an. Jedenfalls haben wir die Schere benutzt, um den Handtaschendieb weiter verfolgen zu können.«
»Stimmt das?«, fragte die Kommissarin und sah Bastian an.
Er zögerte kurz, dann nickte er mit dem Kopf und sagte knapp: »Ja, so war’s.« Bastian senkte den Blick. Bestimmt hatte sie ihn schon durchschaut, daran hatte er nicht den geringsten Zweifel.
Doch die Polizistin nahm wieder Zoë unter die Lupe und wollte wissen, wo diese elektrische Metallschere jetzt war.
»Keine Ahnung. Wir haben sie in der ganzen Aufregung wohl irgendwo verloren.«
Zoës Vater meldete sich jetzt zu Wort. »Die Kinder sind von einem gefährlichen, räuberischen Gewalttäter massiv bedroht worden, und alles, wofür Sie sich interessieren, ist der Verbleib einer Drahtschere?«
»Damit kommen Sie schon zu dem Thema, das tatsächlich noch viel interessanter ist«, sagte sie und schenkte Kamp zum ersten Mal so etwas wie den Anflug eines Lächelns. »Was ist da geschehen auf dieser Baustelle? Was hat dazu geführt, dass der Kran umgefallen ist?«
Zoë schilderte den Hergang wahrheitsgemäß bis zu dem Moment, als Bastian vom Dieb mit der Waffe bedroht worden war. Dann sah sie ihren Freund auffordernd an. Bastian musste schon wieder lügen. Wie er das hasste.
»Ich habe ihm in den Arm gegriffen«, sagte Bastian, »und ihn zur Seite gedrückt. Dabei hat er die Pistole fallen lassen.«
»Obwohl der Mann dir den Lauf der Waffe an die Stirn gedrückt hat?«
»Ich habe nicht nachgedacht. Es war ein Reflex.«
»So mutig siehst du gar nicht aus«, bemerkte Kommissar Wiesner. »Er hätte dich erschießen können.«
»Mit Mut hatte das nichts zu tun«, antwortete Bastian. »Das alles nicht. Wir hätten ihn gar nicht erst verfolgen sollen.«
»Wir haben die Waffe gefunden«, sagte die Kommissarin. »Das Fabrikat war kaum noch zu erkennen, sie bestand nur noch aus zerdrückten, geborstenen Einzelteilen. Was denkt ihr, wie ist das zu erklären?«
»Sie haben ja gesehen, was da los war«, antwortete Zoë. »Da ist noch viel mehr zu Bruch gegangen als nur die Pistole.«
Die Kommissarin wandte sich wieder Christian Kamp zu und fragte: »Was haben Sie an diesem Rollstuhl alles machen lassen? Sie können es mir ruhig sagen, wir finden es sowieso heraus.«
»Er ist ein bisschen zu schnell, das gebe ich zu. Das ist aber auch alles.«
»Nun gut«, sagte die Kommissarin, »wir werden ihn mit aufs Revier und gründlich unter die Lupe nehmen.«
»Selbstverständlich«, erwiderte Kamp.
Zoë nickte nur. Die Kommissarin stand auf, ihr Kollege ebenfalls.
»Du musst dir unbedingt...« setzte er an, doch ein strenger Blick von Kommissarin Grün brachte ihn zum Schweigen. Sie hasste es, verarscht zu werden, und sie hasste es, wenn Leute wie Christian Kamp mit ihren gewaltigen finanziellen Möglichkeiten versuchten, sich über die Gesetze zu stellen und am Ende dachten, sie würden mit einer Ordnungsstrafe davonkommen. Sie hoffte, die Techniker würden auf dem Revier etwas finden, aber die Gelassenheit von Vater und Tochter ließ sie bereits vermuten, dass das nicht der Fall sein würde. Ganz sicher aber würde Sylvia Grün keinen einzigen verdammten Blick hinunter auf die Stadt werfen.
Der Rollstuhl wurde mitgenommen und auf dem Polizeirevier von mehreren Technikern in seine Einzelteile zerlegt. Sie fanden nichts, außer einem unzulässig starken Elektromotor. Kommissarin Grün bereute, den Jungen nicht gesondert befragt zu haben. Der war unsicher gewesen, die Lügen waren ihm schwer über die Lippen gegangen. Vielleicht sollte sie sich ihn noch einmal vornehmen.
Auf dem Überwachungsvideo der Baufirma sah man, wie der Dieb mit der Pistole auf die Kinder zuging, aber von Bastian, Zoë und Max war das Meiste verdeckt, weil zwischen ihnen und der Kameralinse ein Bagger stand. Deswegen war auch der hervorschnellende Metallarm nicht zu sehen, der die Waffe zerdrückte. Zoë hatte ihren Vater angefleht, der Polizei ein Märchen erzählen zu dürfen. Wenn die Polizei herausgefunden hätte, was Max alles konnte, wäre ihr geliebter Rollstuhl bis ans Ende der Zeitrechnung in der Asservatenkammer gelandet. Um dieses Gefährt bewegen zu dürfen, hätte man einen Waffenschein und einen KFZ-Führerschein benötigt, und überhaupt hätte man das ganze Gerät vom TÜV abnehmen lassen müssen, was ohne Schmiergeld niemals gelungen wäre. Weil Kamp schon vorausgesehen hatte, dass irgendwann einmal Ärger wegen des Rollstuhls drohen konnte, gab es im Materiallager des Kamp Tower ein zweites Modell, das Max zum Verwechseln ähnlich sah. Und das jetzt im Polizeirevier stand.
Kamp wollte nicht, dass es zu Schadensersatzprozessen kam. Er setzte sich mit der Baufirma in Verbindung, mit dem Straßenbauamt und mit den Haltern der zerstörten Autos. Alle wurden von ihm ohne jedes Hin und Her großzügig entschädigt. Der Schaden, für den Kamp aufkam, belief sich insgesamt auf knapp anderthalb Millionen Euro. Alleine schon für den havarierten Kran bezahlte er eine Dreiviertelmillion. Aber wenn man Christian Kamp hieß, beglich man das aus der Portokasse. Vermutlich würde es ein Verfahren geben, um die Schuldfrage zu klären, vor allem gegen den Dieb, wenn er denn gefasst werden würde. Seit ihrem vierzehnten Geburtstag waren die Kinder strafmündig, auch sie würden sich also verantworten müssen. Aber man würde sie nicht verurteilen – zum einen, weil sie den Kerl in guter Absicht verfolgt hatten, und zum anderen waren sie bedroht worden und hatten sich nur dagegen zur Wehr gesetzt. Der Schuss, der die Baustelle und die angrenzende Straße in Schutt und Asche gelegt hatte, war immer noch aus der Pistole des Blödmanns gekommen. So ließ Kamp es sich von seiner Anwältin erklären.
Viel mehr als das alles beschäftigte Kamp, dass seine Tochter in so eine gefährliche Situation geraten war. Er hatte ihr damals mit Max eine Freude machen wollen. Der Rollstuhl sollte ihr Leben angenehmer machen, schöner – und vor allem auch sicherer.
Bastian war schon längst nach Hause gegangen, als Kamp seine Tochter am Rand des Swimmingpools auf der Dachterrasse fand, wo sie – wie so oft – saß und in den Laptop schrieb, der in Max eingebaut war. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, bald würde hier einer dieser spektakulären Sonnenuntergänge einsetzen, die man so nur vom Kamp Tower aus sehen konnte. Sie blickte auf und sah ihn kommen. Beide wussten, das fällige Gespräch würde kein Vergnügen werden.
»Es tut mir leid, Papa«, sagte sie. »Ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber was Besseres fällt mir nicht ein.«
»Zoë, ich muss die Funktionen von Max beschränken. Anders geht es nicht.«
»Was heißt das?«
»Geringeres Tempo, kein Lösen der Materialsperre. «
»Das heißt, ich darf noch mit ihm herumfahren?«, fragte sie hoffnungsvoll.
»Ja, mit zwei Bodyguards.«
Zoë stöhnte auf. »Also sind wir da, wo wir schon einmal waren.«
»Ich habe keine andere Wahl.«
»Und wenn ich verspreche, dass ich nie mehr sowas mache? Nie, nie mehr? Hoch und heilig?« Sie sah ihn flehend an, mit diesem Ich-bin-so-lieb-und-arm-Gesicht, das ihn eigentlich immer zu erweichen vermochte.
Doch er schüttelte den Kopf. »Ich weiß einfach, wie wild du bist. Wie impulsiv.«
»Ich reiß mich zusammen. Wirklich. Ganz ehrlich.«
»Ich glaub dir sogar, dass du das vorhast. Aber du bist einfach nicht wie andere Mädchen.«
»Andere Mädchen haben Beine, mit denen sie gehen können«, erwiderte Zoe bitter. »Und erzähl du mir nichts über unvorsichtiges Fahren, okay?« Ihre Augen begegneten den seinen. Sie sah, wie hart ihn diese Worte trafen.
»Max: in mein Zimmer«, sagte sie tonlos.
Der Rollstuhl setzte sich mit leisem Surren in Bewegung und rollte von der Terrasse. Kamp blieb sitzen. Den beginnenden Sonnenuntergang behielt er im Rücken, etwas so Schönes wollte er jetzt einfach nicht sehen. Nun wusste er wieder ganz genau, wieso er Wafe verkauft hatte und so viel Energie in dieses einzige Projekt steckte, das in seinem Leben noch wirklich wichtig war. Das einzige, für das Kamp Industries – jenseits des ganzen Getöses – noch stand. Er wusste, wie schwierig es war, das Projekt zum Erfolg zu führen. Die Aussicht darauf war mehr als unsicher. Aber er war in der Lage, Mittel zu mobilisieren wie kein Zweiter, und Menschen mit einzigartigen Fähigkeiten zu beschäftigen. Und er hatte Visionen. Vor allem diese eine. Vielleicht würde er doch noch alles wiedergutmachen können – wenn das gelang, woran im 222. Stock gearbeitet wurde. Was er sich vorgenommen hatte, mochte vielleicht nicht mehr als ein Traum sein, aber es war der einzige, den er noch hatte.
Zoë hielt es nie lange aus, mit ihrem Vater zerstritten zu sein. Er war ihr Anker. Der Mensch, der immer für sie da war. Für jemanden in seiner Position war das nicht selbstverständlich, einer wie er hatte normalerweise nie Zeit, jedenfalls nicht für seine Kinder. Zoë kannte andere Wirtschaftsbosse und Stars aus Sport und Kultur, solche Leute gingen bei ihnen zu Hause ein und aus. Kamp nahm seine Tochter mit zu Oscar- und Grammy-Verleihungen und dergleichen. Zoë fand, dass Prominente und Multimillionäre oft eingebildet, affektiert und extrem hohl waren. Ihr Vater aber nicht. Der entscheidende Unterschied war, dass er sich auf das, was er geschafft hatte, nichts einbildete. Das musste man erst mal hinbekommen: Aus dem Nichts heraus ein derartiges Imperium in die Welt setzen und sich dann nichts darauf einbilden. Natürlich war es trotzdem cringe, dass ihr Vater mit seinen sechsundvierzig Jahren immer noch lange Haare trug, wie ein Student im dreiundfünfzigsten Semester. Und viele andere Dinge an ihm empfand sie auch als schräg. Aber wenn man vierzehn Jahre alt war, dann waren alle Eltern peinlich. Egal, wie sie sich benahmen.
Wenn sie sich gestritten hatten, saß anschließend immer einer von beiden am Swimming Pool und wartete darauf, dass der andere ihn dort fand. Es war längst dunkel, und Zoë hätte eigentlich schon ins Bett gehen müssen, schließlich war morgen Früh Schule. Lara, ihre Nanny, hatte Zoë schon zum Zähneputzen geschickt. Aber sie hätte nicht einschlafen können, ohne noch einmal mit ihm zu reden. Kamp saß mit hochgekrempelten Hosenbeinen am Rand des Pools und ließ die Füße ins Wasser baumeln. Die Pool-Beleuchtung machte sein Gesicht härter als sonst, verlieh ihm etwas Scharfkantiges. Sie brachte Max neben ihm zum Stehen.
Kamp zog ihr wortlos die Schuhe aus und dann auch die Strümpfe. Er nahm sie hoch, sie schlang die Arme um ihn. Dann setzte er sie so an den Rand des Pools, dass ihr Rücken von Max gestützt wurde, und nahm neben ihr seinen Platz wieder ein.
»Schade, dass ich das Wasser nicht spüre, sagte sie. »Aber ich weiß noch genau, wie es sich an den Beinen anfühlt.« Wasser war Zoës Element gewesen. Einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit hatte sie in diesem Pool verbracht, eine Bahn nach der anderen war sie geschwommen. Ein halbes Jahr vor dem Unfall hatte sie verkündet, Olympiasiegerin im Schwimmen werden zu wollen.
»Mit den Füßen im Wasser kann es so heiß sein, wie es will, man fängt nie an zu schwitzen«, sagte Christian Kamp. »Ist ein Phänomen.«
»Auch nicht bei vierzig Grad?«
»Damals in meiner Studentenbude hatte ich ein Zimmer unterm Dach. Im Winter war’s da eiskalt, im Sommer hätte ich Eier auf dem Schreibtisch braten können. Wenn ich bei solcher Hitze lernen musste, habe ich die Füße in einen Eimer Wasser gestellt, und alles war gut.«
»Die Erfahrung werde ich niemals machen«, erwiderte Zoë.
Kamp war drauf und dran, ihr zu widersprechen, aber dann riss er sich zusammen und schwieg. Zoë glaubte zu ahnen, was ihm im Kopf herumspukte, ging aber nicht darauf ein.
»Es tut mir leid, Papa, dass ich das gesagt habe«, sagte Zoë. »Du weißt schon, das mit dem Fahren.« Endlich war es raus. Sich zu entschuldigen fand sie echt schwierig, aber manchmal musste es sein, und heute sogar schon zum zweiten Mal.
»Du musst dich für gar nichts entschuldigen«, sagte er. »Ich bin derjenige, der für immer in deiner Schuld steht. Es vergeht kein einziger Tag, an dem...«
»Bitte nicht«, fuhr sie ihm ins Wort.
Sie musste an den Therapeuten denken. Über ein Jahr lang hatte sie den besucht, Woche für Woche. Immer wieder hatte er sie aufgefordert, über jenen Tag zu sprechen. Er meinte, man könne über so etwas nur hinwegkommen, wenn man darüber rede. Eines Tages hatte Zoë ihm widersprochen.
»Sie sind ein freundlicher Mann«, hatte sie gesagt, »und bestimmt auch ein guter Psychologe. Wenn mein Vater Sie anheuert, dann bin ich sogar sicher, Sie sind einer der Besten. Und trotzdem sag ich Ihnen jetzt mal was: Der Tag des Unfalls ist immer da, ich kann ihn spüren, wenn ich morgens aufwache und wenn ich mich abends schlafen lege, und die ganze Zeit dazwischen auch. Ich sehe vor mir, wie es passiert ist, die Bilder haben sich in mich eingegraben, wie ein Fluss sich in die Erde gräbt, für immer und ewig. Es macht keinen Unterschied, ob ich darüber rede. Den Fluss interessiert es auch nicht, ob ich etwas über ihn sage. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, also bleibt mir nur eins: damit klarzukommen. Wie mit einer Fünf in Mathe. Soll ich reden über die Fünf? Sie ganz genau analysieren, in ihre Einzelteile zerpflücken, nach dem tieferen Sinn dahinter forschen? Oder lieber versuchen, es nächstes Mal besser zu machen?«
Es war Zoës letzte Sitzung beim Therapeuten gewesen.
Christian Kamp hatte in den letzten Jahren beobachtet, wie Zoë gelernt hatte, mit ihrer Querschnittlähmung auf bemerkenswert gesunde Weise umzugehen. Er war sehr stolz auf sie. Zoë war ein selbstbewusstes Mädchen mit positivem Gemüt und klarem Verstand. Sie strahlte mehr Lebensfreude aus als viele Andere, denen das Leben nicht so übel mitgespielt hatte. In ihm wüteten viel mächtigere Dämonen als in ihr. Er hatte damals den Unfall verschuldet, bei dem ihr Rückenmarkskanal durchtrennt worden war. Seine über alles geliebte Zoë war damals Opfer seiner Überheblichkeit geworden. Das war es, was ihm seit über vier Jahren Nacht für Nacht den Schlaf raubte. Er hätte eine der hochentwickelten selbstfahrenden E-Limousinen nehmen können, die in der Garage unter dem Kamp Tower im Fuhrpark standen. Aber nein, er musste seine Tochter in dem alten, roten Pontiac Firebird spazierenfahren, obwohl er wusste, dass der Gurt auf der Beifahrerseite kaputt war. Er hatte sich für unbesiegbar gehalten, für unverletzlich. Er, der es vom Sohn eines Gleisarbeiters zu einem der größten Giganten der Weltwirtschaft gebracht hatte! Was sollte ihm schon passieren? Er machte niemals einen Fehler, alles, was er anfasste, wurde in seinen Händen zu Gold. Es war genau diese aufgeblasene Haltung, mit der er seine Tochter in den Rollstuhl gebracht hatte.
Seitdem kannte er nur ein Ziel: Er wollte, dass Zoë dieses Ding wieder verlassen konnte, auf ihren eigenen Beinen! Deswegen hatte er Wafe verkauft. Er brauchte all seine Energie und all sein Geld für das neue Projekt. Das war alles, was für ihn noch zählte.
Er sagte zu ihr: »Dann hör dir wenigstens an, was es Neues gibt.«
»Hat Gallagher zugesagt?«
Kamp nickte. »Ja, ist das nicht fantastisch? Er fängt nächste Woche an, und wenn ich ihn erst einmal der Presse vorgestellt habe, wird es nicht lange dauern, und andere von seinem Kaliber werden folgen.«
Professor Daniel Fitzgerald Gallagher war ein irisch-amerikanischer Forscher, der vor drei Jahren den Nobelpreis für Medizin gewonnen hatte. An der Pennsylvania State University war es Gallagher gelungen, menschliche Nervenzellen nachzubauen und gelähmten Menschen zu injizieren. Mehrere Patienten, die auf diese Weise behandelt worden waren, konnten einzelne gelähmte Finger mittlerweile wieder bewegen. Der Heilungseffekt hielt aber noch nicht sehr viel länger an als ein Jahr, weil die künstlich erzeugten Zellen nach einer gewissen Zeit anfingen, sich zu zersetzen und ihre Wirkung zu verlieren. An der Behandlungsmethode musste also noch sehr viel gearbeitet werden. Christian Kamp war schon seit einer ganzen Weile hinter Gallagher hergewesen. Kamps Plan war, die herausragendsten Köpfe zusammenarbeiten zu lassen – nicht nur, was die unmittelbar relevanten medizinischen Gebiete betraf. Kamp lockte die besten Physiker, Biochemiker und Mediziner nach Berlin in den Kamp Tower, mit Angeboten, die so verlockend waren, dass niemand es fertigbrachte, sie auszuschlagen. Hier konnten sie nicht nur das Zehnfache verdienen, hier fanden sie vor allem auch paradiesische Forschungsbedingungen vor, und jeder Wunsch wurde ihnen von den Augen abgelesen. Gallagher würde nun schon der dritte Nobelpreisträger sein, der im Kamp Tower arbeitete. Kamp hatte zugesagt, ihm das komplette 230. Stockwerk zur Verfügung zu stellen. Er würde sein gesamtes Team aus Pennsylvania mitbringen und konnte darüber hinaus anstellen, wen er wollte, und anschaffen, was er wollte. Direkt darüber, im 231. Stock, befand sich ein exklusives Krankenhaus, spezialisiert auf Spinal-Chirurgie. Dort arbeiteten Chirurgen, Orthopäden und Physiotherapeuten aus aller Welt. Viele von ihnen hatten ihre Chefarztposten aufgegeben, als sie hier angefangen hatten. Die Klinik galt als das bestbesetzte Krankenhaus der Welt.
Zoë wusste das alles. Dennoch war sie nur mäßig beeindruckt. »Das ist toll, Papa, wirklich. Viele Menschen werden davon profitieren, wenn Gallagher jetzt kommt. Da bin ich mir ganz sicher. Aber sei ehrlich: Bis Querschnittlähmung wirklich geheilt werden kann, das dauert doch mindestens noch zwanzig bis dreißig Jahre. Soll ich jetzt Däumchen drehen und darauf warten?«
»Es könnte auch schneller gehen«, erwiderte Kamp.
»Papa, auch ich lese die wissenschaftlichen Magazine. Ich weiß alles über die Forschung. Zwanzig bis dreißig Jahre ist echt mutig gerechnet. Fünfzig bis sechzig ist viel wahrscheinlicher. Vielleicht passiert es, wenn ich so alt bin wie du jetzt, ja, kann sein. Und das wäre dann ganz toll, wirklich, es wäre wie ein Wunder. Aber jetzt bin ich jung, ich will leben und das Beste aus dem machen, was ich habe. Und dafür brauche ich einen Vater, der endlich aufhört, sich Vorwürfe zu machen, verstehst du? Der aufhört, sich schuldig zu fühlen. Ich hab dir doch längst verziehen. Warum kannst du das denn nicht?«
Er zögerte. Atmete tief durch. Er hatte sich fest vorgenommen, den Mund zu halten. Aber jetzt konnte er einfach nicht anders. Er sagte: »Vielleicht geht es sehr viel schneller, als du glaubst.«
Sie hielt den Atem an. Die ganze Zeit hatte sie in das von unten beleuchtete Wasser gestarrt. Die Farbe des Lichts wechselte stets sehr langsam hin und her zwischen Türkis und Lapislazuli. Zoë fand diesen Farbwechsel meditativ, sie starrte oft Minuten oder auch Stunden lang hinein, etwa so, wie andere gerne in Kaminfeuer starrten. Doch jetzt drehte sie den Kopf zur Seite und sah ihren Vater an. Er erwiderte den Blick nicht, sondern hielt seinerseits die Augen auf die Wasseroberfläche gerichtet.
»Wie meinst du das?«, fragte sie.
»Ich sag ja nur«, erwiderte Kamp, der seine Bemerkung längst bereute.
»Du bist alles Mögliche«, sagte Zoë, »aber kein Schwätzer. Du sagst irgendwas nicht einfach nur, um Konversation zu machen.«
»Es ist Wunschdenken, Zoë.«
Doch dafür kannte sie ihn zu gut. Damit würde sie ihn nicht davonkommen lassen. »Gibt es neue Forschungsergebnisse?«
»Noch nicht.«
»Fortschritte mit der K.I.?«
»Auch nicht«, entgegnete er. »Künstliche Intelligenz ist bestens geeignet, um Prozesse zu optimieren, Abläufe zu vereinfachen und eine Menge Zeit zu sparen. Das tun wir bei Kamp Industries schon lange. Haben wir schon, als noch kein Mensch von K.I. geredet hat. Aber du kannst mit ihr nichts Neues entdecken, denn K.I. ist am Ende des Tages nicht in der Lage, über den Tellerrand hinauszublicken.«
»Wieso denkst du dann, es könnte sehr viel schneller gehen?«
Kamp schwieg und starrte weiterhin beharrlich in den Pool.
»Papa, du verheimlichst mir was«, sagte Zoë schließlich. »Das Gefühl hab ich nicht erst seit heute.«
Endlich sah er sie an und erklärte mit einem Lächeln: »Ich hab Hunger, wie wär’s mit einem späten Snack?«
»Du weichst aus«, erwiderte sie, »und du machst es nicht mal gut.«
»Ich zauber uns was zu essen.« Er stand auf und schickte sich an, hineinzugehen.
»Was ist im 222. Stock, Papa?«
Er blieb stehen, sah sich aber nicht nach ihr um. »Das weißt du doch. Ein großes Lager.«
»Wieso darf ich dann nicht hinein?«
»Da steht Zeug, das kaputtgehen kann. Teure Maschinen, an denen man sich verletzen könnte. Präzisionsinstrumente.«
»Du lügst.«
»Wie bitte?« Nun drehte er sich um und sah sie ungläubig an.
»Wie kann ein Mann so großen Erfolg haben, wenn er so unfassbar schlecht lügt?«
»Du versuchst etwas aus mir herauszubekommen, wo nichts ist, Zoë.«
»Ich begreife nicht, dass die Kommissarin dir geglaubt hat. Niemand lügt so schlecht wie du.«
»Sie hat mir gar nicht geglaubt. Sie konnte uns nur nichts beweisen.«
»Was ist im 222. Stock?«
Christian Kamp seufzte. »Du kannst so oft fragen, wie du willst, Zoë«, sagte er. »Ich lass dich da nicht rein. Sind Chips mit Guacamole okay?«
Zoë schwieg.
»Max, pass auf, dass sie nicht reinfällt«, sagte Kamp, dann ging er hinein.
»Geht klar, Chief«, sagte der Rollstuhl.
Zoe blickte wieder hinunter ins Wasser, das gerade bei Lapislazuli angekommen war. Sie drückte ihren Oberschenkel ein wenig zur Seite, damit ihre Füße sich im Wasser ein bisschen bewegten.
»Max, ich bin froh, dass du noch hier bist«, sagte sie leise.
»Ich auch«, antwortete Max.
»Manchmal habe ich das Gefühl, keiner versteht mich so gut wie du.«
»Das freut mich.«
»Du bist der netteste Rollstuhl auf der ganzen Welt.«
»Dankeschön.«
»Sag mal, Max...«
»Ja?«
»Weißt du vielleicht, was sich im 222. Stock befindet?«
»Hast du mir nur geschmeichelt, damit ich Geheimnisse ausplaudere?«
Zoë gab ein unwilliges Geräusch von sich. »Mist. Leider bist du auch der klügste Rollstuhl der Welt.«
»Ich weiß nicht, was sich im 222. Stock befindet, Zoë.«
»Wirklich nicht?«