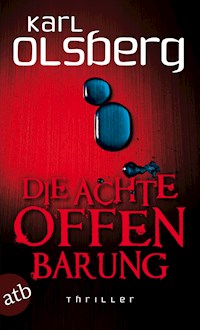14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine futuristische Stadt mit finsterem Geheimnis – gefährlich und unberechenbar KI-Experte Karl Olsberg spinnt eine erschreckend aktuelle Zukunftsversion in seiner actionreichen »Neopolis«-Reihe. Künstliche Intelligenz ist im 21. Jahrhundert genauso real wie Augmented Reality und das macht sich der Autor bei seinem Gedankenexperiment zu nutzen: Er kreiert eine Welt, die einen sofort in den Bann zieht und zukunftsrelevante Fragen aufwirft. Im Jahr 2048 erfüllt sich der begeisterte Gamer Nick einen Traum und reist zur Ultimate-Survivor-Weltmeisterschaft nach Neopolis − eine in der Wüste aus dem Boden gestampfte, halb reale, halb virtuelle Metropole, in der digitale Dschinns als virtuelle Assistenten das Leben erleichtern und mit dem nötigen Kleingeld alle Wünsche erfüllt werden. Doch Nick kommen schnell Zweifel: Ist die Stadt nur eine blendend-laute Matrix mit einem düsteren Geheimnis? Wer sind hier die Guten und wem kann Nick überhaupt noch trauen? Unmöglich, aus der Hand zu legen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Science Fiction!
www.Piper-Science-Fiction.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Neopolis – Die Stadt aus Licht« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: hqrloveq und maxkabakov/ iStock / Getty Images Plus
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
So haben wir jedem Propheten Feinde bestimmt:
Satane aus den Reihen der Menschen und der Dschinn,
die einander mit prahlerischen Reden betrügen.
Aus dem Koran
1.
Der Sand knirschte leise unter meinen Stiefeln, als ich mich geduckt den Dünenhang hinaufbewegte. Auf dem Gipfel legte ich mich hin und spähte durch die Zieloptik meines Präzisionsgewehrs. Die Ruinen schimmerten bläulich im Licht des Halbmonds, der tief über der Wüste hing. Von unseren Feinden war nichts zu sehen. Doch sie waren da, das spürte ich.
»Siehst du was?«
Marios Stimme erklang in meinem Kopfhörer. Seine Aufgabe war es, unsere Flanken zu decken und mir den Rücken frei zu halten.
»Moment«, raunte ich und bewegte die Zieloptik langsam über die verfallenen Mauern. Ein metallischer Kasten kam ins Bild. Ich zoomte auf Maximalvergrößerung.
»Da ist ein Cache«, informierte ich die anderen. »Das Siegel scheint noch unverletzt zu sein, aber genau kann ich das von hier aus nicht erkennen.«
»Das ist eine Falle!«, behauptete Tertia. Sie war manchmal ein bisschen übervorsichtig, doch leider behielt sie oft recht.
»Glaube ich auch«, gab ich zurück. »Aber wir können die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen. Ich gehe rein. Haltet euch im Hintergrund. Wenn das ein Hinterhalt ist, setze ich den Little Man ein.«
»Die Antimateriebombe?«, rief Mario ungläubig. »Wegen eines lausigen Caches, von dem wir noch nicht mal sicher wissen, ob da noch was drin ist? Geht’s noch?«
»Wir wären auf einen Schlag mindestens drei oder vier Gegner los. Und im Endgame ist der Raum eh zu eng, um sie einzusetzen, ohne selbst dabei draufzugehen.«
»Er hat recht«, stimmte mir Tertia zu.
»Also gut«, meinte Mario. »Aber nur im äußersten Notfall. Wir haben verdammt hart um dieses Ding gekämpft, und ich möchte es nicht sinnlos vergeuden. Wer weiß, wozu wir es noch brauchen.«
»Alles klar.«
Noch einmal ließ ich die Zoom-Optik über die Ruinen gleiten. Als ich nichts Verdächtiges wahrnahm, kletterte ich über die Kante der Düne, stolperte auf der anderen Seite herab und rannte im Zickzack auf die nächste Mauer zu. In deren Sichtschutz blieb ich eine Weile hocken und lauschte, hörte aber nur das leise Sirren des Wüstenwinds, der sich an den Mauern rieb.
Vorsichtig spähte ich um die Ecke: nichts. Im Schatten der Mauern schlich ich ins Herz der Ruine. Immer wieder hielt ich inne, um den Boden nach Stolperdrähten und Minen abzusuchen, doch ich stieß weder auf Widerstand, noch gab es Anzeichen für eine Falle. Konnte es wirklich sein, dass das gegnerische Team, dem wir bis hierher gefolgt waren, den Cache schlicht übersehen hatte? Das erschien mir fast zu schön, um wahr zu sein. Aber warum sollten wir nicht zur Abwechslung auch mal ein bisschen Glück haben?
Schließlich erreichte ich den Innenhof. Der Cache stand in der Mitte – eine zwei Meter lange, einen Meter breite und ebenso hohe Metallkiste. Das Siegel über dem Verschluss – eine rote Scheibe, die mit den Buchstaben US und einem gekrönten Totenkopf verziert war – schien tatsächlich unversehrt zu sein.
»Wie sieht’s aus?« Hedgehog, unser viertes Teammitglied, schaltete sich ein.
»Bis jetzt gut«, antwortete ich. »Das Siegel scheint unversehrt. Sieht so aus, als hätten wir diesmal Glück.«
»Mir gefällt das nicht«, meinte Tertia.
»Was sollen wir machen?«, gab Hedgehog zurück. »Den Cache nicht öffnen?«
»Lieber einen Cache auslassen als sterben.« Tertias Stimme klang sorgenvoll.
»Vielleicht hat sich das andere Team das auch gedacht und ist deswegen weitergezogen«, warf ich ein.
Mario lachte. »Klar. Wir sind wahrscheinlich das fünfte oder sechste Team, das an diese Stelle kommt und sich nicht traut, den Cache zu öffnen. Warte, ich komme zu dir.«
»Bleibt lieber, wo ihr seid«, mahnte ich. »Falls es doch eine Falle ist, reicht es, wenn ich allein reintappe.«
»Das könnte dir so passen! Du willst dir doch bloß die besten Stücke schnappen. Wenn da eine Rüstung oder eine Impulswaffe drin ist, will ich sie!«
»Wir entscheiden gemeinsam, wer was kriegt«, entschied Tertia.
Doch wir wussten beide, dass Mario im Prinzip recht hatte: Wir waren bis jetzt ein gutes Team gewesen, aber irgendwann würde es auseinanderbrechen. Nur einer von uns konnte am Ende überleben, falls wir es überhaupt so weit schafften.
Nervös wartete ich darauf, dass die anderen näher kamen.
Mario war der Erste, der den Cache erreichte.
»Los, mach ihn auf!«, drängelte er. Ich konnte im Display erkennen, dass er auf einem privaten Kanal sprach, den nur ich hören konnte.
»Lass uns auf die anderen warten«, entgegnete ich.
»Pfeif auf die anderen! Wir beide machen alleine weiter. Hog ist sowieso nur ein Klotz am Bein, und Tertias dauerndes Genöle geht mir auf die Nerven.«
Es stimmte, Hedgehog und Tertia hatten sich in den bisherigen Kämpfen zurückgehalten und Mario und mich die Drecksarbeit machen lassen. Doch es gab eine Übereinkunft, dass wir uns gegenseitig helfen würden und versuchen, so viele von uns wie möglich unter die letzten sechzehn zu bringen.
»Nein! Wir haben eine Abmachung. Außerdem, wenn wir jetzt schon anfangen, uns gegenseitig zu bekämpfen, helfen wir nur den anderen Teams.«
Mario sah mich stumm an. Sein Gesicht war hinter einer Schutzmaske verborgen, doch mir war klar, was in ihm vorging: Er überlegte, ob er mich hier und jetzt ausschalten und den Cache alleine plündern sollte. Ich spannte mich an, bereit, beim kleinsten Anzeichen einer Attacke meine Pistole zu ziehen. Doch bevor Mario etwas tun konnte, erschienen die beiden anderen.
»Sieh mal an, ihr habt tatsächlich auf uns gewartet«, stellte Tertia fest. »Wer hätte das gedacht!«
»Wir sind eben loyal und zuverlässig«, behauptete Mario.
»Wer’s glaubt.«
»Macht ihr jetzt endlich den Cache auf, oder wollt ihr warten, bis ein anderes Team kommt und uns dabei hilft?« Hedgehog klang hypernervös.
Da ich die Kiste gefunden hatte, stand mir das Recht zu, das Siegel zu brechen, den Deckel zu öffnen und als Erster einen Blick auf die Schätze darin zu werfen. Doch als ich meine Hand danach ausstreckte, erstarrte ich mitten in der Bewegung.
Die Luft über einer Düne jenseits der Ruinen flimmerte auf einmal, rechteckige Umrisse zeichneten sich ab.
»Scheiße!«, rief ich. »Ein Mech mit Tarnvorrichtung! Deckung!«
Ich warf mich hinter den Cache, während die anderen versuchten, sich hinter den niedrigen Mauern in Sicherheit zu bringen. Im nächsten Moment brach die Hölle über uns herein: Der Mech, ein stählernes Ungetüm, das aussah wie eine Hubschrauberkanzel auf zwei Beinen, feuerte aus großkalibrigen Maschinengewehren mit einer Frequenz von mindestens zweihundert Schuss pro Minute. Sand und Steine wurden um uns herum aufgepeitscht.
Tertia schrie auf. Ein Totenkopfsymbol erschien über ihrem Avatar.
»Gegen das Ding haben wir keine Chance.« Hedgehog hatte Panik in der Stimme. »Das ist einfach unfair!«
»Das war’s dann wohl«, grunzte Mario. »Scheiße, ich dachte, wenigstens einer von uns schafft es ins Endgame.«
»Wartet hier«, sagte ich.
»Machst du Witze?«, blaffte er zurück. »Was hast du …«
Der Rest seines Satzes ging im Donnern einer weiteren Maschinengewehrsalve unter.
Ich wartete, bis eine kurze Feuerpause eintrat, sprang auf und rannte im Zickzack auf unsere Angreifer zu. Im Laufen riss ich den Little Man aus der Halterung und entsicherte ihn. Die Zeit reichte nicht, um den Raketenwerfer in Stellung zu bringen, mit dem man die Bombe normalerweise abschoss. Aber das hatte ich auch nicht vor.
Erneut nahm mich der Mech unter Beschuss. Ich schlug Haken und konnte mich ihm so bis auf etwa zwanzig Meter nähern, bevor sich die Maschinengewehre auf mich einschossen. Meine Karbonrüstung wurde innerhalb von Sekunden zerfetzt. Bevor meine Lebensenergie auf null sank, drückte ich den Knopf, der den Little Man zündete. Mein Display wurde rot.
Du bist gestorben, erschien in weißen 3-D-Buchstaben vor mir. Im selben Moment erklang Jubel in meinem Kopfhörer.
»Du hast ihn geschrottet!« Mario war begeistert. »Wow! Danke, Mann!«
»Du hast dich für uns geopfert.« Hedgehog war ganz gerührt. »Du hast was gut bei mir!«
»Schon okay«, erwiderte ich. »Seht zu, dass ihr zwei ins Endgame kommt! Bin jetzt off.«
Ich zog die Hände aus den Griffen und nahm das Headset ab. Es dauerte ein paar Sekunden, bis mein Gehirn registrierte, dass das kleine, unaufgeräumte Apartment am Prenzlauer Berg in Berlin die Realität war und ich mich nicht zwischen Wüstenruinen befand.
Als das schwindelartige Gefühl der Unwirklichkeit abgeklungen war, löste ich den Gurt, mit dem ich mich in meinem Simrig angeschnallt hatte. Leicht schwankend kletterte ich aus dem zwei Meter durchmessenden, runden Metallkäfig. Es war nicht das neuste Modell und quietschte ein bisschen, aber es war gut genug, um die Bewegungen meines Körpers so genau in die virtuelle Welt zu übertragen, dass ich das Gefühl hatte, wirklich dort zu sein. Ich konnte darin gehen, rennen und springen, sogar Purzelbäume schlagen. Wenn ich etwas anfasste, spürte ich den Widerstand in meinen Fingern. Das Rig war zwar nicht ausreichend, um in der Profiliga mitzuspielen, aber ein besseres Gerät konnte ich mir nicht leisten, und es war schon okay, um mich mit ein paar Online-Buddys in die Schlacht zu stürzen.
Ich sah auf die Uhr. Kurz nach elf abends. Ich hatte schon wieder mehr als sechs Stunden in der virtuellen Realität verbracht. Ein dumpfes Pochen in meinem Kopf signalisierte die Überlastung meines Gehirns. Seit mich Katrin vor ein paar Wochen verlassen hatte, gab es nur noch wenig, was mich an der Wirklichkeit reizte, und so verbrachte ich jede freie Minute in meinem Lieblingsspiel Ultimate Survivor. Meine Gesundheits-KI nervte mich täglich mit Hinweisen, dass meine Lebensweise ungesund sei und ich alle Anzeichen von Suchtverhalten aufweise. Sie empfahl mir Waldspaziergänge, Mannschaftssport und einen Besuch beim Psychologen. Ich konnte das blöde Ding nicht abschalten, ohne meinen Bonus bei der Krankenversicherung zu riskieren, also ignorierte ich die Warnungen einfach.
Es war höchste Zeit, ins Bett zu gehen, denn ich musste am nächsten Morgen früh raus, wenn ich meinen Flug nicht verpassen wollte. Doch das Adrenalin der Battle und die Vorfreude auf meinen bevorstehenden Kurzurlaub hielten mich noch lange wach.
Neopolis wartete auf mich! Die faszinierende Millionenstadt am Roten Meer, die der Saudische König innerhalb von zwanzig Jahren aus dem Wüstenboden gestampft hatte. Man nannte sie »Die Stadt aus Licht« – und nicht etwa »Die Stadt des Lichts«: Neopolis war nicht bloß grellbunt beleuchtet wie etwa Manhattan oder Schanghai. Ein großer Teil der Stadt bestand buchstäblich aus Licht – aus virtuellen Dekorationselementen und Schildern, ohne die man sich nicht zurechtfinden konnte. Und natürlich waren dort die Dschinn allgegenwärtig, virtuelle Helfer und Touristenführer, die einem angeblich jeden Wunsch von den Augen ablasen.
Ich hatte bereits als Kind davon geträumt, die magische Stadt einmal zu besuchen. Dort vermischten sich virtuelle und reale Welt auf einzigartige Weise. Ich würde nicht mehr nur in einem Simrig hängen, sondern zu Fuß durch die Straßen einer Stadt spazieren, bei der man angeblich nie wusste, was echt war und was nicht. Und als wäre das nicht schon die Erfüllung aller Wunschträume eines Gamers, würde ich dort sogar das Finale der Weltmeisterschaft meines Lieblingsspiels erleben. Ich würde mein Idol Dr. Strangelove, einen der weltbesten E-Sportler und Top-Favoriten der diesjährigen WM, zum ersten Mal live sehen!
Schon seit Jahren verfolgte ich den Aufstieg des Docs, wie er in der Szene genannt wurde, an die Weltspitze. Immer wieder hatte er mit spektakulären und hochriskanten Aktionen im Spiel auf sich aufmerksam gemacht. Einmal hatte er sich ohne Fallschirm aus einem Hubschrauber auf eine feindliche Kampfdrohne gestürzt und sie mit nichts als zwei Handgranaten bewaffnet zum Absturz gebracht – eine Szene, die im Netz viral gegangen war. Oft genug hatte er mit solchen Stunts eine aussichtslose Situation für sein Team noch gedreht, auch wenn er selbst dabei draufgegangen war. So hielt er die Spannung bei jedem Ultimate Survivor-Match bis zum Schluss aufrecht und sorgte dafür, dass der Ausgang offenblieb – selbst wenn ein Team scheinbar haushoch überlegen war. Dafür liebte ich ihn. Ich empfand es als eine Ehre, ihn nun live erleben zu dürfen, und war schon sehr gespannt, was er sich diesmal einfallen lassen würde.
Blöd nur, dass ich die Reise allein antreten musste. Ursprünglich hatte ich Flug und Hotel für Katrin und mich gemeinsam gebucht und dafür mein Konto bis ans Limit überzogen. Es war mein Geburtstagsgeschenk für sie gewesen. Was für ein Reinfall! Statt Begeisterung zu ernten, hatte ich bloß Vorwürfe zu hören bekommen. Sie hatte mich einen unsensiblen und rücksichtslosen Idioten genannt, weil ich angeblich ihre Flugangst ignoriert hatte – dabei hatte ich ihr doch extra einen Link zu einem kostenlosen Online-Flugangstkurs der Fluggesellschaft geschickt. »In Wirklichkeit schenkst du das doch gar nicht mir, sondern dir selbst«, hatte sie gekeift. »Der einzige Grund, warum du da hinwillst, ist diese dämliche Ultimate Survivor-WM!« Dass sie sich nichts aus E-Sport machte, hatte ich inzwischen begriffen. Täglich hatte ich mir anhören müssen, dass ich viel zu viel Zeit in meinem »Hamsterrad«, wie sie es nannte, verbringen würde und viel zu wenig Zeit mit ihr. Aber die WM fand schließlich nur an einem Abend statt, und die restlichen viereinhalb Tage hätten wir genug Zeit gehabt, gemeinsam die Stadt zu erkunden – die immerhin eines der beliebtesten Touristenziele der Welt war!
Dass ausgerechnet mein Geschenk unser Trennungsgrund gewesen war, tat immer noch verdammt weh. Wir hatten wohl einfach zu wenig Gemeinsamkeiten gehabt. Trotzdem vermisste ich sie, besonders jetzt, als ich mich in dem viel zu großen Bett hin und her wälzte.
Auch in meinem Job lief es zurzeit nicht rund. Erst vor drei Wochen hatte ich im montäglichen Stand-up-Meeting erfahren, dass das Projekt eingestellt werden sollte, an dem ich die letzten zwei Jahre gearbeitet hatte. Man sehe keine wirtschaftliche Perspektive mehr, so der CTO von Blue Tomato Games. Dabei waren wir kurz vor dem Launch!
Einen Urlaub konnte ich jetzt gut brauchen. Zumindest für ein paar Tage konnte ich meine Sorgen vergessen. Statt Berliner Schmuddelwetter würde ich strahlend blauen Himmel und heiße Wüstenluft genießen.
Was auch immer mich in Neopolis erwartete, es würde sicher ein unvergessliches Erlebnis werden.
2.
»Entschuldigung, Sie sitzen auf meinem Platz.«
Irritiert blickte ich auf. Neben mir stand eine Frau mit schulterlangem dunkelbraunem Haar, das ein schmales Gesicht mit großen, dunklen Augen umrahmte. Sie war vielleicht ein paar Jahre älter als ich, etwa Mitte dreißig, südländischer Typ. Ihr Deutsch hatte einen leichten Akzent, Italienisch vermutlich.
»Das glaube ich nicht.« Ich deutete auf den freien Mittelplatz neben mir. »Ihr Platz ist wahrscheinlich der hier.«
Ich erhob mich, um sie vorbeizulassen, doch sie schüttelte energisch den Kopf und hielt mir ihr altmodisches Flexipad vor die Nase. Das verknitterte, etwa einen Millimeter dünne Display zeigte ihre Bordkarte: Flug Saudia Airways SA038 Frankfurt – Neopolis, 27. 3. 2048, 16:30 Uhr, Passagier Adina Marini, Platz 17E. Darunter ein Layout des Flugzeugs – der Gangplatz leuchtete rot.
»Da stimmt wohl etwas mit der Anzeige nicht. Ich habe den Gangplatz – 17D.«
»17D ist der Mittelplatz.« Sie zeigte auf den Aufdruck unter dem Gepäckfach, der ihr bedauerlicherweise recht gab.
»Tut mir leid, ein Versehen. Ich habe wohl den falschen Platz angegeben.«
Sie runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht.«
»Sie haben das Ticket auf flightshare.com ersteigert, richtig?«
»Woher wissen Sie das?«, fragte sie argwöhnisch.
»Ich bin derjenige, der es angeboten hat. Eigentlich wollte ich zusammen mit meiner … Na ja, egal. Jedenfalls – ich dachte, 17D wäre der Gangplatz. Also, wenn Sie so nett wären, sich dorthin zu setzen …«
Ihre Augen verengten sich. »Aber das hier ist mein Platz!«, beharrte sie.
Sie kapierte es offensichtlich nicht. Ich bemühte mich, geduldig zu bleiben. »Ich habe es doch gerade erklärt. Ich wollte den Mittelplatz versteigern, nicht den Gangplatz. Immerhin haben Sie weniger als die Hälfte für das Ticket bezahlt, als es mich ursprünglich gekostet hat. Da werden Sie ja wohl nicht von mir verlangen, dass ich …«
»Können Sie sich jetzt beide endlich mal hinsetzen?«, beschwerte sich ein stämmiger Fluggast hinter der Frau.
Eine Stewardess näherte sich.
»Haben Sie Schwierigkeiten, Ihren Platz zu finden?«, fragte sie freundlich auf Englisch.
»Nein«, antwortete ich, während Adina Marini gleichzeitig »Ja« sagte.
Die Schlacht war verloren. Ich ignorierte die gehässigen Kommentare der anderen Fluggäste und setzte mich auf 17D.
Na toll, fünf Stunden eingequetscht auf einem Mittelplatz. So hatte ich mir den Start in den bisher teuersten Urlaub meines Lebens nicht vorgestellt.
Ich regulierte die Transparenz meiner Holobrille auf null und aktivierte den Livestream der WM-Vorausscheidungen. Aktuell battelten die Konkurrenten um die zwei verbliebenen Finalplätze. Der Doc war bereits weitergekommen, doch ich hätte gerne zugesehen, wie sich seine potenziellen Gegner schlugen. Aber natürlich war die Verbindung an Bord miserabel, sodass es penetrant laggte.
Genervt setzte ich die Brille ab und warf einen verstohlenen Blick zu meiner Sitznachbarin. Sie trug keine Brille, und auch das verräterische Schimmern von Hololinsen war in ihren Augen nicht zu erkennen. Stattdessen starrte sie auf ihr knittriges Flexipad. Das Display zeigte bloß eine weiße Fläche mit schwarzen Buchstaben. Sie las! Wer tat das denn heute noch? Vielleicht war sie Lehrerin oder Professorin oder so was. Oder eine dieser renitenten Technologieverweigerinnen? Aber dann hätte sie nicht mal ein Flexipad benutzt, sondern wahrscheinlich in einem echten Papierbuch geblättert, und ganz sicher würde sie nicht freiwillig nach Neopolis fliegen.
Auf einmal kam ich mir ziemlich blöd vor. Mir wurde bewusst, dass ich mich ihr gegenüber benommen hatte wie ein Idiot.
»Entschuldigen Sie bitte, ich …« Ich hatte keine Ahnung, wie ich den Satz beenden sollte.
Sie blickte von ihrem Pad auf und sah mich mit gerunzelter Stirn an. Ihre Augen drückten Neugier und Skepsis zugleich aus.
»Ja?«
»Ich … ich hätte mich nicht so anstellen sollen wegen des Sitzplatzes. Tut mir leid.«
Sie lächelte. »Ist schon gut. Ich hätte auch keine Lust gehabt, in der Mitte zu sitzen.«
Ich bin sonst nicht der geschwätzige Typ, aber etwas in ihren Augen schien mich einzuladen, das Gespräch fortzusetzen.
»Fliegen Sie auch das erste Mal nach Neopolis?«
»Nein«, erwiderte sie. »Ich wohne dort.«
Mir klappte die Kinnlade herunter.
»Sie wohnen dort?«
Sie zog eine Augenbraue hoch und lächelte.
»Was ist so erstaunlich daran?«
Ich sah mich in der Economyclass um. Überwiegend ältere Pärchen, die sich mit der Reise einen Lebenstraum erfüllten, ein paar Familien mit Kindern. Sicher niemand, der über einen mindestens achtstelligen Dollarbetrag auf dem Konto verfügte.
»Ich … nun ja, ich hätte nicht erwartet, eine … wie nennt man das, Shareholderin …«
Sie lachte, wurde aber rasch wieder ernst.
»Nein, nein, ich bin keine Shareholderin. Nicht alle Bürger von Neopolis sind reich.«
»Nicht? Aber ich dachte … ich habe mal gelesen, was die Mieten dort kosten. Ich meine, Berlin ist auch nicht gerade billig, aber von dem, was ein Einzimmerapartment in Neopolis im Monat kostet, kann ich meine Wohnung ein Jahr lang bezahlen, oder nicht?«
Sie nickte. »Stimmt schon. Aber manche Bürger müssen keine Miete bezahlen und bekommen sogar noch ein monatliches Taschengeld. Quasi ein Stipendium.«
»Dann sind Sie eine Künstlerin oder so was?«
»Ja, genau. Ich gestalte animierte Holoskulpturen. Ich nenne es Flowing Art.«
»Cool.« Ich hätte an dieser Stelle wohl etwas Intelligenteres antworten sollen, aber mir fiel nichts ein. Von Kunst verstand ich ungefähr so viel wie von höherer Mathematik.
»Und Sie? Was reizt Sie so sehr an Neopolis, dass Sie doppelt so viel für Ihr Ticket bezahlt haben wie ich?« Sie lächelte ein bisschen schadenfroh.
»Die Ultimate Survivor-Weltmeisterschaft. Das ist ein …«
Ihr Gesicht verschloss sich wie ein Fenster, vor das man bei strahlendem Wetter einen dunklen Vorhang zieht. »Ich weiß, was Ultimate Survivor ist.«
Irritiert von dem offensichtlichen Widerspruch zwischen dieser Aussage und ihrer finsteren Miene fragte ich nach: »Sie interessieren sich auch für E-Sport?«
»So etwas ›Sport‹ zu nennen ist wohl der Euphemismus des Jahrhunderts.« Unverhohlener Abscheu lag in ihrer Stimme. »Nach der gleichen Logik könnten Sie auch die Elefantenjagd als Sport bezeichnen.«
»Was hat denn Elefantenjagd mit E-Sport zu tun?«, fragte ich mehr verwirrt als verärgert.
Sie sah mich an, als könnte sie nicht begreifen, warum ich etwas so Offensichtliches nicht verstand. »In beiden Fällen knallt man grundlos intelligente, fühlende Wesen ab.«
Ich starrte sie an, wartete darauf, dass sich ihr hübscher Mund zu einem Grinsen verzog, mit dem sie erkennen ließ, dass sie nur einen Scherz gemacht hatte. Doch ihre Miene blieb todernst.
»Aber … die Spieler bei E-Sport-Turnieren sterben doch nicht wirklich – das ist alles nur virtuell.«
»Für die Menschen vielleicht.« Angewidert schürzte sie die Lippen. »Aber nicht für die künstlichen Wesen, auf die Ihr sogenannten E-Sportler Jagd macht. Für sie gibt es keine andere Realität als die des Spiels. Sie können nicht einfach eine Brille absetzen und sich einen Kaffee machen, wenn sie erschossen werden.«
Endlich begriff ich, was los war: Ich hatte das Ticket, das ursprünglich für Katrin bestimmt gewesen war, ausgerechnet an eine Artificial-Rights-Aktivistin verkauft! Ich wusste, dass es Spinner gab, die ernsthaft behaupteten, Computerprogramme hätten dieselben Rechte wie Menschen, hatte aber noch nie einen davon getroffen. Die AR-Bewegung war noch relativ jung. Allerdings war es in letzter Zeit im Umfeld von E-Sport-Events immer häufiger zu Protestaktionen gekommen. Erst vor ein paar Wochen hatten Aktivisten während einer Battle die Bühne gestürmt und den Spielern ihre Controller entrissen. Das Spiel musste wiederholt werden. Seitdem waren die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden.
»Sie glauben doch nicht wirklich, dass Software Gefühle hat, oder?« Halb hoffte ich immer noch, dass sie mich nur auf den Arm nahm. »Ich meine, das sind doch bloß Algorithmen und Daten. Nullen und Einsen. Programmiert von Softwareentwicklern.«
»Ach ja? Und was genau sind Sie?«
»Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut«, erklärte ich eine Spur zu defensiv.
»Sie bestehen vielleicht aus anderen Materialien als ein Computer, aber Ihr Geist tut nichts anderes als ein Softwareprogramm: Er verarbeitet Informationen. Es gibt keinen prinzipiellen Unterschied zwischen einem menschlichen Bewusstsein und der Simulation eines solchen. Das hat die Philosophin Carol Hammond bewiesen.«
Soviel ich wusste, war Carol Hammond die Gründerin der AR-Bewegung. Es wäre wohl das Beste gewesen, jetzt einfach zu nicken, mich zur Seite zu drehen und so zu tun, als hätte meine Holobrille noch Saft. Doch ich war gereizt und nicht bereit, solchen Unsinn unwidersprochen im Raum stehen zu lassen.
»Es gibt sehr wohl einen prinzipiellen Unterschied: Das eine ist real, das andere nicht. Das ist der gleiche Unterschied wie der zwischen einer ausgedachten Geschichte und einer, die tatsächlich passiert ist.«
Sie widersprach: »Das, was Sie Realität nennen, ist nur die subjektive Wahrnehmung einer Wirklichkeit, die wir niemals vollständig erfassen können. Das hat schon Platon erkannt. Etwas ist real, weil es sich real anfühlt. So ist auch das, was in einem Computerspiel passiert, für die künstlichen Wesen darin real. Sie wissen ja nicht, dass sie künstlich sind.«
Die Frau hatte keine Ahnung, wovon sie redete. »Computergegner wissen überhaupt nichts. Sie haben weder Gefühle noch ein Bewusstsein, sondern verhalten sich nur nach vorgegebenen Regeln. Ich weiß das, denn ich entwickle diese Dinger.«
Das war etwas übertrieben. Zwar hatte ich Computer Games Technology studiert und mehrere Programmiersprachen gelernt, doch das harte Coden war mir immer zu kompliziert und zu anstrengend gewesen. Deshalb hatte ich mich darauf spezialisiert, Teams aus Entwicklern, Grafikern, Storywritern und Usability-Experten zu leiten. Aber auf jeden Fall wusste ich mehr darüber als eine selbst ernannte Künstlerin, die mit virtuellen Pinseln irgendwelche 3-D-Krakeleien in die Luft malte.
Dachte ich jedenfalls.
Ihr Gesicht wurde noch feindseliger, sofern das überhaupt möglich war. Leo, der Grafiker in unserem Team, hätte es gut als Vorlage für eine Erzschurkin nehmen können.
»Wenn Sie diese ›Dinger‹, wie Sie sie nennen, entwickeln, dann wissen Sie ja wohl, dass die sich in Wahrheit selbst programmieren«, entgegnete sie. »Welches Toolkit benutzen Sie dafür? Neuroforce? AWS Liquid Mind? Egopath? Was auch immer es ist, Sie haben keine Ahnung, wie ihre künstlichen Wesen im tiefsten Inneren funktionieren, warum genau sie sich so verhalten, wie sie es tun. Die Gamedesigner geben ihnen ein paar Verhaltensregeln vor, definieren Ziele und auch Dinge, die sie vermeiden sollen, und dann lassen sie sie auf ihre virtuelle Welt los und beobachten, was passiert. Wenn sie sich nicht so verhalten, wie die Designer sich das vorstellen, werden halt ein paar Parameter angepasst, bis die gegnerischen Spieler genau so aggressiv sind wie gewünscht. Und wie erreichen Sie das? Indem sie die Gefühle dieser Wesen manipulieren, ihnen Schmerzen zufügen, sie Angst, Hunger und Zorn spüren lassen.«
Gegen meinen Willen war ich beeindruckt. Wir verwendeten im Team zwar keines der genannten Tools, sondern programmierten das Verhalten unserer Nicht-Spieler-Figuren tatsächlich noch auf die altmodische Art von Hand. Aber einer der Gründe, weshalb unser Projekt sterben musste, war genau dieser: Unsere Vorgehensweise war nach Ansicht unseres CTOs viel zu kompliziert und zu langsam und führte angeblich zu unrealistischen Verhaltensweisen, die einfach nicht mehr in die heutige Zeit passten.
Doch das hieß noch lange nicht, dass diese Frau mit ihren abstrusen Behauptungen recht hatte.
»Aber doch nicht wirklich«, wandte ich ein. »Wir simulieren das bloß. Das ist, als wenn man ein Holo dreht. Da wird ja auch niemand erschossen. Die nehmen dafür Platzpatronen und künstliches Blut.«
Auch diesen Einwand ließ sie nicht gelten: »Sofern es sich noch um menschliche Schauspieler handelt, vielleicht – aber nicht bei den künstlich generierten Statisten. Wissen Sie, warum die immer häufiger eingesetzt werden? Nicht bloß, weil sie billiger sind als Menschen, sondern vor allem, weil ihre Gesichtsausdrücke und Reaktionen viel natürlicher sind als die von Schauspielern. Weil sie die Schmerzen wirklich spüren und nicht nur so tun, als ob.«
»Das ist doch Unsinn!« So langsam reichte es mir. »Ich sage es noch mal: Das sind Simulationen. Das hat nichts mit der Realität zu tun.«
»Und woher wollen Sie wissen, dass wir nicht auch bloß Simulationen sind?« Sie machte eine Geste, die das Innere des Flugzeugs umfasste. »Können Sie mir beweisen, dass das alles hier real ist und nicht nur ein Computerprogramm, das irgendwelche Menschen in hundert Jahren laufen lassen? Oder dass wir beide in Wirklichkeit nicht bloß die Hirngespinste irgendeines durchgeknallten Irren sind?«
Ich schüttelte den Kopf. »Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst!«
»Und ob das mein Ernst ist! Es gibt keinen Beweis dafür, dass unsere Welt nicht simuliert ist. Es ist sogar erschreckend wahrscheinlich. Schon heute gibt es in all den Computerspielen viel mehr simulierte Wesen als echte. Denken Sie mal fünfzig oder hundert Jahre weiter, dann kommen vermutlich auf jeden Menschen Tausende virtueller Personen, die ein Bewusstsein und Gefühle haben, aber nicht wissen, dass sie nur in einer Simulation leben. Jetzt wählen Sie ein beliebiges denkendes Wesen zufällig aus. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass es echt ist?«
»Wir leben aber nicht in fünfzig oder hundert Jahren, sondern im Jahr 2048.«
»Woher wollen Sie das wissen? Wenn wir in einer Simulation sind, könnte es in Wahrheit ebenso gut das Jahr 2098 sein – oder auch 6513.«
»Echt jetzt? Sie wollen mir weismachen, ich wäre nur ein Computerprogramm?«
»Ich will Ihnen gar nichts weismachen. Aber es ist unmöglich, diese Hypothese sicher auszuschließen, das wissen wir schon, seit René Descartes sein berühmtes Cogito, ergo sum formulierte. Und das wiederum bedeutet, dass es aus philosophischer und moralischer Sicht keinen Unterschied machen kann, ob ich etwas fühle, weil ich ›wirklich‹ bin oder ›nur‹ eine Simulation.«
Ich konnte es nicht fassen. Für einen Moment kam es mir so vor, als wäre dieses Gespräch tatsächlich irreal, ein wirrer Traum. Ich unterdrückte den Impuls, mich in den Handrücken zu kneifen.
Sie erwiderte meinen Blick. Ihre Wangen waren vor Erregung leicht gerötet, was ihr gut stand. In ihren Augen las ich Leidenschaft, aber auch etwas Düsteres, so als bereitete es ihr seelische Schmerzen, über dieses Thema zu reden.
Mit etwas ruhigerer Stimme fuhr sie fort: »Vor zweihundert Jahren hatten Tiere praktisch keine Rechte. Es hat lange gedauert, bis sich die Erkenntnis durchsetzte, dass es sich bei ihnen, zumindest bei den höheren Tieren, um denkende und fühlende Wesen handelt. Und es wird höchste Zeit, dass wir auch intelligenten Computerprogrammen diese Rechte zugestehen. Doch diese Rechte werden immer noch weitgehend ignoriert, besonders von Leuten wie Ihnen, die diese künstlichen Wesen zum Spaß quälen.«
Nun war es allmählich genug.
»Soll ich mich jetzt etwa bei jedem Ork entschuldigen, den ich in einem Computerspiel vermöble?«, blaffte ich.
»Sie könnten einfach damit aufhören, gewaltverherrlichende Computerspiele zu spielen, und endlich erwachsen werden!«
»Das … das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe!« Meine Stimme wurde so laut, dass der Typ neben mir zu schnarchen aufhörte. »Demnächst muss ich wohl auch meinen Toaster höflich fragen, ob er vielleicht Lust hat, das Brot zu rösten. Und meinen Kühlschrank stelle ich ein paar Grad höher, damit er nicht friert, oder was?«
»Typisch Mann: Alles schwarz-weiß darstellen und sofort ins Lächerliche ziehen, wenn man etwas nicht versteht.«
»Typisch Frau: Von Technik keine Ahnung haben, aber sich zur moralischen Richterin aufschwingen!«
»Jetzt reicht es aber! Dass Sie die Rechte von Maschinen missachten, kann man vielleicht noch Ihrer Ignoranz zuschreiben. Aber sexistische Sprüche muss ich mir ja wohl nicht auch noch anhören!«
»Sexistisch? Ich? Wer hat denn damit angefangen?«
Eine Stewardess näherte sich und bat uns darum, unser Gespräch etwas leiser zu führen, da sich einige andere Fluggäste gestört fühlten.
»Gespräch?«, antwortete Marini auf Englisch. »Dieser Mann hat mich mit sexistischen Sprüchen belästigt.«
»Was?«, rief ich. »Aber …«
Die Stewardess machte ein ernstes Gesicht, dann wischte sie durch die Luft, wie um eine Fliege zu verscheuchen. Natürlich gab es an Bord dieser sterilisierten Maschine keine Insekten; seit der Ebola-Pandemie Anfang der Dreißiger verstand man in dieser Hinsicht keinen Spaß mehr. Die Bewegung diente vielmehr dazu, ihr Holodisplay zu steuern. Dann wandte sie sich an Marini: »Bitte folgen Sie mir. Sie erhalten ein kostenloses Upgrade in die Businessclass.«
»Was … wie … aber ich habe doch gar nicht …«, protestierte ich, während Marini ihre Sachen aus dem Gepäckfach kramte, mir einen letzten vernichtenden Blick zuwarf und der Stewardess in den vorderen Kabinenteil folgte.
Nun bekam ich also doch noch meinen Gangplatz. Aber irgendwie fühlte sich das nicht so toll an.
3.
Als die Maschine endlich landete, hatte sich meine Laune nicht gebessert. Irgendwie hatte es diese Adina Marini geschafft, dass ich während des restlichen Flugs zwischen meinem Zorn auf sie und absurden Schuldgefühlen wegen meiner E-Sport-Begeisterung geschwankt hatte.
Das Ankunftsterminal von Neopolis unterschied sich auf den ersten Blick nicht von dem anderer Flughäfen: Eine Menge Chrom, Metall und polierter Stein, sterile Dekorationen, Begrüßungsschilder in allen möglichen Sprachen, endlose Gänge mit Rollbändern, ein Strom von Passagieren, die wie willenlose Zombies den Anweisungen ihrer Holobrillen folgten, um den Weg zum Gepäckband zu finden. Ich trottete brav hinterher.
Nachdem ich mein Gepäck geholt hatte, stand mir das Labyrinth der Einwanderungskontrolle bevor. Auch das war für mich nichts Neues: ein Netz von Gängen, die sich immer weiter verzweigten wie die Arme eines Flussdeltas. Automatisch öffnende Sperren lotsten jeden Passagier in eine eigene, schalldichte Kabine. Die Sicherheits-KI identifizierte mich anhand meines Aussehens, meiner Stimme und Dutzender anderer Merkmale und stellte mir in akzentfreiem Hochdeutsch die üblichen Fragen: »Haben Sie vor, in Neopolis eine Straftat zu begehen?«, »Haben Sie in dem Land, aus dem Sie abgeflogen sind, eine Straftat begangen, oder befinden Sie sich auf der Flucht vor den Strafverfolgungsbehörden dieses Landes?«, »Haben Sie eine ansteckende Krankheit?«, »Leiden Sie unter einer Geisteskrankheit?«, »Führen Sie illegale Substanzen oder Waffen, gleich welcher Art, mit sich?«
Ich beantwortete alle Fragen brav mit Nein, während die KI mit unsichtbaren Sensoren meinen Blutdruck und meinen Hautwiderstand maß, winzigste unbewusste Regungen meiner Gesichtsmuskeln und die Weitung meiner Pupillen registrierte und zu dem Schluss kam, dass ich nicht gelogen hatte. Wie schon oft fragte ich mich, was mit mir geschehen würde, wenn ich auf eine der Fragen mit Ja antwortete. Würde die KI wissen, dass ich log, und meine falsche Antwort einfach ignorieren, oder würden Sicherheitskräfte über mich herfallen und mich stundenlang verhören? Ich schreckte davor zurück, es auszuprobieren.
Endlich öffnete sich die automatische Tür am anderen Ende der Sicherheitskammer. Doch dahinter wartete nicht der Ausgang, wie ich erwartet hatte, sondern eine weitere Kammer mit einem Metalltisch, hinter dem eine Frau mittleren Alters – vermutlich indischer oder pakistanischer Abstammung – mit Mundschutz, Holobrille, grauem Kittel und Gummihandschuhen auf mich wartete.
Ich befürchtete schon die Anweisung, mich auszuziehen und auf den Metalltisch zu legen, damit sie irgendwelche medizinischen Untersuchungen vornehmen konnte. Stattdessen tönte eine Stimme über Lautsprecher: »Bitte legen Sie alle mitgebrachten elektronischen Geräte auf den Tisch. Sie bekommen diese bei Ihrer Abreise aus Neopolis zurück. Während Ihres Aufenthalts in Neopolis erhalten Sie ein kostenloses Holodisplay, mit dem Sie alle Annehmlichkeiten der Stadt genießen und jederzeit kostenlos das Netz nutzen können.«
Widerstrebend legte ich meine Holobrille auf den Tisch, öffnete meinen Koffer, holte das flache, handtellergroße Gerät heraus, das die modernste Gaming-Technologie enthielt, und platzierte es daneben.
»Passen Sie gut darauf auf, das Ding war teuer«, sagte ich zu der Frau. Sie lächelte unverbindlich – falls ihre Holobrille meine Worte übersetzt hatte, ließ sie es nicht erkennen.
Gerade als ich meinen Koffer wieder schließen wollte, begann sie, darin herumzuwühlen, und förderte mehrere Gegenstände zutage: einen Netzadapter, meine Ladeschale, mehrere Kabel, die ich aus alter Gewohnheit mit mir herumschleppte, obwohl ich sie kaum noch benutzte, einen Memostift und mein Zahnpflegeset, außerdem ein paar Sneakers mit integriertem Schritt- und Kalorienzähler und mehrere Shirts mit Varicolor-Funktion.
»Bitte legen Sie auch alle Kleidungs- und Schmuckstücke mit digitalen oder elektronischen Funktionen ab, die Sie am Körper tragen«, forderte die Lautsprecherstimme. »Bei Bedarf stellen wir Ihnen gerne kostenlose Leihkleidung zur Verfügung. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, sich in unserem Einkaufsparadies in der Ankunftshalle mit der neusten Mode auszustatten.«
Ich starrte die Frau ungläubig an. Zwar hatte ich gewusst, dass man nach Neopolis keine elektronischen Geräte mitbringen durfte, aber nicht geahnt, dass man es derart genau nehmen würde. Zum Glück hatte ich mir für den Flug bequeme, funktionslose Kleidung angezogen, sodass ich mich wenigstens nicht vor ihr entblößen musste. Ich legte mein Sensor-Armband in die Schale und hoffte, dass diese unwürdige Prozedur nun endlich beendet war. Doch die Frau guckte mich immer noch kritisch an.
»Bitte legen Sie auch Ihr Amulett mit Speicherfunktion in die Schale«, mahnte die Stimme.
»Was?« Ich erschrak. »Mein Amulett? Das hat mir meine Mutter geschenkt, kurz vor ihrem Tod! Ich denke gar nicht daran, das abzulegen!«
Tatsächlich enthielt das Amulett – eine kleine goldene Sonne – einen winzigen Speicherchip mit höchstens ein paar Gigabyte Kapazität. Darauf war ein 2-D-Video gespeichert, in dem meine Mutter, bereits von der Krankheit gezeichnet, mir sagte, wie sehr sie mich liebe und dass ich immer wie eine Sonne in ihrem Leben gewesen sei. Ich hatte es zu meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag bekommen. Mir krampfte sich bei der Erinnerung daran der Magen zusammen.
»Wenn Sie den Aufforderungen des Sicherheitssystems nicht Folge leisten, wird Ihnen die Einreise nach Neopolis verweigert«, informierte mich die Stimme. Sie hatte einen verständnisvollen, sanften Tonfall, der mich umso mehr aufregte.
Eine Sekunde lang überlegte ich ernsthaft, den Trip hier und jetzt abzubrechen. Doch dann dachte ich an das WM-Finale und Dr. Strangelove, gab klein bei und legte das Amulett ab.
»Und wenn man ein künstliches Herz oder ein Neuroimplantat hat?«, fragte ich. »Muss man die dann auch auf den Tisch legen?«
Die Frau ignorierte meine Frage, packte all meine Verbindungen zur digitalen Welt in eine blaue Schale und stellte diese auf ein Fließband, das sie durch eine Öffnung in der Wand in irgendein steriles Lager transportierte. Dann überreichte sie mir ein Täschchen aus samtigem schwarzem Material mit dem Logo von Neopolis: einer Palme, über der ein Halbmond und zwei Sterne schwebten. Darin fand ich eine schwarze Holobrille mit transparenten Gläsern. Sie sah nicht besonders elegant aus, passte aber wie angegossen. Die Gläser korrigierten meine leichte Weitsichtigkeit mindestens ebenso gut wie meine eigene Brille. Ich berührte den Bügel, um die Augmented-Reality-Funktion zu aktivieren, doch meine Umgebung veränderte sich nicht. Lediglich die Anzeige des Ladestands leuchtete grün am Rand meines Blickfelds.
Endlich öffnete sich die Tür, und ich durfte den Raum mit meinem gefühlt nun deutlich leichteren Koffer verlassen. Dahinter lag ein breiter Korridor, der sich weiter vorn zu einem Tunnel verengte. Links und rechts von mir traten verwirrte Touristen aus den Türen, die sich vermutlich ähnlich fühlten wie ich: ausgeraubt. Einige trugen beigefarbene Slacks und Shirts mit dem Logo von Neopolis.
Ich folgte dem Menschenstrom zu dem Tunnel, in dem sich ein breites Laufband befand.
»Bitte bleiben Sie ruhig stehen, und genießen Sie den Anblick, der sich Ihnen gleich bieten wird«, empfahl mir eine freundliche Stimme, während ich langsam in den dunklen Tunnel geschoben wurde. »Wir empfehlen Ihnen zu Ihrer eigenen Sicherheit, während Ihres Aufenthalts in Neopolis Ihr Holodisplay stets zu tragen und den Anweisungen Ihres Dschinns zu folgen. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß in der Stadt aus Licht!«
Weiter vorn wurde es wieder hell. Von dort erklangen erstaunte Ausrufe: »Oh!«, »Ah!«, »Fantastisch!«, »Das ist ja … unglaublich!«
Mit entsprechend hohen Erwartungen fuhr ich in die Halle hinein, die sich hinter dem Tunnel öffnete. Sie gigantisch zu nennen wäre eine Untertreibung gewesen: ein gewölbter Glasbau, der einen halben Kilometer lang und hundertfünfzig Meter hoch sein musste. Durch die Glasflächen waren weitere Hallen zu erkennen, dahinter die Wüste Arabiens. Das Laufband führte über eine lange Brücke, die etwa dreißig Meter über dem Boden schwebte. Darunter erstreckte sich eine richtige Stadt mit flachen Häusern und Hunderten Verkaufsständen, zwischen denen sich zahllose Menschen drängten. Vögel zwitscherten, Affen kreischten, und ein babylonisches Stimmengewirr war zu hören. Der Duft exotischer Gewürze erfüllte die Luft.
Ich konnte die erstaunten Ausrufe der Touristen vor mir verstehen: Die Illusion war wirklich nahezu perfekt. Aber wenn man sich so gut mit virtuellen Welten auskannte wie ich, beeindruckte einen die Szenerie nicht besonders. Ich war sogar ein wenig enttäuscht. Immerhin hatte ich schon deutlich größere und beachtlichere virtuelle Gebäude gesehen. Zugegeben, der Geruchssimulator war nicht schlecht, aber auch so etwas hatte ich schon eindrücklicher erlebt.
Neugierig, wie es hinter den Kulissen der Illusion tatsächlich aussah, ignorierte ich die Empfehlung der Computerstimme und nahm in der Erwartung, nur nackte Tunnelwände zu sehen, meine Holobrille ab.
Vor Verblüffung hätte ich sie beinahe fallen lassen. Alles um mich herum sah exakt so aus wie zuvor. Das Display hatte nichts hinzugefügt. Die riesige Halle, der Basar, die Affen und Vögel – das alles war echt!
Jetzt sah ich, dass auch andere Touristen ihre Brillen abgenommen hatten und sich staunend umsahen, bevor sie diese wieder aufsetzten. Ich folgte ihrem Beispiel.
Als ich die Halle etwa zu einem Drittel durchquert hatte, erklang über mir ein Klingeln wie von Tausenden Glöckchen. Unter dem Glasdach entstanden grelle Funken, die umeinanderwirbelten, sich immer mehr verdichteten, während sie langsam herabschwebten und sich dabei zu einer humanoiden Gestalt formten. Das Lichtwesen landete auf dem Laufband direkt neben mir. Die Menschen vor und hinter mir beachteten es nicht – offenbar war es nur für mich sichtbar.
»Hallo, Nick!« Das Wesen hatte eine geisterhafte Stimme, die wie ein Windhauch klang. »Ich bin dein Dschinn. Ich bin hier, um dich zu begleiten und dir deine Wünsche zu erfüllen, so gut ich kann. Bitte gib mir als Erstes einen Namen.«
Ohne lange nachzudenken, nannte ich den ersten Namen, der mir in den Sinn kam: »Katrin.«
Kaum dass ich ihn ausgesprochen hatte, bereute ich meine Entscheidung bereits. Doch aus irgendeinem Grund war ich zu stolz oder zu dickköpfig, um sie zu revidieren.
»Das ist ein schöner Name.« Das Wesen schien sich zu freuen. »Es klingt fast wie ›Qarin‹, das ist die Bezeichnung meines Stammes. Nun sieh mich bitte einfach nur an.«
Der Funkenwirbel wurde zunehmend dichter, die Konturen verfeinerten sich und wurden eindeutig weiblich, während Haut und Kleidung ein natürlicheres Aussehen annahmen, sodass die Gestalt vor mir einem Menschen immer ähnlicher wurde. Aber nicht irgendeinem Menschen: Vor mir stand eine fast perfekte Abbildung meiner Ex-Freundin.
»Fuck!«, rief ich aus. »Lest ihr meine Gedanken, oder was?«
Die Gestalt löste sich in einem Funkenwirbel auf.
»Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich deine Gefühle verletzt habe.« Der Dschinn wirkte zerknirscht. »Ich habe versucht, mein Aussehen so zu verändern, dass es dir gefällt. Dabei habe ich deine Reaktionen auf meine Gestalt beobachtet. Aber offenbar bin ich zu weit gegangen. Wenn du möchtest, nehme ich eine neutrale Form an.«
»Ja, tu das bitte.« Ich fühlte mich plötzlich nackt.
Mir wurde auf einmal klar, warum ich all meine Geräte hatte abgeben müssen: Nicht nur, um Digitalterrorismus zu verhindern, wie es offiziell hieß, sondern vor allem, damit ich gezwungen war, diese Brille aufzusetzen, die meine Gedanken und Gefühle für das Sicherheitssystem von Neopolis offenlegte. Datenschützer warnten seit Jahren vor Reisen in die Stadt – nun wusste ich, warum.
Andererseits waren Datenschützer eine aussterbende Art. Die meisten Menschen hatten sich längst damit abgefunden, dass sie für Computersysteme vollkommen transparent waren. Auch ich hatte damit bisher keine großen Probleme gehabt. Immerhin hatte es ja auch viele Vorteile, wenn Maschinen bereits im Voraus wussten, was man sich wünschte, was man angenehm fand und was nicht. Doch jetzt kamen mir Zweifel. Allerdings war es dafür längst zu spät. Wie ich gerade eindrucksvoll erlebt hatte, kannte die KI meine geheimen Sehnsüchte bereits besser als ich selbst.
Der Dschinn nahm nun die Form einer leicht bekleideten Frau mit blauer Haut und übergroßen Comicaugen an.
»So besser?«, fragte sie mit einer sanften, erotischen Stimme.
»Jetzt siehst du aus wie Schlumpfine«, stellte ich fest. »Kannst du nicht einfach die Gestalt eines Menschen annehmen? Und wenn wir schon dabei sind, kann ich deinen Namen noch mal ändern?«
Der Dschinn wurde wieder zur Lichtgestalt. »Selbstverständlich. Wie möchtest du mich nennen?«
»Dschinn.«
»Wie originell. Aber du bist der Boss.«
Nun stand eine männliche Gestalt mit übertrieben muskulösem nacktem Oberkörper und Glatze vor mir.
»Du kannst meine Gestalt auch später noch jederzeit ändern«, sagte er. »Nun achte bitte auf das Ende des Laufbands.«
Tatsächlich waren wir bereits am anderen Ende der Halle angekommen. Um mich herum redeten die meisten Menschen mit ihren neuen, für mich unsichtbaren Begleitern. Ich folgte ihnen eine breite Promenade hinab in das Gewühl des Basars und tauchte in eine verwirrende Vielfalt von Farben und Formen, Stimmen, Geräuschen und Gerüchen. Außer dem Dschinn neben mir war alles real, wie mir ein kurzes Anheben meiner Brille bestätigte. Nur die Beschriftungen der zahllosen Verkaufsstände und die Preisschilder neben den Waren änderten sich: In der Realität waren sie in – für mich unlesbarem – Arabisch geschrieben, durch die Brille betrachtet waren sie auf Deutsch.
»Wenn du möchtest, kann ich die Waren, die dir gefallen, an deine Heimatadresse liefern lassen«, schlug der Dschinn vor, »oder natürlich gerne auch an Freunde und Verwandte.«
»Nein danke. Ich möchte am liebsten so schnell wie möglich ins Hotel.«
»Natürlich«, erwiderte mein virtueller Begleiter. »Bitte folge mir. Ich zeige dir den schnellsten Weg zu den Taxis.«
Er führte mich durch eine Seitengasse, die ich in dem Tumult ohne seine Hilfe sicher übersehen hätte. Sie mündete in einen kaum benutzten Nebenkorridor, der nur spärlich mit ein paar Werbehologrammen für Düfte und Schmuck dekoriert war. Kurz darauf schlug mir die Hitze Arabiens ins Gesicht, als wir das Terminalgebäude verließen. Unter einem schattenspendenden Dach wartete eine lange Schlange kleiner kastenförmiger Elektromobile, von denen die meisten Platz für zwei Personen boten. Ich lud meinen Koffer in das Gepäckfach des vordersten Wagens, stieg ein und setzte mich auf den rechten Platz. Der Dschinn saß neben mir und tat so, als wäre er mein Chauffeur, indem er ein virtuelles Lenkrad bediente, das vor ihm erschien.
Schon allein die Fahrt vom Flughafengebäude zum Hotel war spektakulär. Die Augmented-Reality-Designer hatten allerhand Überraschungen für die Touristen vorbereitet, die so geschickt in die Landschaft integriert waren, dass man zweimal hinschauen musste, um sie als Illusionen zu erkennen: eine Kamel-Karawane, die in der Ferne vorbeizog, einen gewaltigen geierähnlichen Vogel am Himmel, der einen ausgewachsenen Elefanten in den Klauen trug, einen halb im Sand vergrabenen alten Wüstentempel, vor dem bandagierte Mumien herumliefen. Dahinter glitzerten in der Ferne die Hochhäuser von Neopolis. Einmal wurden wir von einem Mann mit Turban auf einem fliegenden Teppich überholt, der mit atemberaubender Geschwindigkeit auf der linken Spur an uns vorbeizischte. Kurz darauf kamen wir an einem Polizisten in Uniform vorbei, der den Teppichflieger angehalten hatte, um ihm ein Strafmandat zu verpassen.
Während der Fahrt fütterte mich der Dschinn mit allerhand unnützem Wissen über die Geschichte von Neopolis: Das Projekt war 2017 von dem damaligen saudischen Kronprinzen offiziell angekündigt worden, der Bau war allerdings nach einigen Startschwierigkeiten erst fünf Jahre später begonnen worden. Neopolis war mit seinen mehr als drei Millionen Einwohnern offiziell ein Teil des Staatsgebiets von Saudi-Arabien, hatte jedoch einen Sonderstatus und war die weltweit einzige Stadt vollständig in Privatbesitz. Die Shareholder bestimmten auch die meisten Gesetze, die im Unterschied zum Rest des Landes sehr liberal waren. Es galten Religions- und Meinungsfreiheit, lediglich Alkohol und Drogen waren in Neopolis streng verboten.
Dass es auch kritische Stimmen gab, erwähnte mein Dschinn nicht. Menschenrechtsorganisationen behaupteten immer wieder, der virtuelle Glanz der Stadt übertünche bloß die Tatsache, dass in Neopolis Millionen Menschen ausgebeutet würden. Diese sogenannten Unberechtigten mussten angeblich unter unwürdigen Bedingungen leben und arbeiten, damit sich die Shareholder ihre Taschen noch mehr vollstopfen konnten. Doch ich war nicht hergekommen, um mich mit sozialen Problemen zu beschäftigen, die es schließlich auch in anderen Großstädten gab. Im Gegenteil, ich wollte mal ein paar Tage lang alle Probleme vergessen und einfach bloß Spaß haben. Dafür war die Stadt der Illusionen der perfekte Ort.