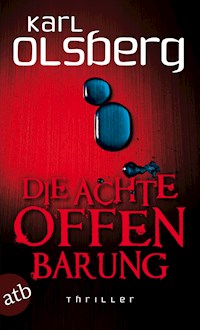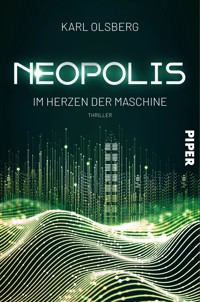
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Trügerisch und unheilvoll: Eine hoch technisierte Metropole, in der sogar die eigenen Sinne täuschen KI-Experte Karl Olsberg spinnt eine erschreckend aktuelle Zukunftsversion in seiner actionreichen »Neopolis«-Reihe. In Band 2 der mitreißenden Near-Future-Reihe, sind es nicht nur die mächtigsten und einflussreichsten Shareholder der Stadt, mit denen Nick es aufnehmen muss. Gamer Nick hat die sieben Ebenen der Hölle bezwungen – und darf zusammen mit Adina in Neopolis bleiben. Doch hinter den Kulissen der schönen neuen Augmented-Reality-Welt brodelt schon ein neuer Konflikt: Die KI, die die Stadt kontrollieren soll, wendet sich nach einem Update gegen ihre Schöpfer. Das gefällt nicht allen – vor allem nicht der Elite von Neopolis. Nick wird in den erbitterten Machtkampf zwischen Aron Keaton und seiner Rivalin Rynkova hineingezogen. Er und Adina müssen sich entscheiden, auf wessen Seite sie stehen. Schärfen Sie Ihre Sinne, für ein fantastisches Leseerlebnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Science Fiction!
www.Piper-Science-Fiction.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Neopolis – Im Herzen der Maschine« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: hqrloveq und maxkabakov/ iStock / Getty Images Plus
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Wenn du tot bist, kannst du keinen Kaffee holen.
Stuart Russell
1.
Adina lächelte nervös. »Aber du musst mir ehrlich sagen, was du davon hältst.«
Licht und Dunkelheit – eine Ausstellung von Adina Marini stand auf einem Schild neben der doppelflügeligen Tür. In der Neopolis Gallery of Contemporary Art einen eigenen Raum gewidmet zu bekommen, war schon an sich eine große Auszeichnung. Und anlässlich der Vernissage würden sich morgen zudem die Schönen, Reichen und Wichtigen von Neopolis hier einfinden, um ihre Werke zu bewundern. Ich merkte Adina an, wie aufgeregt sie war.
Ich nickte und gab ihr einen Kuss. »Na klar.«
Natürlich war das eine Lüge. Ich hätte es niemals übers Herz gebracht, ihre Werke zu kritisieren, selbst wenn sie mir nicht gefallen hätten. Sie hatte die letzten Monate wie besessen daran gearbeitet, als hätten die Ereignisse um den Token bei ihr einen Kreativitätsschub ausgelöst. In all der Zeit hatte sie mir nicht einen einzigen Blick darauf erlaubt. Doch nun, am Abend vor der offiziellen Eröffnung, durfte ich ihre neue Ausstellung als Erster sehen.
Sie öffnete die Tür, und ich betrat den großen Ausstellungsraum. Er hatte schlichte weiße Wände und einen Fußboden aus poliertem Stein. Zwei Reihen von je sechs weißen, quadratischen Tischen, auf denen jeweils ein Kunstwerk präsentiert wurde, standen an den Wänden. Dazwischen, in der Mitte des Raums, war ein deutlich größerer Tisch aufgestellt, mindestens fünf Meter lang und zwei Meter breit. Er war eindeutig der Blickfang der Ausstellung – eine Nachbildung der Innenstadt von Neopolis, deren höchste Gebäude gut einen Meter emporragten.
Ich trat an den Tisch, um mir die Skulptur genauer anzusehen. Unwillkürlich streckte ich eine Hand danach aus, zog sie jedoch rasch wieder zurück.
»Ist das etwa … Sand?«
»Ja.«
Als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass sich am Fuß einiger Gebäude bereits kleine Dünen aus herabgerieselten Sandkörnern gebildet hatten. Weiter oben waren in den Fassaden Risse zu erkennen, ein Teil einer Turmspitze fehlte. Ich zuckte zusammen. Die Skulptur zerfiel schon, bevor die Ausstellung eröffnet war! Adina hatte offenbar zu wenig Fixierungsmittel verwendet. Ich überlegte, ob ich sie darauf hinweisen sollte. Sicher würde ich sie damit in Panik versetzen.
Doch dann wurde mir klar, dass ihr ein solcher Fehler niemals unterlaufen wäre. Nicht Adina, die beim gemeinsamen Kochen jede Zutat vorher sorgfältig abwog und in einer eigenen Schale bereitstellte, bevor sie den Herd einschaltete.
»Wow!«, rief ich aus. »Die Stadt zerfällt langsam vor den Augen des Betrachters.«
Sie lächelte. »Gut erkannt. Jetzt setz deine Brille auf!«
Es wurde Nacht, als ich ihre Anweisung befolgte. Die Wolkenkratzer vor mir leuchteten in schillernden Farben, wie sie es auch in der Wirklichkeit taten. Ich entdeckte den Riesengorilla, den ich an meinem ersten Abend in Neopolis gesehen hatte, und Keatons Firmenzentrale, um die winzige Elfen schwirrten. Doch die Animationen liefen im Zeitraffer ab: Der Affe flitzte die hektisch blinkende Fassade hinauf und wieder herunter, während die Fahrzeuge in der Straße unter ihm einen leuchtenden Strom bildeten. Während ich zusah, wurde es hell, und die Schatten der Wolkenkratzer drehten sich mit dem Lauf der Sonne, während zahllose winzige Menschen wie Ameisen auf Speed durch die Straßen wuselten. Über alldem schwebte ein Schriftzug mit dem Titel des Kunstwerks: Zeit.
Ich nahm die Brille wieder ab. »Ich glaube, ich verstehe, was du damit sagen willst: Über all den Illusionen und der Hektik unserer Zeit vergessen wir unsere eigene Vergänglichkeit – und die der Dinge, die wir schaffen.«
Sie strahlte. »Das ist besser als der Erklärungstext im Ausstellungskatalog!«
Ich zog sie näher an mich heran. »Tja, du hättest mich eben schon eher einbeziehen sollen.«
»Ich bin da ein bisschen abergläubisch«, erwiderte sie und schaute mir verführerisch lange in die Augen. »Wenn ich jemandem ein halb fertiges Kunstwerk zeige, dann habe ich immer die Sorge, dass ich die Energie verliere, um es zu vollenden. Das ist mir schon ein paarmal passiert.«
Ich konnte das verstehen, dennoch hatte ich mich in den letzten Wochen ein wenig vernachlässigt gefühlt. Adina war so vertieft in ihre Arbeit gewesen, dass wir kaum Zeit miteinander verbracht hatten. Doch ich hütete mich, ihr das zu sagen.
»Wie lange hast du daran gearbeitet?«, fragte ich stattdessen.
»Den größten Teil der Arbeit haben zwei Roboterarme gemacht. Mit der Hand hätte ich diese filigranen Strukturen aus Sand niemals hingekriegt.«
»Trotzdem … Es tut mir weh, mit anzusehen, wie das jetzt alles zu Staub zerfällt.«
»Genau das habe ich beabsichtigt.«
Wir lösten uns aus unserer Umarmung, und ich wandte mich dem Tisch in der Ecke zu meiner Linken zu. Darauf stand eine Art miniaturisiertes Baugerüst, das einen halb fertigen Turm mit quadratischem Grundriss umgab. Die Oberkanten der Mauern sahen aus wie eine Wendeltreppe, die nirgendwo hinführte. Ein kleines Männchen aus grauem Ton stand ungefähr auf halber Höhe auf einer der Stufen.
Der Blick durch die Brille erweckte die Skulptur zum Leben und offenbarte Adinas Botschaft. Nun wuselten winzige Bauarbeiter auf dem Gerüst herum. Während der graue Mann mit gebeugtem Rücken die Treppe hinaufkletterte, fügten sie am oberen Ende neue Stufen hinzu. Das Material dafür holten sie vom unteren Rand des Turms, sodass dieser immer wieder ein Stück nach unten sackte. Auf diese Weise rannte das Männchen endlos im Kreis herum wie auf einer der unmöglichen Endlostreppen in den Bildern eines M. C. Escher. Der Weg zum Glück lautete der Titel des Kunstwerks.
Auch die meisten anderen Skulpturen hatten eine reale und eine virtuelle Komponente. Bei einer Installation mit dem Titel Hot Rhythm tropfte zum Beispiel Wasser aus einem Schlauch auf eine heiße Herdplatte, wo die Tropfen dann verdampften und dabei zischten und tanzten. Durch die Brille gesellten sich winzige Menschen zu den Wasserperlen und hüpften im Takt fetziger Musik um sie herum. Ein anderes Kunstwerk namens Zweifel zeigte eine wunderschön gestaltete Rose, die anstelle der Blätter zwei dürre Arme mit dornigen Händen hatte. In der virtuellen Animation rissen die Arme die Blütenblätter aus, bis die kahle Rose zusammensackte, zu knospen anfing und sich wieder entfaltete, nur um sich erneut selbst zu zerfleddern. Auf einem Tisch war ein gewöhnlicher Spiegel aufgestellt. Betrachtete man ihn durch die Brille, sah man sein eigenes Spiegelbild in Flammen aufgehen. Selbsterkenntnis lautete die Überschrift.
Ich war beeindruckt. Zwar hatte ich schon zuvor Werke von Adina gesehen, doch die Skulpturen dieser Ausstellung waren anders: doppeldeutig, düster und ironisch. Ihre Kunst schien Adinas Art zu sein, ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.
Meine eigene Strategie war weniger effektiv. An der Oberfläche führte ich ein Leben, wie ich es mir früher in meinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt hätte. Doch etwas hielt mich davon ab, dieses Leben zu genießen, eine Art Schatten, der stets am Rand meines Gesichtsfelds zu lauern schien.
Seit ich den Token losgeworden war, lebte ich mit Adina zusammen. Ich hatte meinen Job in Berlin gekündigt und war damit vermutlich einem Rauswurf zuvorgekommen; die anderen Mitglieder meines Teams waren alle gefeuert worden. In Neopolis eine neue Stelle zu finden war leichter gewesen, als ich erwartet hatte. Seit ein paar Wochen arbeitete ich als Projektleiter bei Bowman & Hall, einer IT-Beratungsfirma, die sich auf die Unterstützung ausländischer Firmen mit Niederlassungen in Neopolis spezialisiert hatte. Es war nicht gerade mein Traumjob, aber er wurde gut bezahlt, und so hatte ich nicht das Gefühl, nur nutzlos herumzusitzen.
Außerdem half der Job dabei, die Erinnerungen an die Geschehnisse kurz nach meiner Ankunft in Neopolis zumindest tagsüber zu verdrängen. Doch nachts wachte ich oft schweißgebadet aus düsteren Träumen auf und starrte minutenlang in die Dunkelheit, bis ich sicher war, dass ich wach war und nicht gefangen in einem quälenden Endlostraum. Mein Dschinn hatte meine Angstzustände natürlich registriert und mir mehrfach den Vorschlag gemacht, mit ihm über meine Erlebnisse zu reden; er verfügte über ein Modul mit psychiatrischem Fachwissen und hatte mir absolute Vertraulichkeit zugesichert. Doch ich hatte das abgelehnt und mich ebenso geweigert, die Hilfe eines menschlichen Spezialisten in Anspruch zu nehmen. Auch mit Adina hatte ich bis jetzt kaum über unsere gemeinsamen Erlebnisse geredet. Es tat einfach zu weh, daran erinnert zu werden, wie ich an ihr gezweifelt hatte.
Schlimmer noch war, dass diese Zweifel niemals ganz verschwunden waren.
Willst du wissen, warum Adina Marini dir hilft? Welche Rolle sie in dieser Geschichte in Wahrheit spielt? Die Worte aus dem Chat hatten sich in meinem Unterbewusstsein festgesetzt wie antibiotikaresistente Keime. Vermutlich steckte dahinter die tief in mir verwurzelte Gewissheit, dass sich eine Frau wie sie – schön, klug, erfolgreich – niemals mit einem Typen wie mir abgeben würde. So oft sie mir auch versicherte, dass sie mich liebe, ich wurde diese Zweifel einfach nicht mehr los.
Der nächste Tisch war leer. Auch durch die Brille sah man keinerlei Objekt oder Animation, nur der Titel des Kunstobjekts, das hier eigentlich hätte ausgestellt werden sollen, schwebte in der Luft: Wirklichkeit.
»Fehlt da nicht noch was?«, fragte ich.
Adina grinste nur.
Leicht irritiert wandte ich mich dem nächsten Tisch zu, auf dem nur eine einzige Goldmünze lag, größer und dicker als eine gewöhnliche Münze. Ich erstarrte.
»Ist das etwa …?«
Adina sagte nichts, sah mich nur erwartungsvoll an.
Ich setzte die Brille wieder auf, doch die Münze sah unverändert aus. Wie bei den anderen Tischen erschien ein Schriftzug mit dem Titel des Kunstwerks in der Luft: Der Fluch. Und darunter in etwas kleinerer Schrift: Nehmen Sie die Münze in die Hand!
Zögernd streckte ich die Hand aus. Der Token fühlte sich schwer und seltsam warm an. Plötzlich quoll Blut daraus hervor und rann mir über die Hand. Ich konnte spüren, wie es mir über die Finger lief und auf den Tisch tropfte.
Erschrocken ließ ich die Münze fallen. Sie polterte auf den Tisch. Eine neue Schrift erschien: Bitte legen Sie die Münze zurück auf die rote Markierung in der Mitte des Tischs. Ich starrte meine blutige Hand an und nahm die Brille ab. In der Wirklichkeit war kein Blut zu sehen, aber meine Handfläche war feucht.
Meine Stimme zitterte, als ich sie fragte: »Wie … wie hast du das gemacht?«
Sie hob die Münze auf und zeigte mir ein winziges Loch auf der Rückseite.
»Im Inneren ist ein Schwamm, der warmes Wasser speichert. Über einen eingebauten Mechanismus wird dieser Schwamm ausgedrückt, wenn du die Münze in der Hand hast. Sobald die Münze auf der Markierung liegt, wird sie durch eine kleine Öffnung im Tisch wieder aufgefüllt.«
Sie deutete auf die runde Vertiefung in der Mitte, in der die Münze gelegen hatte, und platzierte sie dort wieder. Dann sah sie mich mit gerunzelter Stirn an.
»Was ist? Gefällt es dir nicht?«
»Doch … es ist … beeindruckend.«
»Aber?«
»Als ich gerade die Münze in der Hand hatte … Ich weiß auch nicht. Plötzlich war das alles wieder da. Der Marid. Die Singhs. Die Typen, die uns gejagt haben. Ich … es tut mir leid …«
Sie blickte mich ernst an. »Nein, mir tut es leid. Ich hätte dich vorwarnen sollen. Verzeih mir, ich …«
Ein Summen unterbrach sie. Durch die immer noch geöffnete Tür des Ausstellungsraums schwebte eine Kameradrohne herein.
»Gehört das auch zu deinem Ausstellungskonzept?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Die ist vermutlich vom Sicherheitsdienst.« Sie machte eine Geste in Richtung der Drohne und rief: »Verschwinden Sie sofort von hier! Die Drohne könnte meine Kunstwerke beschädigen!«
Die Drohne verharrte einen Moment auf der Stelle. Ihre beiden Kameraaugen schienen uns neugierig zu mustern. Dann drehte sie ab, flog jedoch nicht aus dem Raum, sondern beschrieb einen Halbkreis um uns herum und schwebte genau auf die Nachbildung von Neopolis zu.
»Nein, verdammt!«, schrie Adina. »Nicht!«
Doch es war bereits zu spät: Die Drohne flog dicht über die Spitzen der Wolkenkratzer. Der starke Wind der Rotoren fegte wie ein Sturm durch die Stadt aus Sand und hinterließ eine Spur der Zerstörung. Etliche Fassaden der Hochhäuser bröckelten. Die Nachbildung einer rechteckigen Säule, die auf einem kleinen Platz stand, stürzte um.
Ich machte einen Satz und versuchte, das Fluggerät zu packen, doch es wich mir mühelos aus und flog über einen der Tische, auf dem die übergroße Nachbildung eines Gehirns zu sehen war.
Bevor die Drohne erneut in die Mitte des Raums fliegen konnte, stellte ich mich ihr in den Weg und sprang mit hochgestreckten Armen auf der Stelle wie ein Fußballtorwart, um sie abzuwehren. Immerhin gelang es mir so, das Ding von dem Tisch in der Mitte fernzuhalten.
»Verpiss dich, du blöder Troll!«, rief ich.
Die Drohne nahm einen erneuten Anlauf, an mir vorbei über die Nachbildung von Neopolis zu schweben. Bei dem Versuch, sie zu packen, versetzte ich dem Gerät einen Stoß. Es trudelte leicht, stabilisierte sich aber sofort wieder. Dann jedoch legte es sich schräg, beschleunigte und krachte über dem Tisch mit der heißen Herdplatte gegen die Wand.
Die Rotoren des Fluggeräts jaulten auf wie vor Schmerz. Es prallte zurück, beschrieb eine Kurve und stieß ein Stück weiter rechts erneut gegen die Wand. Immer wieder flog es dagegen wie eine Fliege vor einer Glasscheibe. Wer auch immer das Ding steuerte, musste die Kontrolle darüber verloren haben.
Ich riss mir mein schwarzes T-Shirt vom Leib und warf es über die Drohne. Der Stoff verfing sich in ihren Rotoren und ließ sie absacken. Ich packte sie in der Luft und hielt sie fest. Die beiden noch funktionierenden Rotoren dröhnten in dem vergeblichen Versuch, sich zu befreien, auf maximaler Leistung, bis ich den Notschalter fand und sie deaktivierte.
Ein Mann in der Uniform eines Sicherheitsbediensteten stürmte in den Raum.
»Was ist hier los?«, rief er.
Adina zeigte auf die Drohne. »Irgendwer hat versucht, meine Ausstellung zu sabotieren!«, sagte sie mit bebender Stimme.
Der Sicherheitsmann verstand ihre Worte falsch. Er hob einen Elektroschocker.
»Nehmen Sie die Hände hoch!«, schrie er in meine Richtung.
»Nein, nein, nicht er!« Adina drückte die Hand des Mannes nach unten. »Die Drohne! Irgendwer hat sie hier reingesteuert und wollte meine Kunstwerke zerstören!«
»Das ist eine von unseren Drohnen«, erwiderte der Sicherheitsmann.
»Dann feuern Sie den Typen, der sie gesteuert hat!« Adinas Gesicht war rot vor Zorn. Sie zeigte auf die Stadt aus Sand. »Sehen Sie sich an, was er angerichtet hat! Ich habe Wochen an dieser Skulptur gearbeitet, und in ein paar Stunden ist Ausstellungseröffnung!«
Der Mann vom Sicherheitsdienst wirkte eingeschüchtert. »Aber … aber diese Drohne ist selbststeuernd. Sie fliegt einen festgelegten Kurs durch die Galerie und schlägt Alarm, falls etwas nicht stimmt. Sie ist auch darauf programmiert, eventuelle Einbrecher zu verfolgen. Vielleicht hat sie Sie für Diebe gehalten.«
»Wir haben beide eine Sicherheitsfreigabe, sonst wären wir doch um diese Zeit gar nicht in den Raum gekommen«, protestierte Adina.
»Es tut mir leid«, meinte der Sicherheitsmann kleinlaut. »Die Steuerung muss kaputt sein.«
Er nahm mir die Drohne ab, betrachtete sie argwöhnisch von allen Seiten und schickte sich an, sie aus dem Raum zu tragen.
»Moment«, rief ich, zog das T-Shirt aus den Rotoren und streifte es mir wieder über. Es war an mehreren Stellen eingerissen.
Nachdem der Sicherheitsbedienstete gegangen war, starrte Adina eine Weile stumm auf die Sandskulptur. Um sie zu trösten, nahm ich sie in den Arm.
»Es tut mir leid. Wenn ich schneller gewesen wäre …«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, im Gegenteil. Wenn du nicht eingegriffen hättest, hätte das Ding die ganze Stadt zerstört.«
»Meinst du, du kannst den Schaden bis morgen reparieren? Wenn ich kann, helfe ich dir natürlich dabei.«
»Nein. Nein, ich glaube, das ist gar nicht nötig. Die Stadt sollte ja sowieso im Verlauf der Ausstellung allmählich zerfallen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass man den Effekt bei der Vernissage noch nicht richtig sieht und die Leute vielleicht meine Botschaft nicht verstehen. So gesehen hat mir dieser Typ einen Gefallen getan.«
»Das war bestimmt nicht seine Absicht. Was denkst du, wer steckt dahinter? Hast du irgendwelche Hater?«
»Nur die üblichen Netztrolle, soweit ich jedenfalls weiß. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wer so etwas macht. Zumal es sicher nicht so leicht ist, die Kontrolle über eine der Sicherheitsdrohnen zu übernehmen.«
»Ein anderer Künstler vielleicht, der neidisch auf dich ist?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich war es irgendein dummer Junge in Schanghai oder Kuala Lumpur, der einfach ein bisschen Chaos anrichten wollte und jetzt ein Holo davon ins Netz stellt.«
»Ausgerechnet am Abend vor der Vernissage? Wäre das nicht ein seltsamer Zufall?«
»Was weiß ich. Jedenfalls müssen wir es dem Sicherheitsdienst überlassen, rauszufinden, wer dahintersteckt. Zum Glück ist ja nicht allzu viel Schaden entstanden. Lass uns nach Hause gehen. Ich will versuchen, noch ein paar Stunden zu schlafen.«
Ich stimmte ihr zu, doch das Ereignis hatte uns beide so sehr aufgewühlt, dass wir kaum ein Auge zubekamen. Lange lag ich in der Dunkelheit, starrte an die Decke und dachte über das nach, was geschehen war. Vielleicht war es wirklich nur ein dummer Zufall gewesen, dass die Drohne ausgerechnet an diesem Abend verrücktgespielt hatte. Doch ich konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass mehr dahintersteckte, wenn ich auch beim besten Willen keine Ahnung hatte, was.
2.
»Da bist du ja endlich!«, sagte Adina mit leicht gereiztem Unterton, als ich am nächsten Abend in der Galerie eintraf. Sie wirkte müde und angespannt.
»Tut mir leid«, erwiderte ich und gab ihr einen flüchtigen Kuss. »Das Meeting hat ein bisschen länger gedauert.«
Das war nicht die ganze Wahrheit. Tatsächlich hatte ich am Nachmittag eine wichtige Kundenpräsentation gehabt – meine erste Bewährungsprobe als Teamleiter der Firma Bowman & Hall.
Unser Kunde war ein deutsches Pharmaunternehmen, das in Neopolis eine Produktionsstätte und eine Vertriebsniederlassung betrieb. Man hatte uns damit beauftragt, ein Sicherheitskonzept für die geplante Markteinführung einer neuen Kategorie von personalisierten Medikamenten zu erstellen. Dabei wurden auf Basis einer Genanalyse und umfangreicher Diagnostik von einer künstlichen Intelligenz individuelle Wirkstoffe synthetisiert – »für jeden seine persönliche Pille«, wie der Marketingleiter des Unternehmens es ausgedrückt hatte. So konnte man im Prinzip hochwirksame Therapien herstellen. Das Verfahren hatte bereits spektakuläre Erfolge bei der Bekämpfung von Krebs, Alzheimer und genetisch bedingten Krankheiten erzielt. Dennoch war es umstritten, nicht zuletzt, weil die bei neuen Medikamenten vorgeschriebenen langfristigen Tests dabei nicht möglich waren. Manche Ärzte bezweifelten, dass die künstliche Intelligenz die Wirkung des jeweiligen Stoffes im Körper des Patienten präzise genug simulieren konnte, um alle denkbaren Nebenwirkungen und langfristigen Effekte vorauszusagen.
Die Präsentation war nicht besonders gut gelaufen. Ich verstand nicht viel von Chemosynthese und verspürte eine tiefe Abneigung gegen das Unternehmen, das Therapien anbot, die sich nur Reiche leisten konnten, während die Unberechtigten im Norden der Stadt nicht einmal eine rudimentäre Gesundheitsversorgung hatten. Außerdem hatte ich, um meine Müdigkeit nach der schlaflosen Nacht zu übertünchen, zu viele Energydrinks getrunken und davon Kopfschmerzen bekommen. Ich war nervös und fahrig gewesen und hatte mich mehrfach verhaspelt. Als dann die aus Deutschland angereisten Manager kritische Fragen stellten, hatte ich die meisten Antworten nicht gewusst und auf meine Teamkollegen verweisen müssen, die die Detailarbeit gemacht hatten. Ich hatte wie ein Depp dagestanden.
Anschließend hatte mir Dave Clarke, der Niederlassungsleiter, einen längeren Vortrag darüber gehalten, wie wichtig der Kunde für Bowman & Hall sei und dass man sich solche Patzer nicht leisten könne, wenn man gegen die internationale Konkurrenz bestehen wolle. Da ich keinesfalls zu spät zu Adinas Vernissage kommen wollte, hatte ich die ganze Zeit wie auf Kohlen gesessen und gute Lust gehabt, auf der Stelle zu kündigen. Der Job machte mir ohnehin keinen besonderen Spaß, und ich war dank der Schadensersatzzahlung, die ich nach meinem Ausflug in die virtuelle Hölle bekommen hatte, nicht auf das Einkommen angewiesen. Doch ich wollte vor Adina nicht wie ein Loser dastehen, der keinen anständigen Job hinbekam. Also hatte ich meinen Ärger heruntergeschluckt und die Moralpredigt über mich ergehen lassen. Anschließend war ich zu Adinas Wohnung gefahren, hatte schnell geduscht, meinen besten Anzug angezogen und einen Wagen hierher genommen.
Ich ergriff ihre Hand und merkte, wie kalt sie war. »Nervös?«
»Ein bisschen. Willst du mal sehen, was ich heute gemacht habe?«
»Unbedingt!«
Ich folgte ihr in den Ausstellungsraum. Alles sah so aus wie am Vorabend. Die Zerstörungen, die die Drohne in der Stadt aus Sand angerichtet hatte, erschienen mir unverändert. Doch als ich die Holobrille aufsetzte, sah ich den Unterschied: Die Wolkenkratzer aus Sand wirkten auf einmal unversehrt. Der Verkehr und die Animationen liefen nicht wie zuvor im Zeitraffer ab, sondern in normaler Geschwindigkeit.
Ich stutzte. Hatte Adina nicht gestern gesagt, sie wolle die Zerstörungen in das Kunstwerk einbeziehen, statt sie zu übertünchen?
Bevor ich sie danach fragen konnte, zischte plötzlich eine virtuelle Drohne von der Seite heran und krachte in eines der Hochhäuser. Trümmer stürzten in die Tiefe. Die Geräusche von Explosionen waren zu hören, Schreie, dann Sirenen. Feuer brachen aus und leckten an den Gebäuden hoch. Dann beschleunigte sich die Animation, bis die Stadt im Zeitraffermodus war. Nach etwa zwei Minuten verlangsamte sich die Zeit wieder, und die Animation begann von Neuem.
»Wow!«, rief ich aus. »Das hast du alles heute gemacht?«
Sie nickte, und die Unsicherheit, die sie eben noch ausgestrahlt hatte, verwandelte sich in Stolz. »Ich habe den Flug der echten Drohne rekonstruiert. Dank deines Einsatzes ist sie zwar gestern nicht wirklich in die Häuser gekracht, aber ich hatte nicht die Zeit, um es realistischer zu machen.«
»Es … ist beeindruckend. Aber wird dadurch die zentrale Aussage deines Kunstwerks, der langsame Verfall der Stadt durch die zerstörerische Kraft der Zeit, nicht verändert?«
»Das stimmt. Aber das ist in Ordnung so: Kunst muss sich verändern. Durch den Vorfall gestern ist eine neue Botschaft hinzugekommen: Der Verfall durch die Zeit verläuft nicht gleichmäßig. Diese Stadt ist nicht nur auf Sand gebaut, sie ist auch verletzlich gegenüber gezielter Zerstörung und plötzlichen Katastrophen. Damit wird die Aussage noch realistischer und eindringlicher, wie ich finde.«
»Gibt es schon etwas Neues darüber, wer hinter dem Angriff steckt?«
»Anscheinend niemand«, erwiderte Adina. »Der Sicherheitsdienst der Galerie hat das überprüft. Offenbar hat es sich wirklich um eine Fehlfunktion des Überwachungssystems gehandelt. Ein Softwarefehler. Sie haben ein Update eingespielt, damit das nicht wieder vorkommt.«
Ich war skeptisch, behielt meine Zweifel jedoch für mich. Stattdessen beschloss ich, wachsam zu sein. Wenn es doch ein gezielter Sabotageakt gewesen war, hatte der Urheber sein Ziel, die Ausstellung zu sabotieren, noch nicht erreicht. Nicht auszuschließen, dass er oder sie einen weiteren Angriff plante, womöglich sogar heute Abend während der Vernissage.
»Möchtest du etwas trinken? Ich habe echten Champagner.«
»Du schenkst Alkohol aus? Hier in aller Öffentlichkeit?«
Sie grinste verschwörerisch. »Natürlich nicht für die Gäste. Nur für uns beide.« Sie zwinkerte mir zu, bevor sie sich entfernte.
»Möge deine Ausstellung die Leute umhauen!«, sagte ich, als Adina mit zwei Gläsern zurückkam.
Sie lächelte flüchtig, machte dann ein ernstes Gesicht.
»Mir würde es schon reichen, wenn sie einige Leute zum Nachdenken bringt.«
Wir tranken, küssten uns. Adina nahm noch einen Schluck Champagner, bevor sie die Flasche in einem Abstellraum versteckte.
Kurz darauf trafen die ersten Gäste ein: Kunstexperten, Geschäftsleute, Vertreter der Kulturbehörde, andere Künstler. Ich kannte keinen von ihnen, aber Adina begrüßte die meisten mit Vornamen und Küsschen oder Umarmungen. Während ich mich höflich vorstellte, versuchte ich vergeblich, mir die Namen zu merken. Mein Dschinn hätte mir natürlich die Namen nennen können, aber es galt als unschicklich, während gesellschaftlicher Anlässe Holobrillen zu tragen.
Eine schwarzhaarige Frau mit dunklem Teint wurde von Adina besonders herzlich begrüßt und lächelte mich an. Ich hatte sie schon einmal gesehen, wusste aber nicht, wo.
»Carmen dos Santos«, stellte sie sich mir vor. »Ich bin Adinas Agentin.«
Jetzt fiel es mir wieder ein: Sie hatte Adina auf dem Basar am Al-Batha-Platz eine Tasche mit Bargeld übergeben, kurz nachdem wir dem Verbrecherclan der Singhs entkommen waren.
Während Adina die neuen Gäste begrüßte, plauderte die Agentin eine Weile mit mir über die Bedeutung menschlicher Kunst in einer Zeit, in der ein Hochleistungscomputer in einer Sekunde eine Million Gemälde in der Qualität eines Rembrandts generieren könne. Ich spürte, dass sie viel lieber darüber geredet hätte, warum wir damals so dringend altmodisches Bargeld gebraucht und wofür wir es ausgegeben hatten. Doch wenn Adina ihr das nicht erzählt hatte, würde ich es erst recht nicht tun.
Plötzlich ging eine subtile, aber doch deutlich spürbare Veränderung wie eine Welle durch den Raum. Die Gespräche um mich herum schienen etwas leiser zu werden, Köpfe drehten sich.
Unwillkürlich versteifte ich mich. War etwas Ungewöhnliches passiert? Eine weitere Attacke auf Adinas Kunst vielleicht? Ich blickte mich um und entspannte mich wieder, als ich den Grund für die Unruhe erkannte: Aron Keaton war eingetroffen. Er trug einen eleganten dunklen Anzug, sein grau meliertes Haar und der Vollbart waren wie immer perfekt frisiert. An seiner Seite war eine junge Blondine in einem ausgesprochen freizügigen Kleid, fast als wollte sie die strengen Sitten Saudi-Arabiens verhöhnen, die überall außerhalb der Stadt galten.
Keaton ging zielstrebig auf Adina zu, die ein paar Meter von mir entfernt stand. Er lächelte, als er seine frühere Mitarbeiterin begrüßte, doch seine Augen blieben kühl. Adina antwortete mit einer ebenso wenig ernst gemeinten Höflichkeitsfloskel. Daraufhin kam der Milliardär zu mir.
»Nick!«, rief er und grinste, als wären wir alte Freunde. »Schön, Sie wiederzusehen! Wie ich höre, arbeiten Sie inzwischen für Bowman & Hall. Glückwunsch!«
Der Sarkasmus seiner Gratulation war so subtil, dass man ihn kaum wahrnahm. Dennoch war klar, was er mir damit sagen wollte: Hätte ich damals sein Jobangebot angenommen, hätte ich eine bedeutend bessere Position haben und wesentlich mehr verdienen können. Doch so wenig mir mein aktueller Job auch gefiel – nach allem, was mir Adina über ihre Erfahrungen mit ihm erzählt hatte, wäre es mir unmöglich gewesen, für diesen skrupellosen Mann zu arbeiten.
»Vielen Dank«, erwiderte ich und rang mir ein Lächeln ab, das wohl nicht sehr überzeugend war.
»Ihre Freundin ist eine bemerkenswerte Künstlerin«, stellte Keaton fest. »Neopolis kann sich glücklich schätzen, dass sie hier tätig ist.«
»Ich weiß«, stimmte ich ihm zu.
Keaton grinste breit. »Ich spüre Ihre Anspannung, Nick. Ich kann das verstehen. Adina und ich hatten ein paar Meinungsverschiedenheiten. Aber das liegt alles längst hinter uns. Und keine Sorge, ich bin nicht eingeschnappt, weil Sie mein Angebot damals abgelehnt haben. Ich bin kein nachtragender Mensch. Glauben Sie mir, ich wäre nicht hier, wenn ich Adinas Arbeit nicht bewundern würde.«
»Ich bin sicher, sie weiß das zu schätzen.«
»Wow!«, entfuhr es Adinas Agentin, nachdem Keaton und seine Begleiterin weitergegangen waren. »Ich wusste nicht, dass Sie Aron Keaton persönlich kennen.«
»Ich dachte, den kennt hier jeder«, erwiderte ich.
»Ja, schon. Aber es kommt nur selten vor, dass Keaton jemanden von sich aus anspricht, jedenfalls sofern es sich nicht um eine bedeutende Persönlichkeit handelt. Entschuldigung, das war nicht respektlos gemeint. Sie sind natürlich Adinas Freund, und als solcher …«
»Schon gut. Mir wäre es ehrlich gesagt lieber, Keaton würde mich ignorieren. Die Aufmerksamkeit des mächtigsten Shareholders der Stadt ist nicht unbedingt das, was ich mir wünsche.«
Sie nickte. »Ich verstehe, was Sie meinen.«
Sie verabschiedete sich von mir, um einen anderen Gast zu begrüßen. Ich sah mich nach Adina um, doch sie war umringt von Leuten, die ich nicht kannte. Gern hätte ich sie jetzt für mich gehabt, doch dies war ihr großer Abend, da hielt ich mich lieber im Hintergrund. Also wandte ich mich dem üppigen Buffet zu. Als ich mit einem Teller voller arabischer Köstlichkeiten zu einem der Stehtische ging, kam ein bekanntes Gesicht auf mich zu.
»Nick!«, sagte Mohammed Al-Dschabir. »Wie geht es Ihnen?«
Ich war mir nicht sicher, ob ich mich über sein Auftauchen freuen sollte. Einerseits hatte der Mann, der den Marid kontrollierte, tatenlos zugesehen, während ich in Dschahannam um mein Leben und meinen Verstand kämpfte, und am Ende sogar versucht, mich zu einer falschen Antwort zu verführen. Andererseits hatte er nur seinen vom König selbst vergebenen Auftrag erfüllt, und ich verdankte ihm meine Abfindung und mein unbefristetes Aufenthaltsrecht in der Stadt aus Licht.
»Ganz gut, danke. Und Ihnen? Macht es Ihnen immer noch Spaß, dabei zuzusehen, wie der Token unschuldige Menschen in ihr Verderben reißt?«
Ein kurzer Anflug von Ärger überschattete sein Gesicht, was wohl zeigte, dass ich ins Schwarze getroffen hatte. Doch er beherrschte sich rasch wieder.
»Sie wissen, dass ich darüber nicht sprechen kann.«
»Und Sie wissen sicher ganz genau, wie es mir geht, falls Sie das wirklich ernsthaft interessiert.«
Er nickte. »Ich habe zumindest mitbekommen, dass es hier gestern eine Fehlfunktion gab und es Ihrem raschen Einsatz zu verdanken ist, dass die Kunstwerke Ihrer Partnerin dabei nicht noch schlimmer beschädigt wurden.«
»Fehlfunktion?«, fragte ich.
»Haben Sie Grund zu der Annahme, dass etwas anderes dahintersteckt?«
»Es wäre schon ein seltsamer Zufall, dass so eine ›Fehlfunktion‹ ausgerechnet am Vorabend der Vernissage auftritt, wenn keine Zeit mehr bleibt, den Schaden noch zu reparieren.«
»Zufälle passieren.«
»Sabotageakte passieren auch.«
Al-Dschabir nahm einen Schluck des alkoholfreien Cocktails, den ihm eine menschliche Kellnerin in die Hand gedrückt hatte.
»Hat es Frau Marini sehr hart getroffen?«, fragte er.
»Im Gegenteil. Sie hat das als künstlerische Inspiration genutzt und den Angriff zum Teil ihres Kunstwerks gemacht. Sie werden sehen.«
»Beeindruckend.«
»Ja. Ich hoffe nur, wer immer den Angriff durchgeführt hat, versucht es nicht noch einmal.«
»Keine Sorge. Ich glaube zwar nicht an Ihre Theorie eines vorsätzlichen Angriffs, aber wir sind natürlich trotzdem auf diese Möglichkeit vorbereitet. Diese Galerie ist heute Abend einer der bestgesicherten Orte in Neopolis.«
Seine Bemerkung machte mich stutzig. »Was treibt Sie eigentlich heute hierher? Interessieren Sie sich für Kunst?«
Er lächelte süffisant. »Ich interessiere mich für alles, was in dieser Stadt passiert. Wir sehen uns, Nick!«
Damit wandte er sich um und streifte durch den Raum, als suchte er jemanden. Doch er hielt an keinem der anderen Tische an und redete mit niemandem.
Während ich mich noch darüber wunderte, ging erneut eine Welle der Unruhe durch den Raum, noch deutlicher spürbar diesmal. Der Auslöser war die Ankunft einer Gestalt in einem weiten, hellgrau schimmernden Gewand. Ihr Gesicht war von einem Schleier verhüllt, dennoch schien jeder zu wissen, um wen es sich handelte. Auch ich ahnte, wer sich darunter verbarg: Nara Rynkova, angeblich reichste Frau der Welt und eine der bedeutendsten Shareholder der Stadt. Ich hatte bis jetzt nur Gerüchte über die stets verschleierte Frau gehört. Manche behaupteten, sie sei zum Islam konvertiert und streng religiös, andere meinten, ihr Gesicht sei bei einem Unfall im Kindesalter entstellt worden, wieder andere glaubten, sie verberge unter dem Schleier ihre strahlende Schönheit und habe sogar den König zum Geliebten gehabt. Womöglich war das auch einfach nur ihre Masche, um unnahbar und geheimnisvoll zu wirken.
Einig waren sich alle, dass Nara Rynkova die Erzfeindin von Aron Keaton war. Ich sah es in der aufgesetzten Lässigkeit bestätigt, mit der er als Einziger im Raum ihr Eintreffen ignorierte. Seine Begleiterin dagegen starrte Rynkova an und sagte etwas zu ihm, das ich nicht verstehen konnte. Die Art, wie sie zusammenzuckte, als Keaton antwortete, machte seine Anspannung mehr als deutlich. Er hasste es, wenn ihm jemand die Show stahl, besonders wenn es Rynkova war.
Sie war in Begleitung eines bärtigen Mannes in einem traditionellen weißen Kaftan und mit einer rot-weiß gemusterten Kufiya auf dem Kopf. Als die beiden schweigend an mir vorbeigingen, hatte ich das Gefühl, dass Rynkova mich kurz ansah, obwohl ihre Augen hinter dem netzartigen Sichtfenster ihres Schleiers nicht zu erkennen waren. War da ein kaum wahrnehmbares Nicken in meine Richtung gewesen? Nein, das musste ich mir eingebildet haben. Sie kannte mich sicher nicht.
Rynkova ging direkt auf Adina zu und wechselte ein paar Worte mit ihr. Ich konnte nicht verstehen, was sie antwortete, aber ich sah in ihrem Gesicht, dass sie von der Anwesenheit der Shareholderin überrascht und beeindruckt war. Nachdem Rynkova weitergegangen war, ging ich zu ihr.
»Ich kann nicht glauben, dass die beiden wichtigsten Shareholder hier bei deiner Vernissage sind!«, sagte ich. »Du kannst so stolz auf dich sein.«
»Ich bin selbst überrascht«, erwiderte sie. »Mit Arons Erscheinen hatte ich gerechnet. Er lässt es sich nicht nehmen, bei solchen Anlässen im Mittelpunkt zu stehen. Aber Nara Rynkova? Sie zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit, und ich habe noch nie gehört, dass sie sich sonderlich für Kunst interessiert hätte. Jedenfalls hat sie bisher keine meiner Arbeiten gekauft.«
»Vielleicht ist sie nur wegen Keaton hier«, sagte ich und bemerkte erst zu spät, dass ich damit meine Aussage von gerade eben bezüglich Adinas Bedeutung relativierte.
Sie schien darüber nicht enttäuscht zu sein. »Gut möglich. Auf jeden Fall passt ihm das offenbar überhaupt nicht.«
Die beiden standen in diesem Moment einander gegenüber, einen guten Meter Abstand zwischen sich. Keaton gab sich keine Mühe, die Feindseligkeit in seinem Gesicht zu verbergen. Rynkova ihrerseits blickte ihn und seine Begleiterin wortlos an und wandte sich dann demonstrativ ab. Die Spannung zwischen den beiden war im ganzen Raum zu spüren.
Ich erblickte Al-Dschabir, der in einer Ecke des Raums stand, sein immer noch fast volles Cocktailglas in der Hand. Er schien die beiden Kontrahenten genau zu beobachten. Seine Lippen bewegten sich, als redete er mit jemandem, obwohl er keinen sichtbaren Gesprächspartner hatte. Womöglich sprach er mit dem Marid.
Endlich trat der Leiter der Galerie, ein fülliger Glatzkopf aus New York, in die Mitte des Raums, klopfte an sein Glas und sagte ein paar Worte zur Begrüßung. Dann öffnete er die Tür zum Ausstellungsraum, und eine Prozession setzte sich in Bewegung. Adina blieb im Vorraum und betrachtete von hier aus die Reaktionen der Besucher, die ihre Holobrillen aufsetzten und mit den Kunstwerken interagierten. Besonders der Token sorgte immer wieder für erstaunte Ausrufe, während die große Sandskulptur die Betrachter eher zu irritieren schien. Manche zuckten regelrecht zusammen – vermutlich in dem Moment, als in ihren Holodisplays die im Maßstab überdimensionale Drohne in einen der Sandtürme krachte.
Ich beobachtete derweil Rynkova und Keaton. Beide hatten sich noch nicht in den Ausstellungsraum begeben und schienen einander zu belauern, als warteten sie nur darauf, dass der andere einen Fehler machte. Die mysteriöse Shareholderin schien tatsächlich nicht wegen Adinas Kunst hergekommen zu sein. Aber warum dann? Keaton stellte sich offensichtlich dieselbe Frage. Er war von Rynkovas Erscheinen sichtlich überrascht worden und misstraute ihr zutiefst.
Konnte es sein, dass einer der beiden für den gestrigen Drohnenangriff verantwortlich war? Keaton traute ich eine solche Bosheit durchaus zu, aber als Meister der Täuschung griff er selten zu so offensichtlichen Mitteln, und wenn es ihm darum gegangen wäre, Adinas Vernissage zu sabotieren, wäre er wohl kaum selbst hier aufgetaucht. Rynkova andererseits hatte keinen Grund, einen Groll gegen Adina zu hegen – jedenfalls konnte ich mir keinen vorstellen.
Die Tür zum Vorraum öffnete sich unvermittelt, und ein halbes Dutzend Männer trat ein. Zwei von ihnen waren offensichtlich bewaffnete Sicherheitskräfte, die die Anwesenden sofort kritisch beäugten, die anderen trugen traditionelle arabische Gewänder. Der Mann in der Mitte der Gruppe war etwas kleiner als seine Begleiter, doch er stach deutlich heraus. Vielleicht lag es an seinem buschigen grauen Vollbart und den stechenden Augen unter dichten Brauen, vielleicht auch an der Art, wie seine Begleiter ihn umringten, oder an seinem gelassen-selbstbewussten Ausdruck. Ich erkannte ihn sofort, immerhin war ich ihm bereits begegnet, wenn auch nur in virtueller Form.
Ein Raunen ging durch die Besucher im Vorraum. Adina riss die Augen auf, als sie den Mann erkannte. Aron Keaton entglitten für einen kurzen Moment die Gesichtszüge, weil ihm vermutlich gerade klar wurde, warum seine Erzfeindin hergekommen war.
Mit gemessenen Schritten kam Seine Majestät, der König von Saudi-Arabien, auf uns zu.
3.
Adina und ich verbeugten uns tief, als der König uns gegenübertrat.
»Eure Hoheit, es ist mir eine große Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen«, brachte Adina heraus.
»Die Ehre ist ganz auf meiner Seite, Ms Marini«, erwiderte er in perfektem Englisch. »Ich gebe zu, ich verstehe nicht viel von moderner Kunst, aber man hat mir versichert, dass Sie eine bedeutende Künstlerin sind, die diese Stadt mit ihrem Schaffen sehr bereichert. Da ich gerade zu einem Kurzbesuch in Neopolis war, wollte ich es mir nicht nehmen lassen, mir Ihre Arbeiten selbst anzusehen.«
»Ich danke Ihnen sehr, Hoheit.« Adina verbeugte sich noch einmal.
Der König wandte sich mir zu.
»Es ist schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen, Mr Bartholomäus. Ich hoffe, Sie haben sich inzwischen von den Strapazen Ihres Abenteuers erholt und sich gut in der Stadt eingelebt.«
Ich schluckte. »Äh, danke, Hoheit. Ich fühle mich hier sehr wohl.«
»Das sollten Sie auch, mit einer so großartigen Künstlerin an Ihrer Seite.«
»Da bin ich ganz Ihrer Meinung, Hoheit.«
»Machen Sie beide mir doch die Freude, und führen Sie mich durch die Ausstellung.«
»Mit dem größten Vergnügen, Hoheit«, beteuerte Adina, obwohl ich ihr ansehen konnte, dass sie sich dabei unwohl fühlte.
Als wir zum Ausstellungsraum gingen, kamen wir an Aron Keaton und seiner Begleitung vorbei. Seine Majestät würdigte die beiden keines Blickes. Jeder wusste, dass der König sehr religiös war. Auch wenn er als vergleichsweise weltoffen und tolerant galt, musste die spärliche Bekleidung von Keatons Begleiterin für ihn eine Provokation sein. Sicher litt das Ansehen des Milliardärs darunter, und dieser war sich dessen durchaus be-wusst.
Nara Rynkova, die auf der anderen Seite des Spaliers stand, das die Gäste für den König gebildet hatten, verbeugte sich tief. Der König nickte ihr zu. Man konnte ihr Gesicht nicht sehen, aber diese Geste der Anerkennung bei gleichzeitiger Demütigung ihres Erzfeindes zauberte sicher ein breites Grinsen darauf. Nun war jedenfalls klar, warum sie hier war – im Unterschied zu Keaton hatte sie offensichtlich vom bevorstehenden Besuch des Königs gewusst. Der Milliardär würde sicherlich toben und irgendjemanden, der in seinem Umfeld für derartige Informationen zuständig war, feuern. Aber Keaton wäre nicht Keaton, wenn er sich irgendetwas hätte anmerken lassen, nachdem er seine anfängliche Überraschung überwunden hatte.
»Mir scheint, Sie haben wenig Vertrauen in die Zukunft dieser Stadt«, sagte der König, als sie vor der zentralen Skulptur standen. Einer seiner Bediensteten hatte ihm eine Holobrille gereicht, die er nur kurz aufgesetzt hatte. Offenbar hielt er sich lieber in der realen Welt auf als in der virtuellen.
»Sagen wir, ich habe wenig Vertrauen in die Vernunft der Menschen, die sie momentan kontrollieren«, gab Adina zurück.
Erschrockenes Atmen war von den Zuschauern zu hören, die sich aus dem Ausstellungsraum zurückgezogen hatten, um dem König ungehinderten Blick zu gewähren. Auch ich zuckte innerlich zusammen. In Anwesenheit Seiner Majestät derart offen Kritik an den Shareholdern zu üben, von denen die beiden wichtigsten Vertreter anwesend waren, war eine Provokation. Zumindest Keaton würde ihr das übel nehmen, über Rynkovas Reaktion konnte ich nur spekulieren.
Der König nickte. »Wir Sterblichen neigen dazu, uns und unsere Werke zu wichtig zu nehmen. Es wäre gut, wenn es mehr Menschen wie Sie gäbe, die sich der Vergänglichkeit und Bedeutungslosigkeit all unseres Schaffens im Angesicht Allahs bewusst sind.«
»Ich danke Ihnen, Hoheit.«
Die Anspannung, die seit dem Eintreffen des Königs geherrscht hatte, löste sich allmählich. Gespräche wurden wieder aufgenommen, und bald herrschte der normale Geräuschpegel einer Zusammenkunft vieler Menschen. Auch von Adina schien eine Last abzufallen. Während der König von einem Kunstwerk zum nächsten ging, erzählte sie ihm Details zu deren Entstehung.
Nur einmal entstand ein Moment der Anspannung, als der König die Goldmünze in die Hand nahm, sie erschrocken wieder losließ und seine Hand anstarrte, bis er schließlich die Holobrille abnahm. Ein paar lange Sekunden blieb er reglos stehen, und ich befürchtete schon, dass Adina in ernste Schwierigkeiten kommen würde, weil sie ihn beleidigt hatte. Doch dann nickte er nur, wischte sich die Hand an einem der bereitgelegten Papiertücher ab und ging wortlos weiter.
Der Rest des Abends verlief ohne weitere Aufregung. Adina wäre auch so der Star des Abends gewesen, doch nachdem der König persönlich ihre Werke betrachtet und gelobt hatte, war ihr Ansehen noch einmal deutlich gestiegen. Ich war enorm stolz auf sie, auch wenn ich ahnte, dass der Abend insbesondere Aron Keatons Abneigung gegen sie noch einmal gesteigert hatte. Der Milliardär hatte die Vernissage bereits kurz nach dem Erscheinen des Königs geradezu fluchtartig verlassen, während Rynkova sich noch lange mit Seiner Majestät unterhielt. Es wurde deutlich, dass die Vernissage die Kräfteverhältnisse im Shareholderkreis ein Stück weit zu ihren Gunsten verschoben hatte, und das war offensichtlich ihr Plan gewesen.
Vor diesem Hintergrund war der merkwürdige Drohnenvorfall gestern umso rätselhafter. Ein Zufall schien mir nun erst recht ausgeschlossen, doch wer dahintersteckte und mit welcher Absicht, erschloss sich mir beim besten Willen nicht.
Es war früh am Morgen, als die letzten Gäste gingen. Ich blieb bis zum Schluss, obwohl ich todmüde war. Immerhin hatte ich schon Schlimmeres durchgestanden und wollte vor Adina am Abend ihres Triumphs keine Schwäche zeigen.
Als wir endlich in ihrer Wohnung waren, nahm ich sie erleichtert in den Arm, froh darüber, dass die anstrengende Phase nun vorbei war und wir wieder mehr Zeit füreinander haben würden. Ich hatte erwartet, dass sie genauso erledigt wäre wie ich. Doch sie war durch ihren überraschenden Erfolg energetisiert und riss mir beinahe die Kleider vom Leib. Eine halbe Stunde später schliefen wir erschöpft, aber glücklich ein.
Wie so oft in den letzten Monaten wurde ich von Albträumen geplagt, in denen ich durch irgendwelche finsteren, ausweglosen Abgründe der Hölle irrte. Am Morgen wachte ich wie gerädert auf. Adina war schon aufgestanden und machte ein herzhaftes Frühstück. Es war Freitag, der auch in Neopolis wie im gesamten arabischen Raum der Beginn des Wochenendes war, sodass ich wenigstens nicht ins Büro musste.
»Wollen wir einen kleinen Strandspaziergang machen?«, fragte sie, nachdem wir ausgiebig gefrühstückt hatten.
Ich sah sie überrascht an. Bisher hatte sie noch nie einen derartigen Wunsch geäußert. Aber das mochte daran liegen, dass sie in den Monaten, seit wir ein Paar waren, auch am Wochenende gearbeitet hatte. Sie war wie besessen gewesen, und ich hatte vermutet, dass sie ihre Kunst nutzte, um die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten – ihre Gefangennahme und Misshandlung durch die Singhs, unsere Flucht über die Dächer im Norden der Stadt, vielleicht auch die Sorge um mich, nachdem ich das Labyrinth von Dschahannam betreten hatte.
»Gern!«, stimmte ich zu.
Wir fuhren mit einem selbstfahrenden Taxi in den Westen, wo sie einen einsamen Strandabschnitt kannte. Die Gegend war nicht besonders attraktiv. Produktionsanlagen und Lagerhallen säumten die Straße, und es gab keine eleganten Promenaden mit schattenspendenden Palmen. Doch dafür war es menschenleer.
Wir spazierten barfuß durch die Brandung, während die Sonne jetzt, am Mittag, unbarmherzig auf uns herabbrannte. Meine Cappy und die UV-reflektierende Kleidung schützten mich zwar vor den schädlichen Strahlen, linderten die Hitze jedoch kaum. Mir kam es wie eine dumme Idee vor, ausgerechnet um diese Zeit hier herumzulaufen, auch wenn das Meer unsere Beine etwas abkühlte.
»Ich frage mich, ob ich gestern einen Fehler gemacht habe«, sagte Adina unvermittelt, und ich begriff plötzlich, warum sie mich hierher in die Einsamkeit entführt und darauf bestanden hatte, dass wir die Holobrillen zu Hause ließen.
Ich sah mich misstrauisch um, konnte aber keine Drohnen oder andere Überwachungssysteme entdecken. Das garantierte zwar noch nicht, dass uns niemand zuhörte – in Neopolis konnte man sich dessen niemals absolut sicher sein. Aber dieser Strandspaziergang war wohl das, was in der Stadt echter Privatsphäre am nächsten kam, ohne dass wir uns auffällig in eine Blackbox zurückzogen.
»Inwiefern?«, fragte ich.
»Die Vernissage hat mich ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Dann kam auch noch der König. Und ich war dumm genug, ihm in aller Öffentlichkeit deutlich zu machen, was ich von der Politik des aktuellen Shareholderrates halte.«
»Und wo ist das Problem?«
»Das Problem ist, dass die Sicherheitsbehörden und Keatons Leute nun sehr viel genauer hinschauen werden, was ich tue. Und das bedeutet, dass ich wegen … gewisser Dinge … möglicherweise eine Menge Ärger bekommen könnte. Ich wollte dir das nur sagen, damit du dich darauf einstellen kannst.«
Erschrocken blieb ich stehen. Vor meinem geistigen Auge erschien das Bild, wie ich Adina zum ersten Mal wiedergesehen hatte, nachdem wir uns am Flughafen aus den Augen verloren hatten: Sie hatte splitternackt vor Aron Keatons Firmenzentrale demonstriert, bevor sie zusammen mit den anderen Demonstranten verhaftet worden war. Damals hatte ich dafür gesorgt, dass sie aus dem Gefängnis freikam. Doch ich verfügte nicht mehr über die Macht des Marids. Wenn sie sich erneut in Schwierigkeiten brachte, würde ich ihr nicht helfen können.
»Was hast du vor?«, fragte ich.
»Es ist besser, wenn du das nicht weißt.«
»Was?«
Fassungslos starrte ich sie an. Mir wurde plötzlich klar, wie wenig ich über die Frau wusste, mit der ich seit vier Monaten zusammenlebte. Ich hatte angenommen, dass sie nach unseren Erlebnissen ein für alle Mal genug von Abenteuern und Gefahr hatte und sich voll auf ihre Kunst konzentrierte. Vor allem hatte ich geglaubt, dass wir völlig offen zueinander wären, nachdem wir uns gegenseitig das Leben gerettet hatten. Doch ich hatte mich offensichtlich getäuscht. Adina vertraute mir nicht wirklich.
»Nun mach nicht so ein Gesicht!«, sagte sie. »Du weißt doch, dass ich mich gegen die Ausbeutung der Unberechtigten und für die Rechte fühlender Maschinen einsetze und dass ich dafür auch persönliche Risiken auf mich nehme.«
»Ja, schon. Aber ich hatte ehrlich gesagt angenommen, dass du das ab jetzt auf legalem Weg tun würdest. Und außerdem …«
Sie legte ihre Arme um mich und gab mir einen zärtlichen Kuss.
»Ich weiß, du denkst, ich vertraue dir nicht. Aber das stimmt nicht. Ich will dich bloß beschützen. Je weniger du weißt, desto weniger kann dir passieren, wenn sie mich erwischen.«
Ich löste mich von ihr. »Was zum Teufel hast du vor?«
»Wie gesagt, es ist besser, wenn du das nicht weißt. Du würdest mich niemals verraten, aber es gibt Methoden, um dein Wissen auch gegen deinen Willen aus dir herauszuholen. Außerdem: Wenn du Mitwisser bist, werden sie dich fast ebenso hart bestrafen wie mich.«
»Was hast du vor?«, fragte ich erneut und sah sie ernst an.
Stumm erwiderte sie meinen Blick. Ich hatte das Gefühl, dass wir an einem Abgrund standen, der sich unvermittelt vor uns aufgetan hatte.
»Nick, bitte verlange nicht von mir, dass ich mich zwischen dir und meinen Prinzipien entscheide«, flehte sie nach einem Moment.
»Alles, was ich von dir verlange, sind Offenheit und gegenseitiges Vertrauen«, erwiderte ich. »Welchen Sinn hätte unsere Beziehung sonst?«
»Ich würde dir mein Leben anvertrauen«, sagte sie ernst. »Aber ich habe ein Versprechen gegeben, und ich werde es nicht brechen. Nicht einmal für dich.«
»Ich teile ja deine Meinung zur sozialen Ungerechtigkeit in dieser Stadt«, versuchte ich eine Brücke zu bauen. »Aber kannst du dagegen nicht auf legalem Weg protestieren? Deine Kunst ist doch ein ideales Mittel, um auf die Missstände aufmerksam zu machen.«
»Mit meiner Kunst erreiche ich doch bloß diejenigen, die schon alles haben und denen es völlig egal ist, was mit den Unberechtigten passiert. Wenn ich wirklich etwas bewirken will, muss ich Risiken eingehen.«
»Das Einzige, was du bewirken wirst, ist, wieder im Knast zu landen, während Aron Keaton dafür sorgt, dass niemand von deiner Aktion erfährt, was auch immer es ist. Genau wie letztes Mal.«
»Diesmal wird es anders sein.«
Die Bestimmtheit, mit der sie das sagte, gefiel mir überhaupt nicht.
»Adina, glaubst du wirklich, du kannst dich mit Aron Keaton anlegen?«
In ihren Augen blitzte wilde Entschlossenheit. »Er ist nicht allmächtig. Und ich bin nicht allein.«
»Was meinst du damit?«
»Wie ich schon sagte, ist es besser, wenn du nichts darüber weißt.«
Frustriert warf ich die Arme in die Luft.
»Das ist doch Schwachsinn!« Ich war froh, dass das Meeresrauschen meine Stimme etwas dämpfte. »Du wirst gar nichts erreichen, außer dein Leben zu zerstören und meines noch dazu!«
Einen Moment lang schwieg sie. In ihren Augen las ich etwas, das vorher nicht da gewesen war. Enttäuschung?
»Du hast recht«, erwiderte sie mit bebender Stimme. »Ich habe kein Recht dazu, dich in diese Sache hineinzuziehen. Es ist vielleicht besser, wenn wir … eine Pause machen. Bis … die Sache vorbei ist.«
Ich starrte sie ungläubig an. »Eine Pause? Was bitte soll das denn heißen?«
Tränen traten in ihre Augen.
»Es … es tut mir leid, Nick. Ich liebe dich. Und genau deshalb kann ich nicht zulassen, dass du meinetwegen in Gefahr gerätst!«
»Bullshit!«, brüllte ich. »Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, willst du mir etwas über Gefahr erzählen? Ich habe dir schon mehrmals deinen Arsch gerettet, verdammt noch mal! Glaubst du wirklich, ich bin nicht in der Lage, auf mich selbst aufzupassen und meine eigenen Entscheidungen zu treffen?«
Ihr Gesicht verhärtete sich. »Das war etwas anderes.« In ihrer Stimme lag nun Entschlossenheit, als hätten wir den Punkt überschritten, ab dem es kein Zurück mehr gab. »Du hattest keine Ahnung, auf was du dich einlässt, als du den Token genommen hast. Und ich hatte meine eigenen Motive, dir zu helfen, das weißt du. Doch das hier ist nicht dein Kampf. Wir hatten eine wunderbare Zeit, Nick, und ich werde dich jede Sekunde vermissen. Aber die nächsten Schritte meines Weges muss ich allein gehen.«
»Ernsthaft?«, rief ich. »Du machst Schluss mit mir?«
Sie rang um Worte. »Du hast … etwas Besseres verdient als eine … Fanatikerin wie mich.«
Vor Wut und Enttäuschung ballte ich die Fäuste.
»Du hast recht«, stieß ich hervor. »Du bist wirklich eine Fanatikerin. Diese verlogene Stadt hat dir den Verstand vernebelt. Vielleicht ist es an der Zeit für mich, wieder nach Berlin zurückzukehren, bevor mir dasselbe passiert. In die wirkliche Welt.«
Ohne ein weiteres Wort drehte ich mich um und stapfte zu dem Wagen zurück, der auf uns wartete. Ich bestellte ein zweites Fahrzeug, das Adina abholen sollte, fuhr zurück in ihre Wohnung, packte die wenigen Dinge ein, die dort mir gehörten, und verschwand aus ihrem Leben. Sie hatte den Anstand, zu warten, bis ich verschwunden war, bevor sie in ihre Wohnung zurückkehrte.
4.
Ein paar Stunden später lag ich grübelnd auf dem Bett des Hotelzimmers, das mein Dschinn für mich besorgt hatte. Es befand sich nicht weit entfernt vom Aladdin’s Cave, in dem ich meine ersten Nächte in Neopolis verbracht hatte.
Aus heiterem Himmel war das neue Leben, das ich gerade erst begonnen hatte, in sich zusammengebrochen. Nicht, dass ich mich in der Stadt aus Licht jemals wirklich zu Hause gefühlt hatte – auch nach vier Monaten hatte ich mich noch nicht richtig an die allgegenwärtigen Illusionen, an die permanente Überwachung und die aufgesetzte Fröhlichkeit gewöhnt, die kaum die düstere Realität der Elendsviertel im Norden der Stadt übertünchen konnte. Doch ich hatte wirklich geglaubt, mit Adina eine Zukunft zu haben. An Heirat oder gar Kinder hatte ich nicht gedacht – so ein konventionelles Familienbild passte weder zu ihr noch zu mir. Aber ich hatte noch nie zuvor eine Beziehung gehabt, die so tief gegangen war. Und noch nie hatte ich solchen Trennungsschmerz gefühlt, wie ich ihn jetzt empfand.
Ich war wohl hoffnungslos naiv gewesen. Die Vernissage hatte bewiesen, dass Adina zumindest hier in Neopolis ein Superstar war. Mangels jeglichen künstlerischen Sachverstands war mir das bisher gar nicht richtig klar gewesen. Sogar der verdammte König war ihr zu Ehren erschienen! Naiv, wie ich war, hatte ich geglaubt, jemand wie sie könnte mit mir glücklich werden. Dabei war ich im Vergleich zu ihr bloß ein Niemand, auch wenn ich zufällig über den Token gestolpert war und für kurze Zeit über nahezu unbegrenzte Macht verfügt hatte. Wahrscheinlich hätte unsere Beziehung ohnehin keine Zukunft gehabt. Vielleicht war es besser, dass es vorbei war, ehe ich hier Wurzeln geschlagen hatte.
Doch es tat einfach zu weh. Und zu den Schmerzen, der Frustration und Enttäuschung kam tiefe Sorge. Adina war drauf und dran, ihr Leben zu zerstören. Was auch immer sie vorhatte, Aron Keaton war sie nicht gewachsen. Mir kam der Gedanke, dass sie womöglich dabei war, in eine Falle zu tappen. Wer auch immer ihr half, war vielleicht in Wahrheit ein Agent des Milliardärs. So etwas würde zu ihm passen.
Je länger ich über diese Möglichkeit nachdachte, desto stärker wurde das Gefühl, dass Adina einen verhängnisvollen Fehler beging. Ich hatte zwar keine Ahnung, was sie plante. Doch dieser Ausdruck in ihren Augen, als sie mir gesagt hatte, diesmal werde alles anders sein, beunruhigte mich zutiefst. Sie hatte sich sicher gefühlt, etwas bewirken zu können. Zu sicher.
Ich musste sie warnen! Doch wie? Anrufen konnte ich sie nicht, ohne dass die Sicherheitsbehörde der Stadt und vermutlich auch Keatons Leute mithörten. Sollte ich noch einmal zu ihr gehen? Aber sie würde ohnehin nicht auf mich hören. Wahrscheinlich würde sie glauben, ich versuchte bloß, sie von ihrem Vorhaben abzubringen, um unsere Beziehung zu retten.
Frustriert schüttelte ich den Kopf. Es hatte keinen Sinn. Es war vorbei. Ich konnte sie nicht beschützen, weder vor Keaton noch vor sich selbst. Je eher ich mich damit abfand, desto besser.
Am liebsten hätte ich der Stadt sofort den Rücken gekehrt und meinen Dschinn beauftragt, mir den nächsten Flug nach Berlin zu buchen. Doch so einfach war das natürlich nicht. Immerhin hatte ich einen Job. Auch wenn ich meinem Chef nicht allzu viele Sympathien entgegenbrachte, konnte ich nicht einfach so verschwinden. Außerdem hatte ich in Berlin weder Arbeit noch Unterkunft. Ich würde einiges regeln müssen, bevor ich endgültig von hier verschwinden konnte.
Das Hotelzimmer kam mir trotz der Klimaanlage eng und stickig vor, und ich beschloss, einen Spaziergang zu machen. Also wanderte ich über die Strandpromenade, auf der an diesem frühen Abend zahllose Menschen flanierten, und versuchte, meinen Kopf freizubekommen. Doch das gelang mir nicht. Am liebsten hätte ich laut geschrien und um mich geschlagen. Stattdessen senkte ich den Blick, um das selige Grinsen der Touristen mit ihren Holobrillen nicht ansehen zu müssen, und stapfte ziellos weiter. So erreichte ich, ohne mir dessen richtig bewusst zu sein, die Ausläufer der Innenstadt. Statt Hotels säumten nun Bürogebäude die Promenade, in deren unteren Etagen Restaurants, Bars und Geschäfte lockten. Das Gedränge der Freizeitsüchtigen wurde dichter, laute Musik drang mir in die Ohren, Gelächter und Applaus waren zu hören.
Ich hob den Kopf und betrachtete die Fassaden. Meine Holobrille hatte ich im Hotel gelassen, aber auch ohne die virtuellen Projektionen war ich von knallbunten Lichtern umgeben. Ein riesiges 2-D-Display an einem der Gebäude zeigte eine glücklich lachende Familie, die auf dem Rücken eines Drachen über ein Märchenland flog – Werbung für Keatons Freizeitpark. Die Animation löste ein solches Gefühl der Abscheu in mir aus, dass ich spontan beschloss, in den Norden der Stadt zu gehen und mich in einer der illegalen Bars zu betrinken. Als ich das das letzte Mal getan hatte, war ich am nächsten Morgen mit einem schweren Schädel und einer mysteriösen Goldmünze in der Tasche aufgewacht. Diesmal würden es wohl nur Kopfschmerzen werden. Hauptsache, ich konnte die Illusionen, die mir die Stadt vorgaukelte, sowie diejenigen, die ich in Bezug auf Adina gehabt hatte, für ein paar Stunden vergessen.
Endlich ein Ziel vor Augen, beschleunigte ich meine Schritte und wanderte durch die mir inzwischen vertrauten Straßenschluchten. Ich kam an dem Gebäude vorbei, in dem im zwanzigsten Stock das Büro von Bowman & Hall untergebracht war. Dort musste ich übermorgen, am Sonntag, wieder zum Dienst antreten. Kurz darauf passierte ich Keatons märchenhaft dekoriertes und knallbunt animiertes Hauptquartier und überquerte den Platz des Propheten mit der großen Moschee, in der ich damals dem Mal’ak begegnet war, jenem mysteriösen Lichtwesen, das in der verqueren Logik dieser Stadt das Gegenstück zu dem niederträchtigen Marid war.
Schließlich erreichte ich die Straße Richtung Norden, die wie eine Ausfallstraße aussah, jedoch, wie ich längst wusste, in einer Sackgasse endete. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne färbten die Wolken über dem Meer flammend rot. Bei all ihrer künstlichen Pracht schaffte es die Stadt doch nicht, dieses Naturschauspiel zu übertreffen.
Als ich mich gerade abwenden und den Weg nach Norden fortsetzen wollte, sah ich plötzlich an der Spitze eines der Wolkenkratzer, deren Silhouetten sich vor dem prächtigen Himmel abzeichneten, etwas aufblitzen. Eine Sekunde später hörte ich einen dumpfen Knall. Rauch stieg von dem Gebäude auf. Schreie waren um mich herum zu hören. Sicher wurden sie von Menschen ausgestoßen, die ebenso geschockt waren wie ich.
Jemand riss mich am Arm zur Seite. Ich stolperte, fiel schmerzhaft auf die Knie. Ein zweiter Knall in unmittelbarer Nähe, noch mehr Schreie.
Geschockt rappelte ich mich auf und blickte mich um. Nur einen Meter neben mir war ein Fahrzeug gegen eine Hauswand gekracht. Ein Alarmsignal ertönte von dort. Jemand versuchte, sich aus dem Wrack zu befreien, doch die Tür hatte sich verklemmt.
Ende der Leseprobe