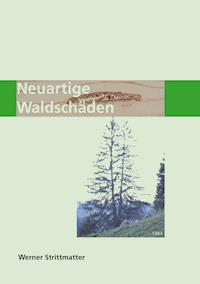
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Neuartige Waldschäden. Wie verrückt,1984 am sauren Regen als Ursache des Waldsterbens zu zweifeln. Rauchende Industrieschornsteine, Schwefelemissionen und kranke, sterbende Bäume, dieser Zusammenhang lag so nahe. Doch, ließen sich daraus die massiven und akuten Schadensbilder in den ansonsten mit einem engen Netz von Luftkurorten überzogenen Regionen des Südschwarzwaldes vollumfänglich erklären? Basierend auf der akribischen Dokumentation von Fakten zu Klima, Wuchsorten und Pflanzenpathologien (insbesondere der Fichte) des Jahres 1984 und zur Weiterentwicklung der betroffenen Baumbestände bis 1989 fasst Werner Strittmatter 2016 im Rückblick seine eigenen Beobachtungen zusammen und zieht seine Schlüsse daraus. Im hohen Alter von über 90 Jahren 2016 noch einmal einen Rückblick auf die Neuartigen Waldschäden der 1980er Jahre zu wagen, hatte für den Autor zwei Beweggründe: Einerseits mag es hilfreich sein, die damaligen Schadensbilder in Erinnerung zu behalten, falls entsprechende Schadensbilder wieder einmal auftreten. Andererseits war das zentrale Anliegen ein primär forstliches: Wuchsorte und Wuchstypen, insbesondere der Fichte, sollen zukünftig gezielter gewählt werden können. Gemeinsam mit den Bildern im Anhang des Buches, die die Untersuchungsflächen von 1984 im Jahre 2016 zeigen, umfasst das Buch 30 Jahre fotografischer Dokumentation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 22
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Geleit
Was wäre die Wissenschaft ohne die Empirie, das genaue Hinschauen, die unvoreingenommene Beobachtung?
Aber was, wenn das aus dieser Beobachtung zu Schliessende dem Denkmuster der Zeit der Beobachtung widerspricht? Blickt man in die Geschichte zurück, drängt sich der Gedanke auf, dass die Bedeutsamkeit einer neuen Erkenntnis stark negativ mit dem zeitgleichen menschlichen Denkmuster korreliert ist: Wie lange war es un“denk“bar, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel ist, selbst noch zu einer Zeit, da man bereits mit Booten mit hohen Segelmasten schiffte und jedem Küstenbewohner hätte auffallen können, dass (aufgrund der Erdkrümmung) immer als erstes die Mastspitze eines Bootes am Horizont zum Vorschein kam.
Wie verrückt 1984 am sauren Regen als Ursache des Waldsterbens zu zweifeln. Rauchende Industrieschornsteine, Schwefelemissionen und kranke, sterbende Bäume – dieser Zusammenhang lag so nahe. Doch, liessen sich daraus die massiven und akuten Schadensbilder vollumfänglich erklären? Konnte die im Frühjahr 1984 auftretende nahezu komplett-Entnadelung zuvor unauffällig normal-benadelter Fichten Symptom einer langsam voranschleichenden Vergiftung sein? Und das ausgerechnet am deutlichsten in den Höhenlagen des Südschwarzwaldes, einer Region, die für Ihre grosse Luftreinheit weit über Deutschland hinaus bekannt und mit einem engmaschigen Netz an Luftkurorten überzogen war?
Aber – wäre es zum damaligen Zeitpunkt richtig gewesen die Saure-Regen-Theorie anzuzweifeln, die, aufgrund der folgenden politischen Weichenstellungen, für Mensch und Natur eine dramatische Verbesserung der Luftqualität nach sich zog? Und dennoch, wäre es für zukünftige forstwirtschaftliche Entscheidungen nicht auch unverantwortbar gewesen die Erkenntnisse unveröffentlicht zu lassen, gaben sie doch allen Anlass zur Hoffnung mit ihnen zukünftig mögliche Wuchsorte und Wuchstypen der Fichte präziser wählen zu können?
Mein lieber Schwiegervater blickte 1984 auf eine über 30jährige Vergangenheit als Diplomforstwirt zurück. Das Studium der Forstwissenschaften hatte er 1951 in Freiburg im Breisgau abgeschlossen. In den beruflichen Anfangsjahren konnte er Erfahrungen in verschiedenen Forstämtern in der südlichen Hälfte Deutschlands sammeln. Anschliessend war er 24 Jahre selbst Forstamtsleiter (1964 - 1978 in Schopfheim und 1978 - 1988 in Kirchzarten). Seine forstwirtschaftlichen Entscheidungen fussten immer auf der aktuellen Faktenlage, die er akribisch dokumentierte und ausgiebig durchdachte. Als Ergebnis kam dabei selten der Mainstream heraus. Er favorisierte bereits in den sechziger Jahren die Douglasie als wertvolle Baumart, propagierte weite Pflanzabstände für Neuaufforstungen, begründete 1972 die Forstbetriebsgemeinschaft kleines Wiesental, die heute über 1‘800 überwiegend Kleinprivatwald-Besitzern zu Gute kommt und begrünte unorthodox und nachhaltig erfolgreich das Hornbergbecken, das seither nur noch dem geübten Betrachter als besonders grader Bergrücken des Südschwarzwalds auffällt. Und 1984? Er dokumentierte akribisch und durchdachte ausgiebig. Er handelte faktisch, ganz im Gegensatz zum „postfaktischen Zeitalter“, das im Jahr 2016 ausgerufen wurde. Seine Schlüsse seien an dieser Stelle noch nicht verraten.





























