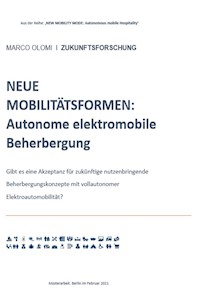
15,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Aus der Reihe: ‚NEW MOBILITY MODE: Autonomous mobile Hospitality‘
- Sprache: Deutsch
'NEUE MOBILITÄTSFORMEN: Autonome elektromobile Beherbergung' Der Blick auf den Tourismus und insbesondere auf die Reise- und Hotelbranche machen deutlich, dass sowohl eine Auseinandersetzung mit als auch eine ganzheitliche Betrachtung der autonomen elektromobilen Beherbergung noch kaum Beachtung findet. Für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Thema entstehen auch erst allmählich robuste empirische Beiträge, die die Auswirkungen der autonomen Elektromobilität auf die Beherbergungswirtschaft und in Folge auf die Gesellschaft zusammenhängend betrachten. Dies rückt die Akzeptanz in den Vordergrund, d.h. ob sich die Nutzer*innen und die korporativen Akteure vorstellen können, Konzepte autonomer elektromobiler Beherbergung zu akzeptieren und damit eine völlig neue Beherbergungstypologie zu etablieren. Die zurzeit verfügbaren Studien zur Akzeptanz beschäftigen sich hauptsächlich mit den Erwartungen an die autonome Mobilität. Dagegen ist die Akzeptanzfrage bezüglich einer autonomen elektromobilen Beherbergung, welche sich nicht nur auf eine Unterkunft zum Aufenthalt oder Übernachten beschränkt, sondern als Synonym für eine Bandbreite von Möglichkeiten steht, noch völlig offen und nicht geklärt. Somit soll diese Studie ein Beitrag dazu leisten, den Diskurs zur mobilen autonomen Beherbergung anzuregen. Es ist zu diskutieren, ob und in wieweit dieses Konzept an Bedeutung gewinnt, ob und welche Fundamente für einen Einsatz in der Gesellschaft und in der Wirtschaft gelegt werden müssten oder wie bestehende Strukturen sich verändern, wenn sich das Verhalten des Fortbewegens im Allgemeinen und in der Beherbergung im Besonderen verändert. Ziel war es daher, mit der Zukunftsforschungsmethode Real Time Delphi die Antwort auf die Frage ableiten zu können, ob es zunächst unter Expert*innen eine Akzeptanz/Nicht-Akzeptanz für zukünftige nutzenbringende Beherbergungskonzepte mit vollautonomer Elektromobilität gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Aus der Reihe: ‚NEW MOBILITY MODE: Autonomous mobile Hospitality‘
Marco Olomi
NEUEMOBILITÄTSFORMEN:AutonomeelektromobileBeherbergung
Gibt es eine Akzeptanz für zukünftige nutzenbringende Beherbergungskonzepte mit vollautonomer Elektroautomobilität?
Masterarbeit zur Erlangung des Grades eines Master of Arts (M.A.) im weiterbildenden Masterstudiengang Zukunftsforschung am Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin.
„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“ (Perikles um 500 v. Chr.)
Liebe Familie,
liebe Martina und Barbara,
lieber Gerrit, Nils, Martin und Stefan,
liebe Kerstin Cuhls, lieber Reinhold Popp,
liebes Institut Futur,
DANKE.
Für meine Tochter Carolina.
Band 1. 1. Auflage 2021
© 2021 Marco Olomi
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-26783-1
Hardcover:
978-3-347-26784-8
e-Book:
978-3-347-26785-5
Zitationsvorschlag:
Olomi, Marco, 2021: Neue Mobilitätsformen. Autonome elektromobile Beherber-gung. Gibt es eine Akzeptanz für zukünftige nutzenbringende Beherbergungskonzepte mit vollautonomer Elektroautomobilität? Aus der Reihe ‚New mobility mode: Autonomous mobile Hospitality‘. Verlag
Kontakt zum Autor: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
I. Abbildungsverzeichnis
II. Abkürzungsverzeichnis
Zusammenfassung
Abstract
1 Einleitung
1.1 Erkenntnisinteresse und Problemstellung
1.2 Ziel und Relevanz der Arbeit
1.3 Forschungsdesign zur Beantwortung der Fragestellung
1.4 Wissenschaftliche Einordnung der Arbeit
1.5 Angewandte Forschungsdesigns
1.5.1 Real Time Delphi mit Likert-Ordinalskala
1.5.2 Akzeptanzmodelle nach Rogers und Kollmann
2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Der Begriff der Akzeptanz als Grundlage für die Auswertung
2.2 Autonome Mobilität
2.3 Mobile Beherbergung
2.4 Politik und Rechtsgrundlagen der mobilen Beherbergung
2.5 Szenarien: Definition und Analysewerkzeug innerhalb des Real Time Delphi
2.6 Aktuelle Entwicklungen in der autonomen elektromobilen Beherbergung
2.7 Autonome mobile Beherbergungsvarianten der Zukunft
2.7.1 Mobiles Hotel
2.7.2 Mobiler Wohnraum
2.7.3 Mobile Dienstleistungen
2.7.4 Einsatz mobiler Beherbergung bei Havarien
3. Operationeller Teil
3.1 Ermittlung der Thesen und Szenarien für das Real Time Delphi
3.1.1 Ausarbeitung der Thesen und Szenarien für das Real Time Delphi
3.1.2 Überprüfung der Thesen und Szenarien für das Real Time Delphi
3.1.3 Zusammenfassung und Zwischenfazit
3.2 Forschungsmethodik Real Time Delphi
3.2.1 Teilnehmer*innen des Real Time Delphi
3.2.2 Aufbau des Real Time Delphi
3.2.3 Akzeptanzauswertung der Kommentare nach Rogers und Kollmann
3.3 Ergebnisse und Auswertung des Real Time Delphi
3.3.1 Ergebnisse und Auswertung der einzelnen Ordinalskalen
3.3.2 Zusammenfassung der Ordinalskalenauswertung
3.3.3 Diskussion zur Auswertung der Ordinalskalen
3.3.4 Auswertung der einzelnen Kommentare nach Rogers und Kollmann
3.3.5 Zusammenfassung der Einzelkommentare
4. Diskussion
5. Zusammenführung und Fazit
6. Literaturverzeichnis
I. Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Innovationsentscheidungsmodell nach Rogers
Abb. 2: Begriffsrecherche in ausgewählten Datenbanken nach Stichwort Akzeptanz/Acceptance
Abb. 3: Automatisierungsgrade des automatisierten Fahrens
Abb. 4: Dornseiff Bedeutungsgruppen ‚Beherbergen‘
Abb. 5: Marktdurchdringung Autonomous mobile Hospitality am Beispiel Übernachtungsbeherbergung
Abb. 6: Anwendungsbeispiele für autonome elektromobile Beherbergung
Abb. 7: Beispiel induktive Kategorienbildung
Abb. 8: Beispiel Prüfung Wortrelevanz mit Pooq.org
Abb. 9: Thesen- Szenario Entwicklung am Beispiel Literatur und Interview
Abb. 10: Erhebungs- und Auswertungsprozess des Real Time Delphi
Abb. 11: Expertengrid nach Expertise Wirkungs- und Interessenkreis
Abb. 12: Geschlecht und Alter der Expert*innen
Abb. 13: Anschreiben Deutsch im Real Time Delphi
Abb. 14: Willkommensseite des Real Time Delphi
Abb. 15: Aufbau der Datenerhebungsseiten im Real Time Delphi
Abb. 16: Dynamisches Akzeptanzmodell nach Kollmann
Abb. 17: Beispiel Kodierleitfaden deduktive Kategorienbildung zur Kommentarauswertung
Abb. 18: Beispiel Transformierung des Kodierleitfadens zur Kommentarauswertung in Excel
Abb. 19: Eintrittswahrscheinlichkeit
Abb. 20: Bewertung der Gestaltung und Eigenschaften
Abb. 21: Wahrscheinlichkeit der Substituierung bestehender Beherbergungsvarianten
Abb. 22: Eintrittszeitpunkt der Substituierung bestehender Beherbergungsvarianten
Abb. 23: Einsatzmöglichkeiten mobiler Micro Hostels
Abb. 24: Etablierung autonomer elektrischer Hospitality-Einheiten
Abb. 25: Entstehung neuer Arbeitsplätze durch Microhostels
Abb. 26: Mögliche Erweiterung der Hospitality-Einheiten
Abb. 27: Technische Gestaltungsvariablen der Hospitality-Einheiten
Abb. 28: Substituierung des urbanen Individualverkehrs
Abb. 29: Diversifikationsfähigkeit bzw. Skalierbarkeit
Abb. 30: Effektivität im Berufsverkehr
Abb. 31: Vernetzte Nutzerkommunikation
Abb. 32: Datenverfügbarkeit
Abb. 33: Substituierung des Linienbusverkehrs
Abb. 34: Substitution des urbanen Warentransports
Abb. 35: Ergänzung zu urbanen Mobilitätskonzepten
Abb. 36: Autonome mobile Hospitality-Einheiten als Erste-Hilfe-Ladestationen
Abb. 37: Ökologischer Beitrag der Hospitality-Einheiten zur Städteplanung
Abb. 38: Arbeitsplätze entstehen
Abb. 39: Auswirkungen auf die Autoindustrie
Abb. 40: Branchenspezifische Auswirkungen
Abb. 41: Akzeptanzausprägung der abgegebenen Bewertungen durch die Expert*innen
Abb. 42: Bewertung der Gestaltung und Eigenschaften
Abb. 43: Eintrittswahrscheinlichkeit
Abb. 44: Wahrscheinlichkeit der Substituierung bestehender Beherbergungsvarianten
Abb. 45: ZEIT. Eintrittszeitpunkt der Substituierung bestehender Beherbergungsvarianten
Abb. 46: Mobilität als Dienstleistung Vor- und Nachteile
Abb. 47: Einsatzmöglichkeiten mobiler Micro Hostels
Abb. 48: Etablierung autonomer elektrischer Hospitality-Einheiten
Abb. 49: Entstehung neuer Arbeitsplätze durch Microhostels
Abb. 50: Mögliche Erweiterung der Hospitality-Einheiten
Abb. 51: Technische Gestaltungsvariablen der Hospitality-Einheiten
Abb. 52: Substituierung des urbanen Individualverkehrs
Abb. 53: Diversifikationsfähigkeit bzw. Skalierbarkeit
Abb. 54: Effektivität im Berufsverkehr
Abb. 55: Vernetzte Nutzerkommunikation
Abb. 56: Datenverfügbarkeit
Abb. 57: Substituierung des Linienbusverkehrs
Abb. 58: Substitution des urbanen Warentransports
Abb. 59: Ergänzung zu urbanen Mobilitätskonzepten
Abb. 60: Autonome mobile Hospitality-Einheiten als Erste-Hilfe-Ladestationen
Abb. 61: Ökologischer Beitrag der Hospitality-Einheiten zur Städteplanung
Abb. 62: Arbeitsplätze entstehen
Abb. 63: Auswirkungen auf die Autoindustrie
Abb. 64: Branchenspezifische Auswirkungen
Cover: Pictogramme: https://www.flaticon.com/search?word=rescue; zuletzt 21.01.2021
Zusammenfassung
Mit der Zukunftsforschungsmethode Real Time Delphi und den Auswertungs- und Akzeptanzmodellen zur Messung der Einstellungen nach Lickert sowie zur Erfassung der kognitiven und affektiven Akzeptanzebenen nach Phasen der Innovationsentscheidungs- bzw. Akzeptanzmodellen nach Rogers und Kollmann wurde versucht, die Antwort auf die Frage ableiten zu können, ob es unter Expert*innen eine Akzeptanz/Nicht-Akzeptanz für zukünftige nutzenbringende Beherbergungskonzepte mit vollautonomer Elektromobilität gibt. Die Aggregation der Ergebnisse zeigen eine grundlegende Akzeptanz und damit eine positive Ausprägung für den untersuchten Umfang an sich. Es kann festgestellt werden, dass eine Annäherung an die Adoptionsakzeptanz vorliegt. Die frühzeitige Erfolgsmessung bzw. Prognose hat gezeigt, dass durchweg ‚Akzeptierer‘ aufgrund der aggregierten Gesamtaussagen zur Einstellungsakzeptanz für das Konzept vorliegen. Somit wird das Attribut der uneingeschränkten Grundakzeptanz erfüllt. Auch bei der Vorstellung, die Konzepte in die vorhandenen Werte- und Zielsysteme einzuordnen, gab es zwar Divergenzen, dennoch bestand überwiegend Einigkeit darin, dass Gesamtkonzept mindestens als Nischenkonzept zu adoptieren. In Hinblick auf die technologische Akzeptanz des autonomen elektrischen Fahrens und Beherbergens als Zukunftsbilder gab es keine Vorbehalte. Daher kann davon ausgegangen werden, dass das Verständnis für die Szenarien und Thesen dieser noch nicht existenten Innovation vorhanden war. Unstrittig ist, dass unabhängig von der Grundakzeptanz weitere konzeptionelle Konkretisierungen und Anpassungen notwendig sind als auch weiterer Forschungsbedarf besteht. Darüber hinaus sind noch viele Fragen offen, die es unter Einbezug der Handlungs- und Nutzungsphasen zu klären gibt. So ist etwa zu definieren, welcher Konzeptansatz konkret verfolgt werden soll, um auch im Praxistest sowie im gesellschaftlichen Kontext bestehen zu können. Es ist in jedem Fall festzustellen, dass eine Akzeptanz für eine autonome elektrifizierte Beherbergung über die eigene individuelle Motivation hinaus gehen muss und die Gesellschaft mit einzubeziehen ist. Technologisch und politisch sind etwa die flächendeckende Digitalisierung und die Gewährleistung der Daten- und Verkehrssicherheit wesentliche Faktoren für eine breitere Akzeptanz. Das bedeutet, dass alle Akteure im Gleichklang die zukünftige Nutzung der Straßeninfrastruktur als Teilsystem zukünftiger gesellschaftlicher Desiderate sozialer und liberaler betrachten müssen und diese eben nicht nur etwa dem klassischen Verkehr und deren Regeln oder wirtschaftlichen Interessen vorbehalten sind.
Abstract
With the future research method Real Time Delphi and the evaluation model for measuring attitudes as well as the adoption theories for recording the cognitive and affective levels of acceptance, an attempt was made to derive the answer to the question of whether there is acceptance/non-acceptance among experts for future beneficial accommodation concepts with fully autonomous electric mobility. The results from the scenarios and theses show a basic acceptance and thus a positive characteristic for the investigated scope as such. It can be stated that there is an approximation to adoption acceptance. The early measurement of success or prognosis has shown that there are ‘acceptors’ for the concept throughout due to the aggregated overall statements on the acceptance of the concept. Thus, the attribute of unrestricted basic acceptance is fulfilled. Even with the idea of classifying the concepts into the existing value and target systems, there were divergences, but there was predominantly agreement that the overall concept should be adopted at least as a niche concept. Technologically, there were no reservations regarding the acceptance of autonomous electric driving and accommodation as a vision of the future. Therefore, it can be assumed that the understanding for the scenarios and theses of this non-existent innovation was there. It is also clear, however, that regardless of the basic acceptance, further conceptual concretisation and adjustments are necessary and that there is a need for further research. In addition, many questions are still open that need to be clarified with regard to the phases of action- and use. For example, it is necessary to define which conceptual approach is to be pursued in concrete terms in order to be able to stand up to practical tests and social contexts. In any case, it must be noted that acceptance of autonomous electrified accommodation must go beyond the individual's own motivation and include society. In technological and political terms, for example, nationwide digitization and the guarantee of data and traffic security are key factors for broader acceptance. This means that all players must view the future use of the road infrastructure as a subsystem of future social desiderata in a more social and liberal way and not just as reserved for conventional traffic or economic interests.
1. Einleitung
1.1 Erkenntnisinteresse und Problemstellung
„Gibt es eine Akzeptanz für zukünftige nutzenbringende Beherbergungskonzepte mit vollautonomer Elektroautomobilität?“
Diese Generalfrage ist eng verknüpft mit der allgemeinen infrastrukturellen und gesellschaftlichen Entwicklung im Rahmen des globalen digitalen Wandels, wie er derzeit zu beobachten ist. Die weitreichende Bedeutung der Elektrifizierung und Autonomisierung im Straßenverkehr ist angesichts der stark wachsenden Städte und Agglomerationen, aus sicherheitsrelevanten Verkehrsaspekten, aufgrund der zunehmenden Internationalisierung wie auch der verbesserten individuellen Mobilität unbestritten. Dabei entwickelt sich die Mobilität von einem reinen Transportmedium hin zu einer Dienstleistungsinstanz. Kurz: Die Nutzer*innen folgen nicht mehr dem Produkt, sondern das Produkt folgt bzw. passt sich den Bedürfnissen der Nutzer*innen an. Somit rückt die leistungsbestimmende Mobilität immer mehr in den Vordergrund. Im Zuge dieser Digitalisierung, Elektrifizierung und Autonomisierung der Mobilität entwickeln sich neue Wirtschaftsbereiche sowie neue Produktions-, Markt- und Wettbewerbsstrukturen. Diese machen es notwendig, auch Beherbergungsdienstleistungen für die Nutzer*innen neu zu überdenken, disruptive Sprünge zu erkennen und eine leistungsbestimmte mobile sowie innovative Wertschöpfung zu entwickeln. Diese Vervielfältigung der Optionen (vgl. Gross, P., 1994) umfasst mobile hybride Aufenthaltsorte und -formen wie klassische Übernachtungs- und Aufenthaltsdienstleistungen sowie Arbeits-, Konferenz- und Meetingplattformen als potenziell neue Beherbergungstypologie. Trotz dieser Diversifizierungsnotwendigkeit diskutieren die korporativen Akteure (vgl. Scharpf, W. F. 2000, S. 100-102) vorwiegend den technologischen Fortschritt und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf ihr Kerngeschäft und weniger die gesellschaftlichen Implikationen und Potenziale zukünftiger mobiler Beherbergung. Auch wenn die Nutzung vollautonomisierter Fahrzeuge im urbanen Straßenverkehr noch ein Zukunftsbild ist, könnte der technologische Fortschritt dazu führen, dass sich das Nutzerverhalten und damit das Verhalten zur Beherbergung an sich in der Gesellschaft grundlegend verändert.
1.2 Ziel und Relevanz der Arbeit
Somit stellt sich folgende Frage: Gibt es eine Akzeptanz für zukünftige nutzenbringende Beherbergungskonzepte mit vollautonomer Elektroautomobilität? Diese Frage gilt es mit dieser Masterarbeit für Deutschland zu klären. Wobei diese Fragestellung durchaus weltweite Betrachtung finden sollte, was jedoch nicht Ziel dieser Masterarbeit ist. Tourismusverbände und insbesondere die Reise- und Hotelbranche machen deutlich, dass sowohl eine Auseinandersetzung mit als auch eine ganzheitliche Betrachtung der autonomen elektromobilen Beherbergung noch kaum Beachtung findet. (vgl. Die Zukunft des Tourismus 2030, Szenarien für den Tourismus in Bayern 2040) Für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Thema entstehen auch erst allmählich robuste empirisch Beiträge, die die Auswirkungen der autonomen Elektromobilität auf die Beherbergungswirtschaft und in Folge auf die Gesellschaft zusammenhängend betrachten (vgl. Fraunhofer IAO: FutureHotel Building 2052; Trendstudie 2b AHEAD: Die Zukunft der Economy-Hotellerie; German Convention Bureau: Future Meeting Space; Centre for Transport and Logistics (CTL): Automated Vehicles and the Rethinking of Mobility and Cities). Dies rückt die ‚Akzeptanz‘ in den Vordergrund, d.h. ob sich die Nutzer*innen und die korporativen Akteure (vgl. Scharpf, W. F. 2000, S. 100-102) vorstellen können, Szenarien und Visionen autonomer elektromobiler Beherbergung zu akzeptieren und damit eine völlig neue Beherbergungstypologie zu etablieren. Die zurzeit verfügbaren Studien zur Akzeptanz durch Nutzer*innen beschäftigen sich hauptsächlich mit den Erwartungen an die autonome Mobilität (vgl. Kyriakidis, M. et al., 2015; Payre W. et al., 2014; Fraedrich, E., 2017; Continental AG, 2018). Dagegen ist die Akzeptanzfrage bezüglich einer autonomen elektromobilen Beherbergung, welche sich nicht nur auf eine Unterkunft zum Aufenthalt oder Übernachten beschränkt, sondern als Synonym für eine Bandbreite von Möglichkeiten steht (vgl. Unterkapitel 2.1.3), die sowohl bei Nutzer*innen als auch bei den korporativen Akteuren (vgl. Scharpf, W. F. 2000, S. 100-102) Anklang findet, noch völlig offen und nicht geklärt. Somit soll diese Masterarbeit ein Beitrag dazu leisten, den Diskurs zur mobilen autonomen Beherbergung unter Expert*innen anzuregen. Es ist zu diskutieren, ob und in wieweit die autonome elektromobile Beherbergung an Bedeutung gewinnt, ob und welche Fundamente für einen Einsatz in





























