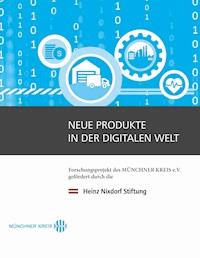
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der fortschreitende Trend zur Digitalisierung durchdringt alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche und beeinflusst dabei auch Aussehen, Funktionsweise und Nutzung von Produkten. Welche Veränderungen lassen sich hier erkennen? Welche Konsequenzen hat die Digitalisierung für Gestaltung und Funktionsweise von Produkten? Wie können Unternehmen auf die kommenden Herausforderungen reagieren? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des von der Heinz Nixdorf Stiftung geförderten und vom MÜNCHNER KREIS (www.muenchner-kreis.de) durchgeführten Forschungsprojektes "Neue Produkte in der digitalen Welt". Durch die Einbettung digitaler Komponenten in ursprünglich rein physische Objekte werden digitale Technologien zunehmend allgegenwärtig, denn auch Alltagsgegenstände wie z. B. Uhren, Kleidung, Brillen, Autos oder Kontaktlinsen werden immer mehr mit digitalen Elementen wie Mikrocontrollern, Sensoren und "intelligenter" Software ausgestattet. Angesichts dieser Entwicklungen verfolgte das Projekt das Ziel, einen systematischen Überblick über digitale Technologien und ihre Anwendung in neuen Produkten zu geben, charakterisierende Eigenschaften neuer Produkte zu identifizieren sowie industrieübergreifende Handlungsempfehlungen für den digitalen Wandel der Produktwelt abzuleiten. In diesem Buch werden die Forschungsergebnisse unter Verwendung zahlreicher Beispiele aus den Branchen Industrie, Logistik, Finanzdienstleistungen und Gesundheit erläutert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgeber
MÜNCHNER KREIS – Übernationale Vereinigung für Kommunikationsforschung e.V.
Tal 16, 80331 München
Telefon: +49 89 223238, Telefax: +49 89 225407
E-Mail: [email protected], www.muenchner-kreis.de
Autoren
Elisabeth Noll
Universität Regensburg
Kristina Zisler
Universität Regensburg
Dr. Rahild Neuburger
LMU München und MÜNCHNER KREIS e.V.
Prof. Dr. Jörg Eberspächer
TU München und MÜNCHNER KREIS e.V.
Prof. Dr. Michael Dowling
Universität Regensburg und MÜNCHNER KREIS e.V.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Ausgangssituation, Zielsetzung, Methodik und Aufbau
1.1 Digitalisierung verändert die Produktwelt
1.2 Methodik und Vorgehensweise
Konzeptionelle Grundlagen
2.1 Definition und Eigenschaften neuer Produkte in der digitalen Welt
2.2 Erweiterter Kundennutzen durch neue Produkte
Technologien und Datenfluss in digitalen Produkten
3.1 Datengewinnung und Datenverarbeitung
3.2 Elektronik, Vernetzung und digitaler Kundenzugang
3.3 Automatisierung, Kognitive und Autonome Systeme
3.4 Modellierungs- und Simulationsverfahren
Neuartige Innovationsprozesse und -strategien als Treiber
4.1 Open Innovation, Co-creation und Co-opetition
4.2 Agile Entwicklung und Design Thinking
4.3 Die Rolle von Plattformen und Ecosystems
Der Wandel der Produktwelt – Analyse und Fallbeispiele
5.1 Das Digitalisierungs-Framework von Produkten
5.2 Industrie
5.2.1 Produktanalyse
5.2.2 Fallbeispiel: Die Digitalisierung in einem großen deutschen Industrieunternehmen
5.3 Logistik
5.3.1 Produktanalyse
5.3.2 Fallbeispiel: Hamburg Port Authority
5.4 Finanzdienstleistungen
5.4.1 Produktanalyse
5.4.2 Fallbeispiel: Gothaer Versicherung
5.5 Gesundheit
5.5.1 Produktanalyse
5.5.2 Fallbeispiel: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
5.6 Übergreifende Analyse
Der Wandel in den Branchen
6.1 Neue Wettbewerber
6.2 Neue Innovationsaktivitäten
6.3 Sensorik und Data Analytics als Basis für erweiterten Kundennutzen
Handlungsempfehlungen
Fazit
Glossar
Literaturverzeichnis
Vorwort
Der fortschreitende Trend zur Digitalisierung durchdringt unser privates sowie berufliches Umfeld und beeinflusst dabei auch Aussehen, Funktionsweise und Nutzung von Produkten. Neue Wettbewerber entstehen, branchenfremde Unternehmen treten in für sie neue Märkte ein und üben Druck auf etablierte Unternehmen aus, deren Innovationsfähigkeit auf dem Prüfstand steht. Welche Veränderungen lassen sich im Hinblick auf neue Produkte erkennen? Welche Konsequenzen hat die Digitalisierung für Gestaltung und Funktionsweise von Produkten? Was bedeutet dies für den Industriestandort Deutschland? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des von der Heinz Nixdorf Stiftung geförderten und vom MÜNCHNER KREIS durchgeführten Forschungsprojektes „Neue Produkte in der digitalen Welt“. Dabei lag der Fokus bewusst nicht – wie häufig – auf der Gestaltung und Digitalisierung von Prozessen, sondern auf dem Produkt selbst.
Das Projekt setzt bei einer alten Tradition an: Bereits in den 1950er-Jahren entwickelte der Visionär und Computerpionier Heinz Nixdorf den Elektronenmultiplizierer – eines der ersten Beispiele für ein neues Produkt in der digitalen Welt.
Unternehmen aller Branchen stehen in der digitalen Welt vor der Herausforderung, nicht nur ihre Prozesse zu digitalisieren, sondern auch mit Hilfe digitaler Technologien ihre existierenden Produkte weiterzuentwickeln oder auch neue Produkte zu entwickeln, um ihren Kunden letztlich einen größeren Nutzen zu bieten. Dazu kommen immer mehr Technologien – wie z. B. Virtual und Augmented Reality1 – zum Einsatz, und insbesondere Datenanalyseverfahren gewinnen an Bedeutung, um sensorgenerierte Daten gewinnbringend zu verwerten. Im Rahmen all dieser Entwicklungen verändern sich die Charakteristika neuer Produkte in der digitalen Welt und folglich auch die Anforderungen an Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Vor diesem Hintergrund zielte das Forschungsprojekt darauf ab, die Konsequenzen der zunehmenden Digitalisierung für die Produktwelt aufzuzeigen und – basierend u. a. auf Workshops, Experteninterviews und Fachkonferenzen – Handlungsempfehlungen für den erfolgreichen Wandel der Produktwelt abzuleiten.
Das Projektteam möchte sich insbesondere bei der Heinz Nixdorf Stiftung für die finanzielle Förderung der Forschungsaktivitäten bedanken. Unser besonderer Dank gilt Herrn Dr. Horst Nasko (stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Heinz Nixdorf Stiftung) für die kontinuierliche und konstruktive inhaltliche Begleitung und Unterstützung der Forschungsarbeiten.
Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot (LMU München), Prof. Dr. Nico Grove (IEM) sowie Philipp Ramin (Universität Regensburg und MÜNCHNER KREIS) danken wir für ihre wertvollen Beiträge. Ein besonderer Dank gilt auch den zahlreichen Expertinnen und Experten unserer Fachgespräche sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Workshops und Fachkonferenzen für spannende Gespräche, Denkanstöße und die Einblicke, die uns auf diese Weise in zahlreiche Unternehmen gewährt wurden.
Die Autoren
1 Kursiv markierte Begriffe und Textstellen werden im Glossar erläutert.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Die vier methodischen Bausteine des Forschungsprojektes
Abbildung 2: Aufbau des Projektberichts
Abbildung 3: Ein Kontinuum an Produkten und Technologien zwischen physischem und digitalem Extrem
Abbildung 4: Eigenschaften neuer Produkte in der digitalen Welt
Abbildung 5: Innovation findet an der Nahtstelle zwischen rein physischen und rein digitalen Produkten statt
Abbildung 6: Der erweiterte Kundennutzen durch neue Produkte in der digitalen Welt
Abbildung 7: Datenfluss in hybriden Produkten und Systemen
Abbildung 8: Funktionen und Technologien für Big Data
Abbildung 9: Ein Spektrum technologischer Plattformen
Abbildung 10: Die Transformations-Gleichung neuer Produkte in der digitalen Welt
Abbildung 11: Eigenschaften neuer Produkte in der digitalen Welt als Transformator
Abbildung 12: Transformation vom herkömmlichen zum intelligenten Reifen
Abbildung 13: Der intelligente Reifen Boostrac von Hankook mit intelligenter Profilstruktur
Abbildung 14: Transformation von der traditionellen Wartung zu Predictive Maintenance
Abbildung 15: Transformation von der traditionellen Produktionsstätte zur Digitalen Fabrik
Abbildung 16: Transformation vom analogen Handwerkzeug zum intelligenten Werkzeug
Abbildung 17: Transformation von der physischen zur virtuellen Materialplatzplanung
Abbildung 18: Planungswerkzeug für die virtuelle Produktion
Abbildung 19: Transformation von der klassischen Reparatur zur mobilen Augmented Reality-gestützten Fahrzeugreparatur
Abbildung 20: Mobile Augmented Reality im Einsatz bei der Fahrzeugreparatur
Abbildung 21: Transformation von der klassischen Cockpit-Anzeige zum intelligenten Head-Up-Display in der Frontscheibe
Abbildung 22: Transformation vom klassischen Automobil zum autonomen Fahrzeug
Abbildung 23: Der wahrnehmungsgesteuerte, mobile Logistikroboter TORU Cube von Magazino
Abbildung 24: Von der traditionellen Kommissionierung zum intelligenten Kommissionier-Roboter
Abbildung 25: Transformation vom traditionellen Kommissioniervorgang zu Vision Picking
Abbildung 26: Transformation vom traditionellen Completeness Check zum Augmented Reality-unterstützten Completeness Check
Abbildung 27: Transformation vom Klassischen Lieferwagen zum Smart Truck
Abbildung 28: DHL-Paketkopter – Lieferdrohne bei der Paketzustellung
Abbildung 29: Transformation von der klassischen Paketzustellung zur autonomen Lieferdrohne
Abbildung 30: Transformation von der Lieferung von B2C-Paketen durch ein Transportunternehmen zur Crowd-basierten Lieferung
Abbildung 31: Transformation von der klassischen Schutzweste und dem Schutzzaun zwischen Mensch und Maschine zur „Schutzweste von morgen“ und Mensch-Maschine-Kooperation
Abbildung 32: Funktionsweise der „Pay-as-you-live“-Versicherung
Abbildung 33: Transformation von der klassischen Krankenversicherung zu „Pay-as-you-live“
Abbildung 34: Funktionsweise der „Pay-as-you-drive“-Versicherung am Beispiel Telefónica
Abbildung 35: Transformation von der klassischen KFZ-Versicherung zu „Pay-as-you-drive“
Abbildung 36: Die Transformation vom traditionellen Bezahlvorgang zum Mobile Wallet
Abbildung 37: Transformation von der traditionellen Geldanlage zur automatisierten Geldanlage
Abbildung 38: Die Transformation vom traditionellen Bezahlvorgang zu Bitcoin
Abbildung 39: Transformation vom physischen zum digitalen Babyschnuller
Abbildung 40: Transformation von der elektrischen zur intelligenten Zahnbürste
Abbildung 41: Transformation von herkömmlichen Hörgeräten zu aktiven Hörprothesen
Abbildung 42: Transformation von der herkömmlichen zur intelligenten Prothetik
Abbildung 43: Drohnen im Einsatz zur Navigation blinder Sportler
Abbildung 44: Transformation von der herkömmlichen zur technologiegestützten Bewegungstherapie
Abbildung 45: Transformation von der Bereitstellung von Patientendaten zur Verfügbarkeit jeglicher relevanter Forschungsergebnisse und Informationen
Abbildung 46: Transformation von der herkömmlichen Blutzuckermessung zum Einsatz der intelligenten Kontaktlinse
Abbildung 47: Transformation von der Bildschirmanzeige zur Informationsbereitstellung per Datenbrille
Abbildung 48: Vier Hauptbereiche für den Einsatz digitaler Anwendungen in der Gesundheitsbranche
Abbildung 49: Erforderliche Schritte für den erfolgreichen digitalen Wandel in der Gesundheitsbranche
Abbildung 50: Übersicht der Handlungsempfehlungen zur Entwicklung neuer Produkte
Abkürzungsverzeichnis
3D . . . . . dreidimensional
B2B . . . . . Business-to-Business
B2C . . . . . Business-to-Consumer
HMI . . . Human-Machine-Interaction
KFZ . . . . . . . . Kraftfahrzeug
M2M . . . . . . . Machine-to-Machine
MMI . . . . Mensch-Maschine-Interaktion
NFC . . . Near Field Communication
PAYL . . . Pay-as-you-live
PAYD . . . Pay-as-you-drive
RFID . . . . . . . Radio-Frequency Identification
WLAN . . . Wireless Local Area Network
1. Ausgangssituation, Zielsetzung, Methodik und Aufbau
1.1 Digitalisierung verändert die Produktwelt
“If you went to bed last night as an industrial company, you’re going to wake up today as a software and analytics company.”2
Unter diesem Leitgedanken eröffnete Jef Immelt, Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens General Electric, die dritte „Minds + Machine“-Konferenz des Unternehmens.3 Dieses Zitat verdeutlicht die tiefgreifenden Veränderungen, denen Unternehmen in der digitalen Welt gegenüberstehen. Der fortschreitende Trend zur Digitalisierung durchdringt alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche.4 Digitale Produkte und Technologien wie z. B. Social Media5, Cloud Computing, Data Analytics, mobiles Internet oder intelligente autonome Systeme prägen unser privates und berufliches Umfeld grundlegend.6 Diese Entwicklungen bildeten den Ausgangspunkt des diesem Bericht zugrunde liegenden Forschungsprojektes. Das von der Heinz Nixdorf Stiftung geförderte Projekt setzt die Konsequenzen der Digitalisierung für die Produktwelt in den Mittelpunkt. In den 1950er-Jahren entwickelte der Visionär und Computerpionier Heinz Nixdorf den Elektronenmultiplizierer – eines der ersten Beispiele für ein neues Produkt in der digitalen Welt. Die Veränderung der Produktlandschaft durch digitale Technologien und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland stehen im Zentrum des Forschungsprojektes.
Durch die Einbettung digitaler Komponenten in Objekte mit ursprünglich rein physischer Beschaffenheit werden digitale Technologien zunehmend allgegenwärtig, denn auch Alltagsgegenstände wie z. B. Uhren oder Autos werden immer mehr mit softwarebasierten digitalen Elementen – u. a. Mikrocontrollern, Kommunikationssystemen, Identifikatoren, Sensoren und Aktoren7 – ausgestattet.8 Smartwatches, intelligente Roboter, autonome Fahrzeuge, Lieferdrohnen oder Wearables wie z. B. Google Glass oder Fitnessarmbänder kommen auf den Markt.9 Auch der klassische Turnschuh wird durch die Ausstattung mit Sensorik zum intelligenten Turnschuh. Der Nike+ kann beispielsweise von Läufern dazu verwendet werden, Distanz, Geschwindigkeit und weitere Aktivitätsdaten zu messen.10 Um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein, stehen Unternehmen aller Branchen vor der Herausforderung, ihre Strategien und Prozesse anzupassen sowie innovative Produkte zu entwickeln, um so das Risiko zu minimieren, den Wettbewerb um disruptive Innovationen zu verlieren.11
Im Zusammenhang mit dem Trend zur Digitalisierung ist auch die Angst vieler Unternehmen vor Disruption, d. h. vor einer neuen Idee, die eine ganze Industrie grundlegend verändert und etablierte Unternehmen aus dem Markt drängt, spürbar. Das wohl prominenteste Beispiel stellt die Fotoindustrie dar, die durch die Entwicklung der Digitalkamera vollständig umgekrempelt wurde. Die Digitalkamera wiederum wird aktuell zunehmend vom Smartphone verdrängt. Auch klassische Straßenkarten wurden zunächst durch Navigationsgeräte und derzeit durch Smartphones ersetzt. Während noch vor wenigen Jahren zahlreiche DVDs und Blue-rays verkauft wurden, gewinnen Unternehmen wie Netflix, die mittels Video-on-Demand ihren Kunden die Möglichkeit bieten, Inhalte per Streaming zu erhalten, an Beliebtheit. Diese Beispiele zeigen das disruptive Potenzial digitaler Technologien und verdeutlichen, wie wichtig es ist, bestehende Geschäftsmodelle zu hinterfragen und die Möglichkeiten, die durch neue Technologien entstehen, für die Entwicklung neuer Produkte zu nutzen.
Die Relevanz und Aktualität der Digitalisierung für Wirtschaft und Gesellschaft zeigt sich u. a. auch an den Initiativen der Bundesregierung zur Digitalen Agenda, Industrie 4.0 und Smart Services Welt. Im Industrial Internet Consortium haben sich Unternehmen, staatliche Organisationen und Universitäten zusammengeschlossen, um gemeinsam an neuen Konzepten zu arbeiten.12 Der vorliegende Bericht basiert ebenso auf den Implikationen, Chancen und Herausforderungen, die aus der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft entstehen, ist jedoch durch eine andere Ausrichtung gekennzeichnet, als viele bekannte Studien zum Thema Industrie 4.0 und Smart Services Welt. Der Blickwinkel konzentriert sich weniger auf Prozesse, sondern vielmehr auf die Produkte. Welche neuen Produkte durch die Digitalisierung möglich werden, welche Eigenschaften sie aufweisen und zu welchen Veränderungen sie in den Branchen führen – dies wird im Rahmen dieses Berichts deutlich.
Vor diesem Hintergrund zielt dieser Bericht darauf ab, einen systematischen Überblick über digitale Technologien und ihre Anwendung in neuen Produkten zu geben. Dazu werden bedeutende Eigenschaften neuer Produkte identifiziert und ihre datenzentrierte Vernetzung untersucht. Zahlreiche Beispiele verdeutlichen das innovative Potenzial neuer Produkte in der digitalen Welt. Ziel ist es darüber hinaus, die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung der Produktwelt für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu identifizieren und industrieübergreifende Handlungsempfehlungen zur Entwicklung neuer Produkte in der digitalen Welt abzuleiten.
1.2 Methodik und Vorgehensweise
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden vier für den Standort Deutschland bedeutende sowie sehr unterschiedliche Branchen für die Analyse ausgewählt: Industrie – wobei der Fokus auf den Maschinen- und Anlagenbau sowie die Automobilbranche gelegt wurde – Logistik, Finanzdienstleistungen und das Gesundheitswesen. Die Betrachtung dieser unterschiedlichen Branchen verspricht vielseitige Erkenntnisse im Hinblick auf die Umsetzung des Umbruchs im digitalen Zeitalter.
Methodisch basieren die Forschungsarbeiten auf einer Kombination aus induktiver und deduktiver Vorgehensweise, deren vier Bestandteile im Folgenden erläutert werden (siehe Abbildung 1).
Die Grundlage der Forschung bildete fundierter
Desk-Research
zu aktuellen Trends, Technologien und Produkten sowie die anschließende Kategorisierung und Auswertung der gesammelten Daten. Produkt- und Anwendungsbeispiele sowie damit einhergehende innovative Geschäftsmodelle der Branchen Industrie, Logistik, Finanzdienstleistungen und Gesundheit wurden im Rahmen dieser Kategorisierung auf zentrale Bestandteile, Kundennutzen sowie Eigenschaften analysiert. Im Rahmen von projektinternen
Diskussionsrunden
fand ein regelmäßiger Austausch statt, der dank des interdisziplinär zusammengesetzten Teams die Analyse neuer Produkte aus verschiedenen Blickwinkeln ermöglichte. Das Forschungsteam besuchte darüber hinaus zahlreiche Kongressveranstaltungen und Industriemessen, um aktuelle Innovationstrends in die Forschungsarbeit einzubeziehen.
Abbildung 1: Die vier methodischen Bausteine des Forschungsprojektes
Zur Vertiefung der Einblicke in die Anwendung digitaler Technologien und technologischer Konzepte im Bereich Industrie und Logistik diente ein
Branchen-Fokus-Workshop
im Juni 2015, an dem 28 Vertreter namhafter Unternehmen teilnahmen. Durch die Identifikation relevanter Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten in Industrie und Logistik wurde die Grundlage für die Entwicklung erster Handlungsempfehlungen zur Umsetzung des digitalen Wandels in der Produktwelt gelegt. Zudem wurden in einem
Kreativitätsworkshop
mit 25 Studierenden der Fachrichtungen Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft sowie Wirtschaftsinformatik im November 2015 neue Produkte und Geschäftsmodelle für die digitale Welt der Zukunft erarbeitet, die auf der Anwendung digitaler Technologien und technologischer Konzepte basieren.
Als weitere Quelle für die Gewinnung qualitativer Daten diente die Durchführung von insgesamt 16
Experteninterviews
mit Unternehmensvertretern verschiedener Branchen. Die Fachgespräche gaben die Gelegenheit, tiefere Einblicke in einzelne Unternehmen zu erhalten sowie die Thematik aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
Darüber hinaus bildete die
Fachkonferenz „Neue Produkte in der digitalen Welt – Chancen und Herausforderungen“
im Januar 2016 in München einen wichtigen Meilenstein der Forschungsarbeit. Rund 150 Teilnehmer arbeiteten in branchenspezifischen Workshops an Projektfragestellungen, bewerteten erste Handlungsempfehlungen und entwickelten sie weiter. Außerdem konnten durch Fachbeiträge von 10 Referenten aus den Projektbranchen wertvolle Erkenntnisse aus Praxissicht gewonnen werden. Zur Veröffentlichung der Projektergebnisse sowie deren weiterführender Vertiefung und Diskussion fand im Juni 2016 die
Fachkonferenz „Neue Produkte in der digitalen Welt“
mit rund 100 Teilnehmern in Paderborn statt. Praxisvorträge, eine spannende Podiumsdiskussion und nicht zuletzt der Besuch des weltweit größten Computermuseums – dem Heinz Nixdorf MuseumsForum – boten erneut Gelegenheit zum Austausch und rundeten das Forschungsprojekt an einem für die deutsche Wirtschaft bedeutenden Industriestandort ab.
13
Im Rahmen einer induktiven Vorgehensweise fand eine Verdichtung der Expertenaussagen, der Ergebnisse des Kreativ- und Branchen-Fokus-Workshops sowie der beiden Fachkonferenzen statt. Die deduktive Ableitung relevanter Produkte und Technologien sowie letztlich auch der Veränderungstendenzen und der Handlungsempfehlungen erfolgte einerseits durch die zielgerichtete Analyse von Studien und Berichten hinsichtlich zukünftig realisierbarer Anwendungspotenziale und andererseits durch projektinterne Forschungsarbeit und Systematisierung des Themenfeldes.
Aufbau des vorliegenden Berichts
Der vorliegende Abschlussbericht fasst die Forschungsergebnisse in sieben Kapiteln zusammen (siehe Abbildung 2).
Abbildung 2: Aufbau des Projektberichts
Nach der in Kapitel 1 erfolgten Darstellung der Ausgangssituation mit Ableitung der Zielsetzung und Methodik werden in Kapitel 2 die konzeptionellen Grundlagen neuer Produkte in der digitalen Welt dargelegt. Neben der Definition neuer Produkte geht das Kapitel auf ihre Eigenschaften und den erweiterten Kundennutzen ein, den neue Produkte in der digitalen Welt ermöglichen. Kapitel 3 gibt einen Überblick über digitale Technologien, die als Enabler für neue Produkte gelten und erläutert den Datenfluss in digitalen Produkten und Systemen, bevor in Kapitel 4 neue Erkenntnisse zur Gestaltung von Innovationsprozessen und -strategien als Treiber für neue Produkte dargestellt werden und auf die wachsende Vernetzung im Rahmen von Plattformen und Ecosystems eingegangen wird. In Kapitel 5 wird der Wandel der Produktwelt und das Digitalisierungs-Framework erklärt. Dazu erfolgen eine branchenspezifische Beschreibung von Produktbeispielen sowie die Ausführung von detaillierten Fallbeispielen, die als richtungsweisend erachtet werden. Kapitel 6 beschreibt schließlich anhand von drei Trends den Wandel in den Branchen. Die Darlegung der Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Entwicklung neuer Produkte ist Kern des 7. Kapitels. Der Bericht endet mit einem kurzen Fazit in Kapitel 8.
2 Vgl. CIO (2016): http://www.cio.com/article/2824542/internet/ge-says-industrial-internet-is-here.html., zugegriffen am 30.07.2016.
3 Vgl. CIO (2016): http://www.cio.com/article/2824542/internet/ge-says-industrial-internet-is-here.html., zugegriffen am 30.07.2016.
4 Vgl. Roland Berger/BDI (2015), S. 6f.
5 Kursiv markierte Begriffe und Textstellen werden im Glossar erläutert.
6 Vgl. Fichman/Dos Santos/Zheng (2014), S. 329f. Für weiterführende Literatur zum Thema „Die Zukunft der Arbeit in der digitalen Welt“ siehe Picot (2013).
7 Vgl. Bauer/Schlund/Marrenbach (2014), S.19.
8 Vgl. Yoo et al. (2012), S. 1398; Bharadwaj et al. (2013), S. 472ff.
9 Für weiterführende Literatur zum Thema „Maschinen entscheiden“, „Die Zukunft der Arbeit in der digitalen Welt“ und „M2M und das Internet der Dinge“ siehe Homepage des MÜNCHNER KREIS: https://www.muenchner-kreis.de/nc/veroeffentlichungen.html.
10 Vgl. Wilson (2013), S. 23.
11 Vgl. Christensen (2015), S. 154ff.
12 Vgl. Industrial Internet Consortium (2015): http://www.iiconsortium.org/about-us.htm, zugegriffen am 30.07.2016.
13 Die Vorträge der Konferenzen in München und Paderborn sind auf der Homepage des MÜNCHNER KREIS frei zugänglich unter www.muenchner-kreis.de.
2. Konzeptionelle Grundlagen
2.1 Definition und Eigenschaften neuer Produkte in der digitalen Welt
Zur Definition „neuer Produkte in der digitalen Welt“ ist es zunächst erforderlich, bestehende Begriffsbestimmungen digitaler Produkte zu betrachten. Dabei wird deutlich, dass diese nicht ausreichen, um die aktuellen Entwicklungen im Bereich digitaler Produkte und Technologien zu beschreiben. Basierend auf der Definition digitaler Produkte werden schließlich ihre Eigenschaften untersucht und dargelegt.
Digitale Produkte
In der Literatur existieren vielfältige Begriffsdefinitionen für digitale Güter. So versteht beispielsweise Brandtweiner (2000) unter einem digitalen Gut „ein Gut, das in elektronischer Form, also vercodiert als Menge von Bits und Bytes vorliegt und somit über eine Netzinfrastruktur geliefert werden kann”14. Fritz (2001) wiederum beschreibt digitale Produkte als all jene Güter, die im Internet online bis zum Endkunden übertragen werden können.15 Für Illik (1998) haben digitale Güter „keinerlei physischen Anteil (...) und können vollständig über digitale Datennetze distribuiert werden”16.
Wie diese kurze Erläuterung bestehender Definitionen zeigt, stellen existente Begriffsbestimmungen bereits fest, dass „zunächst physische Produkte für den elektronischen Markt digitalisiert werden können”17. Die hier gelisteten Beschreibungen digitaler Produkte und Güter beziehen sich allerdings vornehmlich auf Entwicklungen, die sich mit der Etablierung des E- Commerce verbreiteten. Beispielsweise wird Musik nicht mehr ausschließlich als CD physisch versandt, sondern der digitale Dateninhalt wird mittels Codierverfahren so komprimiert, dass man die Musik in tragbaren Playern speichern und heute sogar ohne zusätzliche Hardware im Internet erhalten kann, was den herkömmlichen Handel revolutionierte. Holmquist (2012) hält fest, dass digitale Produkte zur Erfüllung ihrer primären Funktion teilweise oder vollständig auf Computerprozesse angewiesen sind. Digitale Produkte ersetzen dadurch eine analoge Funktion (z. B. Zeigen der Uhrzeit) und/oder stellen eine neue Funktion (z. B. Messen des Pulses) bereit, die vor der Einführung des digitalen Produktes nicht möglich war.18
Existierende Definitionen digitaler Güter in der skizzierten Form sind allerdings für das im Zuge der aktuellen digitalen Transformation zu beobachtende Phänomen neuer Produkte nur teilweise anwendbar. Sie decken – aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich digitaler Technologien und der zunehmenden Einbettung digitaler Komponenten in physische Produkte – nicht das komplette Spektrum der neuen Produkte in der digitalen Welt ab.
Ein Kontinuum an neuen Produkten in der digitalen Welt
Um sich einer treffenden Definition anzunähern, soll zunächst auf die Eigenschaften neuer Produkte in der digitalen Welt eingegangen werden, um so die Unterschiede zu herkömmlichen Produkten – und daher auch zu traditionellen Definitionen – aufzuzeigen und anschließend eine Arbeitsdefinition abzuleiten.
Die in der digitalen Welt existierenden Produkte und Technologien sind vielfältig. Während traditionellerweise zwischen physischen und digitalen Produkten unterschieden wurde – was beispielsweise auch aus der Definition von Brandtweiner (2000) hervorgeht, der digitale Güter als „Menge von Bits und Bytes“19 beschreibt, die nach Illik (1998) „keinerlei physischen Anteil“20 haben – ist die digitale Welt durch ein Kontinuum an Produkten und Technologien geprägt. Entstehende Produkte sind häufig nicht mehr eindeutig einer der Kategorien „analog” (bzw. rein physisch) oder „digital” zuordenbar. Sie bewegen sich vielmehr auf einem Kontinuum zwischen den beiden Extremen (siehe Abbildung 3). Durch die zunehmende Ausstattung analoger und bisher passiver Objekte mit Mikrocontrollern, Kommunikationssystemen, Identifikatoren, Sensoren und Aktoren entstehen hybride Produkte.21 Ein aussagekräftiger Begriff zur Bezeichnung dieser hybriden Produkte ist „Digicals”, eine Trademark des Unternehmens Bain & Company22. Diese Wortneuschöpfung setzt sich aus den Begriffen „digital“ und „physical“ zusammen. Traditionell rein physische Produkte werden also um digitale Fähigkeiten ergänzt und es entstehen erweiterte oder völlig neue Produkte.
Abbildung 3: Ein Kontinuum an Produkten und Technologien zwischen physischem und digitalem Extrem
Wie Abbildung 3 zeigt, existieren in der digitalen Welt drei Produktkategorien: rein physische Produkte und Technologien, rein digitale Produkte und Technologien und hybride Produkte und Technologien. Die Kategorie der „rein digitalen Produkte und Technologien” umfasst beispielsweise Cloud Computing, Data Analytics, Social Media oder Digital Mock-ups und bezieht sich somit auf Technologien, die keinen physischen Anteil haben. Diese Gruppe unterscheidet sich von den „hybriden Produkten und Technologien” bzw. den Digicals*, die durch die zunehmende Ausstattung rein physischer und bisher passiver Objekte mit Mikrocontrollern, Kommunikationssystemen, Identifikatoren, Sensoren und Aktoren entstehen.23 Zu diesem Innovationsfeld gehören z. B. Produkte wie Wearables, Drohnen oder intelligente Roboter, die ihre Aufgabe nur durch die Kombination mit Digitaltechnologien ausüben können. Auch der intelligente Tisch einer Münchner Designmanufaktur, der mit Hunderten Sensoren ausgestattet wurde und so u. a. in der Lage ist zu analysieren, was auf der Tischplatte steht und je nach Wunsch unterschiedliche Stellen heizen oder kühlen kann, ist ein Beispiel für ein Digical*.24 In der Kategorie der Wearables sind z. B. Google Glass





























