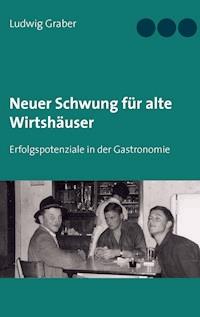
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ohne Wirt stirbt das Dorf. Nicht nur deshalb lohnt es sich für Wirte zu kämpfen und ihren Betrieb auf ertragreiche Beine zu stellen. Lebst Du schon oder stirbst Du noch? Kannst du finanziell überleben oder arbeitest du viel und es geht nichts weiter? Eine alte Weisheit besagt: "Wer nur arbeitet hat keine Zeit, Geld zu verdienen!" Ludwig Graber, Unternehmensberater und selbst leidenschaftlicher Wirt, wirft einen gnadenlos pragmatischen Blick auf die aktuelle Situation in der Gastronomie. Und er ist überzeugt, mit der richtigen Strategie kann auch ein Wirtshaus am Land überleben. Wie das gelingen kann, verrät er in seinem Ratgeber, der speziell auf das Leben und Überleben eines Wirtes in ländlichen Regionen ausgerichtet ist. Inhaltliche Highlights - Tacheles reden über die Herausforderungen der Wirte - Neue Perspektiven aufzeigen und Tabuthemen ansprechen - Zeigen, wie Wirte ihre Zahlen in den Griff bekommen - Alles über die Erfolgspotenziale Marketing, Kooperation und Persönlichkeit - Praktische Beispiele, einfach zum Umsetzen - Persönliche Anekdoten, die zum Schmunzeln und Nachdenken anregen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Idee zum Buch
Womit Wirte zu kämpfen haben
Sünden der Vergangenheit
Familienbetriebe: Tradition als Fluch und Segen
Wandel der Dorfgesellschaft
ABO-Essen
Wer folgt nach?
Das Dilemma mit der Nahrung
Erfolgspotenziale für Wirte
Erfolgspotenzial: Marketing
Erfolgspotenzial: Kooperationen
Erfolgspotenzial: Finanzierung
Erfolgspotenzial: Erfolgsrechnung „Gewinn- und Verlust“
Erfolgspotenzial: Unternehmensziele
Erfolgspotenzial: Unternehmer
Softfacts – oder die Sache mit der Zeit
Zeit als kostbares Gut
Trauern, um die gute alte Zeit?
Seinerzeit im Wirtshaus
Zum Schluss: Ein Ausblick
Über den Autor und den Kirchenwirt
Literaturverzeichnis
Die Idee zum Buch
„Stirbt das Wirtshaus, stirbt das Land!“ – unter diesem Motto nahm ich bereits im Mai 2000 an einem Workshop zum Thema „Wirtshaussterben“ teil. Namhafte Referenten, wie der damalige österreichische Vizekanzler Dr. Erhard Busek, Univ. Prof. Dr. Brunhilde Scheuringer von der Universität Salzburg, Institut für Kultursoziologie oder Univ. Ass. Dr. Bernhard Tschofen der Universität Wien, Institut für europäische Ethnologie und noch viele andere haben sich der Institution und dem Volksgut Wirtshaus angenommen. Das war die Initialzündung, um mich noch näher mit dem Thema zu beschäftigen. Zehn Jahre später schloss ich mein Diplom-Studium der Betriebswirtschaft an der Hamburger Fern-Fachhochschule in den Studienzentren München und Nürnberg, mit einer umfassenden Analyse der Erfolgspotenziale für Wirte, ab und wende diese seitdem in meinem eigenen Wirtshaus, in Beratungen, Kursen, Workshops, Vorträgen oder Seminaren an.
Ich bin selbst in einem Gastgewerbebetrieb aufgewachsen und habe den elterlichen Betrieb, welcher 1672 gegründet wurde, im Jahre 1994, im Alter von 27 Jahren übernommen. Seitdem übe ich den Beruf „Wirt“ als Einzelunternehmen, in Form eines Familienbetriebes aus. In all diesen Jahren als Wirt konnte ich viele praktische Erfahrungen sammeln. Nebenbei war ich in verschiedenen touristischen und wirtschaftlichen Organisationen aktiv, unter anderem bin ich Obmann des Vereins „Kärntner Wirtshauskultur“ und unterstütze als Unternehmensberater andere Betriebe auf ihrem Weg zum Erfolg. Als meine große Stärke sehe ich persönlich, dass ich als einer der wenigen Unternehmensberater noch immer aktiv im eigenen Wirtshaus stehe und im operativen Bereich mitarbeite. Alle Probleme, alle Aufgaben löse ich täglich in unserem Wirtshaus und alle Erfahrungen mache ich täglich im eigenen Betrieb. Sozusagen bin ich immer am Puls der Zeit. Der Austausch mit anderen Wirten inspirierte und motivierte mich dazu, meine Erfahrungen in einem Buch zu sammeln.
Meine Ausführungen und Erfolgsfaktoren sind leider kein Patentrezept, das jeder Wirt einfach so anwenden kann. Zu heterogen ist die Wirtshauslandschaft geprägt, und das ist gut so. Nur so kann sich jeder vom Durchschnittsmarkt abheben und ganz einzigartig, authentisch, persönlich und unverwechselbar – und somit nicht austauschbar sein. Wichtig ist, Ideen zu sammeln und für sich selber immer das Beste herausholen, klare Gedanken fassen, dann entscheiden und handeln – nach dem Motto: „Hilf dir selbst, dann ist dir geholfen.“ Dafür gibt es in diesem Buch einige Impulse.
Womit Wirte zu kämpfen haben
Was ist ein Wirtshaus? Das Gastgewerbe stellt in vielen touristischen Regionen einen wesentlichen wirtschaftlichen Faktor, nämlich den der Beherbergung und Verpflegung von Gästen dar, wobei der überwiegende Teil auf Verpflegung entfällt. Viele Wirtshäuser haben sich im Laufe der Zeit ausschließlich auf die Verpflegung von Gästen spezialisiert. Zielgruppen der Gastgewerbebetriebe, also Wirtshäuser, könnten Stammgäste, Tagesgäste, Einheimische, Touristen oder Fremde sein.
Der Begriff „Wirtshaus“ wird zum Beispiel in Österreich in der Gewerbeordnung weder definiert, noch findet man in Gesetzen oder Verordnungen Hinweise auf die Bezeichnung. Rechtlich gesehen ist damit ein Gastronomiebetrieb gemeint, umgangssprachlich wird es als Wirtshaus oder Gasthaus bezeichnet. Im Volksmund wird oft zynisch der Begriff Wirtshaus so definiert, dass hier der Wirt das Sagen hat und in einem Gasthaus, da hat eigentlich der Gast die Hosen an.
In vielen deutschen Gegenden wird auch der Begriff Gaststätte verwendet. Eine breite Definition wäre möglich. Um die Begriffsdefinitionen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, verwende ich einfach den Terminus „Wirtshaus“. Viele Klischees sind an ein Wirtshaus gebunden. Der Begriff ist an viele Erwartungen geknüpft und steht als Synonym für:
Gasthof im ländlichen Bereich, in dörflichen Ansiedlungen
Verkörperung von Geschichte und Identität der Bewohner
Multifunktionalität durch den persönlichen Einsatz der Wirtsleute
Vermittlung von Geborgenheit und Willkommen sein
Einrichtung demonstriert welche Werte die Wirtsleute haben
Möglichkeit der zwanglosen Kommunikation und Akzeptanz
Wirtshäuser werden sehr oft als Einzelunternehmung vom Eigentümer selbst als Ganzjahresbetrieb geführt. Charakteristika sind lange Öffnungszeiten und die Mitarbeit sowie der Einsatz der gesamten Familie. Es ist keine Seltenheit, wenn Wirtshäuser sechs oder sogar sieben Tage, oft in der Zeit von 10 Uhr (oder früher) bis 24 Uhr oder länger, geöffnet haben.
Für Unternehmen, insbesondere für kleinere Gastgewerbebetriebe, ist und wird es immer schwieriger, am relevanten Markt im starken Verdrängungswettbewerb bestehen zu können. Sättigung der Märkte, volatile Märkte, unzureichende Eigenkapitalausstattung, Systemgastronomie, Paragastronomie1, mangelnde betriebswirtschaftliche Kenntnis vieler Unternehmer, Strukturwandel, steigende Kosten, Fixkostendilemma oder sinkende Kaufkraft potenzieller Gäste sowie die immer größer werdenden Überbürokratisierung einhergehend mit Dokumentationswahn sind Herausforderungen, mit denen die Unternehmen zu kämpfen haben.
In Österreich und Deutschland wird die Unternehmerlandschaft dadurch geprägt, dass Kleinstunternehmer und Klein- und Mittelunternehmen (kurz: KMUs) im Gastgewerbe als traditionelle Familienbetriebe, meist in Form von Einzelunternehmen geführt werden. In Österreich sind zum Beispiel 99 Prozent aller Tourismusbetriebe KMUs. Diese stellen daher für die Volkswirtschaft einen wesentlichen Faktor dar und bilden vor allem in Krisenzeiten das Rückgrat der Wirtschaft. In Deutschland und der Schweiz ist das nicht anders.
Kapitalgesellschaften sind aufgrund der Kleinheit der Unternehmen eher selten, da diese wegen der Betriebsgröße meist nicht wirtschaftlich geführt werden könnten. Unter dem Schlagwort „Fixkostendilemma“ schmälern steigende Kosten Unternehmensgewinne und somit auch den Cashflow. Sehr lange Amortisationszeiten und hohe Kapitalbindung im Anlagevermögen wirken sich negativ auf die Liquiditätssituation der Unternehmen aus. Globalisierungsprobleme und volatile Märkte erschweren es KMUs, relevante Absatzmärkte gewinnbringend zu bearbeiten.
Die Angst liegt nahe, dass nach dem Kaufhaussterben und dem Bauernsterben am Land auch ein Wirtshaussterben folgt. Ein Fernsehsender hat sich der sterbenden Spezies sogar mit einer TV-Serie angenommen.
Das Format „Bauer sucht Frau“ ist bekannt. Nun gibt es auch noch eine neue Serie: „Wirt sucht Frau“. Sind die Wirtsleute nun auch eine aussterbende Spezies? Ob diese TV-Serie sinnhaft ist oder nicht, will ich nicht beurteilen. Jedoch hoffe ich, dass diese für die Wirtshauslandschaft positive Effekte haben wird. Enorm viele Kochshows, Beiträge über Restaurants, Restauranttester und viele mehr deuten darauf hin, dass das Thema Essen, und damit in Verbindung das Wirtshaus, wichtig ist und an Bedeutung gewinnt.
Mit diesem Buch möchte ich aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen Wirtshäuser doch noch Überlebenschancen haben. Um langfristig Marktpräsenz, Wachstum, Erfolg und Unternehmensstabilität für Wirtshäuser zu gewährleisten, sollten Maßnahmen ergriffen werden, die zu Erfolgspotenzialen ausgearbeitet und entwickelt werden. Ein zielgerichtetes, koordiniertes Marketing würde eine solche Maßnahme darstellen. Marktnischen ausnützen und Markenbildung, also „Branding“, wird für eine Stabilität am Markt immer wichtiger. Regionale Kooperationen stellen einen weiteren Erfolgsfaktor dar. Deshalb werde ich auch verschiedene Formen und Möglichkeiten anhand von praktischen Beispielen aufzeigen.
Veränderungen im Tourismus haben Probleme mit sich gebracht, auf die Unternehmer, in der relevanten Branche, nicht zeitgerecht reagiert haben. Dadurch war ein Rückgang bei Nächtigungszahlen in vielen ländlichen Gebieten zu verzeichnen und somit hat sich die Situation von Gastgewerbebetrieben drastisch verschlechtert. Eine hohe Marktsättigung, wie Angebote in billigeren Urlaubsländern, führte dazu, dass der Einsatz eines zielgerichteten und koordinierten Marketings notwendig, jedoch leider verabsäumt wurde.
Aber auch steigende Bedürfnisse und Veränderungen der Erwartungshaltung der Gäste führten dazu, dass permanent in Unternehmen investiert werden musste. Der Kapitalbedarf stieg, denn Investitionszyklen wurden immer kürzer und Unternehmer mussten häufiger auf Fremdkapital zurückgreifen, da Eigenkapital nicht in dem Maße vorhanden war, wie es benötigt wurde. Banken waren anfangs sehr finanzierungsfreudig, jedoch änderte sich dies sehr schnell ab dem Zeitpunkt, bei dem Unternehmer nicht mehr die gewünschten Sicherheiten zur Verfügung stellen konnten. Wirtshäuser konnten im sehr schnell ansteigenden Verdrängungswettbewerb auf Marktveränderungen und Gästewünsche nicht schnell und qualitativ genug reagieren, wie es der Markt verlangt hätte. Erlöse konnten nicht gesteigert, oftmals kaum gehalten werden.
Für leistungswirtschaftliche Prozesse ist Kapital eine Grundvoraussetzung. Daher ist eine optimale Finanzierung, speziell in Zeiten, in denen das Eigenkapital knapp ist, für Wirte einfach notwendig. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die Zahlen. Der Blick für Kostensenkungspotenziale im eigenen Betrieb kann damit geschärft werden. Nur wenn Unternehmer interaktiv mit den laufenden Veränderungen und kooperativ mit den Mitbewerbern arbeiten, haben sie Chancen am Markt langfristig zu existieren. Neben abgestimmten Marketingmaßnahmen und optimaler Finanzierungsauswahl kann ein Unternehmen nur erfolgreich sein, wenn die Motivation und Leistungsbereitschaft des Unternehmers selbst und seiner Mitarbeiter in sehr hohem Maße vorhanden sind. Visionen auf den Boden zu bringen, gesetzte Ziele zu realisieren und die Motivation des Unternehmers sind also wesentliche Potenziale, die zum Erfolg führen.
1 Paragastronomie: Darunter werden örtliche nicht konzessionierte Vereine oder Organisationen verstanden (z.B. Feuerwehr, Fußballclub oder Gesangsverein), die Veranstaltungen (Events) mit Gewinnabsicht organisieren und durchführen, dabei Getränke ausschenken und Speisen verabreichen ohne dafür Steuern zu zahlen.
Sünden der Vergangenheit
Die Wirtschaft ändert sich ständig und daraus resultiert, dass sich auch die Tourismuswirtschaft permanent ändert bzw. ändern muss. Wenn Unternehmer dies übersehen oder nicht bereit sind, sich mit zu verändern und zu agieren, bringt dies große Schwierigkeiten wie eine Absatzverschlechterung mit sich.
Die Unternehmergeneration der boomenden 1980er Jahre hat es in vielen ländlichen Regionen trotz hoher Renditen verabsäumt, in Betriebe zu investieren oder Liquiditätsreserven zu bilden. Wirtshäuser und Hotels sind kontinuierlich dem technischen und infrastrukturellen Veralterungsprozess zum Opfer gefallen. Erwirtschaftete Liquiditätsüberschüsse wurden oft privater Nutzung zugeführt. Folge daraus war, dass Betriebe technisch den Anschluss nicht halten konnten, das Fremdkapital trotz geringer Investitionen anstieg und es zur Überschuldung vieler Betriebe kam.
Durch zu geringe oder gar keine Bilanzgewinne und zu hohen Privatentnahmen kam es zum Aufbau von negativem Eigenkapital. Ein vom Gast geforderter Qualitätsstandard konnte nicht mehr angeboten werden. Investitionen in die Hardware-Qualität waren nicht möglich, weil keine Liquidität vorhanden war und für Qualitätssteigerungen im Soft-Fact-Bereich daher fehlten. Und es fehlt teilweise noch immer neben notwendiger Energie auch die Bereitschaft und Sensibilität. Oft wird die gesamte Energie ins Jammern investiert, statt an Lösungen zu arbeiten. Die Rahmenbedingungen für den Tourismus, wie beispielsweise Gästeverhalten, Erwartungshaltungen und technischer sowie sozialer Fortschritt, haben sich geändert und ändern sich auch weiterhin. Der drastische Umbruch, in dem sich die Gesellschaft von heute befindet, ist für die Tourismuswirtschaft sehr folgenreich. Wer die Übergänge versteht und gestaltet, besser noch mitgestaltet, hat gute Chancen erfolgreich zu sein. Berge, Seen, Wandern oder Wellness allein reichen schon lange nicht mehr aus. Der Urlaubsalltag muss zu einem speziellen Event inszeniert sein und das Angebot muss „in Szene“ gesetzt sein und den breit gefächerten Bedürfnissen der Gäste voll entsprechen. Inszenieren bedeutet nicht Eventmanagement rund um die Uhr, sondern die Einsicht jedes Unternehmers, dass nur gut organisiertes und kommuniziertes Erlebnis (Zeit) in einer authentischen Wertewelt (Sinn) auf Basis ehrlich kalkulierter Preise (Geld) die Qualität der Betriebe in Zukunft ausmachen können, das bestätigt auch Freizeitforscher Zellmann.
Änderungen des Gästeverhaltens
Der Trend zu Kurzurlauben nimmt ständig zu. Insgesamt urlauben Gäste häufiger, dafür kürzer. Damit verbunden ist eine Steigerung der Gästezahlen. Trotz dieser Steigerung verringerte sich die Zahl der Übernachtungen. Durch die kürzeren Nächtigungen kann die Auslastung nur gleich bleiben, wenn die Anzahl der Ankünfte steigt. Dies bedeutet jedoch wieder, dass in Beherbergungsbetrieben höhere Personalkosten anfallen, weil die Zimmer häufiger, also in kürzeren Intervallen gesäubert oder auch renoviert werden müssen.
Familienbetriebe: Tradition als Fluch und Segen
Die Mehrheit der Wirtshäuser sind Familienbetriebe. Diese nehmen eine besondere Stellung unter den Unternehmen ein. Enge Strukturen, unentgeltliche Mitarbeit der Familienmitglieder, Traditionsdruck, wie auch mangelnde unternehmerische Kompetenz sowie geringe Bereitschaft zu Veränderungen wirken oft negativ auf die Entwicklung von Wirtshäusern.
Familienbetriebe sind seit mehr als einer Generation im Familienbesitz und sind somit sogenannte „Traditionsbetriebe“. Tradition, aus dem lateinischen „traditio“ entnommen, definiert heute Herkommen, Brauch, Gepflogenheiten. Unter Tradition ist die Weitergabe des Unternehmens von Generation zu Generation im Familienverbund gemeint. In Anlehnung an Markenfirmen berufen sich auch Wirtshäuser gerne auf die Anfänge oder deren Beständigkeit und werben gerne mit Tradition.
Hohes Konfliktpotenzial entsteht durch das Spezifische eines Familienunternehmens, weil Familie, Unternehmen und Eigentumsverhältnisse häufig unreflektiert vermischt werden. Familienmitglieder müssen verschiedene Bereiche „unter einen Hut“ bringen, weil Personen auch verschiedene Rollen spielen, die ihnen nicht immer klar sind. Ein Familienmitglied kann gleichzeitig Vater, Chef, Ehemann, Kollege, Gesellschafter und Eigentümer sein. Die Familie ist naturgemäß personenorientiert. Vorherrschend ist eine interaktive Face-to-Face-Kommunikation. Ob die vorherrschende Kommunikation in Familienbetrieben auch immer richtig wahrgenommen wird, wage ich zu bezweifeln. Oft wirkt sich eine sehr emotional geführte Kommunikation negativ auf das Gesprächsklima aus. Familienmitglieder sind unkündbar und emotional gebunden. Häufig erfolgt die Entlohnung meist nur in Form von Tauschgeschäften. Honorar der Familie ist beispielsweise Zärtlichkeit und Geborgenheit. Von nicht-monetärer Entlohnung kann jedoch keiner der Familienmitglieder auf längere Sicht überleben. Wichtig scheint, sich vom Familienbetrieb zum Familienunternehmen, vom familiär-emotionellen Entlohnungssystem zu einem monetären Entlohnungsmodell zu entwickeln.
Führung durch Vorbild oder Vormachen kann als verbreitetes Führungsmodell beobachtet werden. Schnelle Reaktionszeiten, kurze Informations- und Entscheidungswege sowie eine geringe Anzahl von Schnittstellen kennzeichnen eine Führung in einem Familienbetrieb. Mitarbeiter haben einen starken Bezug zu den Familienmitgliedern und zum Unternehmen, deshalb ist auch der Führungsstil an diese Gegebenheiten anzupassen. Ein familiärpartnerschaftlicher Führungsstil ist hier weit verbreitet und kann durch passende Mimik, Wortwahl, Höflichkeit, Respekt, Bestimmtheit sowie Flexibilität zu einem hohen Motivationsgrad führen. Haben Familienbetriebe in Zukunft noch Chancen am relevanten Markt bestehen zu können? Müssen Familienunternehmungen Konzernen oder Systemgastronomiebetrieben weichen? Ist die Nachfolge in Familienunternehmungen gesichert? Reicht die Ertragslage aus, um allen Familienmitgliedern ausreichend Einkommen zu bieten, um überleben zu können? Kann ich als Übergeber den Nachfolgern wie z.B. Kindern, Enkeln oder anderen Interessenten in Hinblick auf die enorme Reglementierung und Überbürokratisierung seitens des Staates mit ruhigem Gewissen den Betrieb überhaupt noch übergeben?
Diese und noch viele andere Fragen sind unerschöpfliche Themen, die in diesem Buch aus Zeit-und Platzgründen nicht erschöpfend bearbeitet werden können. Ich bin mir sicher, dass Familienbetriebe viele Chancen in sich bergen. Aber je höher das Konfliktlösungspotenzial ist, desto eher werden Familienunternehmungen am Markt langfristig und wirtschaftlich gut bestehen können. Speziell bei der Übernahme des elterlichen Betriebes durch die Kinder existiert ein besonderes emotionelles Konfliktpotenzial.
Der Umgang mit Konflikten kann manches Mal als primitiv, unterentwickelt, fast sogar steinzeitlich definiert werden. Das Spektrum in der Konfliktforschung ist sehr vielfältig und reicht von Verniedlichen, Verdrängen, Wegschieben, Schuldige suchen, ausschließliches Personalisieren bis hin zur schnellen Entscheidungen ohne Analyse.
Familienbetriebe werden oft der Tradition wegen übernommen und weiter geführt, auch wenn es betriebswirtschaftlich nicht gerade sinnvoll erscheint. Von den Eltern und auch der Gesellschaft wird erwartet, dass Kinder, in früheren Zeiten waren es die Söhne, den elterlichen Betrieb übernehmen. Oft wollen die Kinder jedoch etwas anderes tun als die Eltern. Die Interessen und die Kompetenzen der Kinder sind anders gelagert als die der Eltern.
Der Vater beispielsweise hatte einen Beruf als Eisenbahnbeamter (ev. Lokomotivführer), so muss der Sohn auch diesen Beruf ausüben. Die Mutter beispielsweise Friseurin, die Tochter soll das doch auch tun. Wie krank ist das denn? Kinder sollten den Beruf ausüben, für den sie sich berufen fühlen. Ich selbst musste am eigenen Leib erfahren, was es heißt in die Fußstapfen der Eltern zu treten.
Was bedeutet „in die Fußstapfen zu treten“? Für mich bedeutet es, dass ich immer hinter dem nachstapfen muss, der vor mir geht. Ich kann niemals besser oder anders werden. Das ist blanker Horror. Vor langer Zeit, als ich noch Finanzbediensteter war, sah ich meine Zukunft als Finanzprüfer im Finanzamt. Für mich eine tolle, wünschenswerte und anstrebende Zukunft. Leider nur so lange, bis mir meine Mutter mir offenbarte: „Ich geh bald in Pension und du bist der einzige Sohn. Du hast mein Wirtshaus zu übernehmen“. Oh Gott, ein Abgrund tat sich auf. Ich hatte für mich andere Pläne.
Für was habe ich die Matura (Abitur) gemacht, wozu habe ich den Buchhalterkurs und den Bilanzbuchhalterkurs absolviert? Warum, wozu, weshalb und viele andere Fragen quälten mich. Die fachliche Ausbildung hatte ich, nicht aber die Motivation. Nichtsdestotrotz habe ich gemeinsam mit meiner Frau, die den Beruf der Restaurantfachfrau erlernt hat, das Wirtshaus meiner Mutter übernommen. Wenn auch nicht ganz mit grenzenlosem Optimismus und Freude.
Es fehlt den Unternehmern heute häufig am Zahlenverständnis, aber auch am mangelnden Kapital. Oft haben gewachsene traditionelle Familienbetriebe noch Realsicherheiten in Form von Grundstücken (Baugründen) und deshalb werden von Banken trotz schlechter Bilanzen Kredite für Investitionen oder Sanierung zur Verfügung gestellt. Obwohl der Cashflow dieser Unternehmen schon längst nicht mehr ausreicht, um gut wirtschaften zu können.
In solchen Fällen ist es besser, schlechte Entscheidungen zu treffen als gar keine. Denn denken Sie daran: Schlechte Entscheidungen kann man immer noch korrigieren und anpassen. Die schlechteste aller Entscheidungen ist gar keine Entscheidung.
Mein Tipp: Egal, welche Entscheidung Sie treffen, binden Sie Ihre Familienmitglieder und Ihre Mitarbeiter mit ein. Aber lassen Sie sich nicht davon abbringen, die Entscheidung zu treffen, von der Sie selbst völlig überzeugt sind.
Ich glaube, dass Familienbetriebe in Zukunft Chancen haben, um am Markt langfristig bestehen zu können. Aber was viel wichtiger ist als einfach nur bestehen zu können, ist Erfolg zu haben. Was für jeden Einzelnen Erfolg bedeutet, muss jeder selber definieren. Monetäre Erfolge, nicht monetäre Erfolge? Das kann sich im Laufe der Zeit für den Unternehmer und die Familie ändern.
Unternehmen und Familie sind nicht zu trennen, es verschmelzen Handlungen und Ziele. Auch die Erfolgsziele verschieben sich im Laufe eines unternehmerischen Daseins. Meist sind bei Betriebsgründung nicht monetäre Ziele, wie zum Beispiel Steigerung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung des Marktpotenzials und des Marktvolumens, vorhandene Ziele. Im Laufe der Zeit und des unternehmerischen Daseins können sich oder besser gesagt müssen sich die Ziele verstärkt in monetäre Ziele umschlagen.
Mehr als Lob, Bewunderung und eventuell auch noch Wertschätzung müssen im finanziellen Bereich spürbar sein. Nur so kann das Überleben, der Fortbestand, aber auch die Motivation von Familienbetrieben langfristig gesichert werden. Der Schulausflug von den Kindern oder eine neue Sportausrüstung kann nicht durch Lob und Anerkennung finanziert werden, sondern lediglich durch Geld!
Enorm wichtig für das Überleben von Familienbetrieben ist, sich auch Zeit für die Familie zu nehmen. Geld ist wichtig, Zeit ist jedoch genau so wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Verlorene Umsätze kann ich durch zusätzliche Veranstaltungen wieder gut machen. Die verlorene Zeit mit der Familie ist für immer weg. Es gibt viele Familien, die ausschließlich zusammenarbeiten und sonst keine Gemeinsamkeiten haben. Persönliche Interessen wie gemeinsamen Urlaub, Kinobesuche, Essen und Familienfeiern, die nicht im eigenen Betrieb stattfinden, sind enorm wichtig für eine Beziehung. Eine Beziehung, die nur auf Arbeit aufgebaut ist, geht meist nach absehbarer Zeit in Brüche.
Wer hat das in seinem Umfeld nicht schon erlebt? In Familienbetrieben arbeiten meist Frau und Mann gemeinsam. Vielleicht sind noch die Eltern oder Kinder im selben Unternehmen tätig. Ein hohes Maß an Konfliktlösungspotenzial muss vorhanden sein. Es müssen Probleme respektvoll gelöst und ausgeräumt werden und dürfen keinesfalls über einen längeren Zeitraum ungelöst bleiben. Ganz problematisch wird es, wenn betriebliche Probleme in den privaten Bereich mitgenommen werden. Es ist zu bedenken, dass jeder ungelöste Konflikt sowie jedes ungelöste Problem zu Spannungen in der Beziehung führt. Mit dem Partner, mit dem ich tagsüber zusammenarbeite, vielleicht sogar auch noch streite, mit dem sollten Sie am Abend ins gemeinsame Bett steigen. Kein guter Nährboden für traute Zweisamkeit oder?
Frau oder Mann, egal wer, braucht Zeit für sich, Zeit für den/die Partnerin, Zeit für die Kinder und Zeit für Freunde, aber auch Zeit zum Träumen, Zeit für die Liebe.
Wichtig ist, die verfügbare Zeit für sich und die Familie gut zu planen. Neben guter Planung zählt auch Spontanität. Nutze die Zeit, wenn du sie nutzen kannst. Keine Ausreden!
Jeder Gastgewerbebetrieb hat umsatzstarke Zeiten und umsatzschwache Zeiten. Jeder Unternehmer muss für sich selber entscheiden, wann Zeit für die Familie zur Verfügung steht. Und wenn die Zeit für private Ziele genommen wird, dann bitte zu hundert Prozent.
Mein Tipp: Machen Sie sich selber Gedanken über Ihre eigene Zeit. Nehmen Sie sich Zeit für sich und die Familie. Zum Beispiel die Geburt, ein runder Geburtstag oder die Hochzeit des Kindes finden nur einmal im Leben statt!
Als ich den mütterlichen Betrieb übernommen habe, war ich bereits Vater von zwei Söhnen. Von Beginn an habe ich mir immer Zeit genommen, um gemeinsam mit der Familie etwas zu unternehmen. Es war sehr schwierig, weil die ältere Generation, Gäste und auch Familienmitglieder nur wenig Verständnis für die Freizeit hatten. Wer nicht viel und hart arbeitet, der war in der Gesellschaft nicht viel wert, so der einhellige Tenor. Der war faul und ein Taugenichts.





























