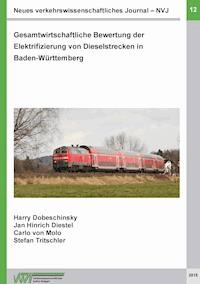
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Neben dem elektrifizierten Eisenbahnnetz existieren (nicht nur in Baden-Württemberg) noch etliche dieselbetriebene Strecken, die meist das Hauptnetz ergänzen. Einige der dieselbetriebenen Strecken weisen aus unterschiedlichen Gründen Potenziale für eine Elektrifizierung auf, die in der Regel jedoch erhebliche Investitionsaufwendungen verursacht. Um diese zu rechtfertigen, ist eine volkswirtschaftliche Bewertung erforderlich. Das Regelverfahren der „Standardisierten Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des ÖPNV“ berücksichtigt nicht alle spezifischen Nutzen einer Elektrifizierung, so dass im Auftrag des Landes Baden-Württemberg ergänzend ein kompatibles, einfach handhabbares Bewertungsverfahren zum Nachweis der Elektrifizierungswürdigkeit erstellt wurde. Dieses Verfahren basiert auf der Standardisierten Bewertung und umfasst betriebliche, ökologische, verkehrliche und wirtschaftliche Aspekte, welche für die Unterscheidung zwischen den Traktionsarten erforderlich sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
im Auftrag des Ministeriums für Verkehr und Infrastrukturdes Landes Baden-Württemberg
VWI Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart GmbH
Juli 2015
Vorwort
Die Standardisierte Bewertung für Verkehrswegeinvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs wird bereits seit vielen Jahren nicht nur in Deutschland für den Nachweis des volkswirtschaftlichen Nutzens von Maßnahmen im ÖPNV erfolgreich angewendet. Zwischenzeitlich wurde beim Ausbau des ÖPNV ein Stand erreicht, der umfangreiche Infrastrukturneubauten immer seltener erforderlich macht. Allerdings gibt es in den bestehenden Netzen des Schienenpersonennahverkehrs nach wie vor einige Lücken, deren Beseitigung gerade unter dem Aspekt steigender Mobilitätsanforderungen im Bereich des ÖPNV eine wachsende Bedeutung zukommt. In Ballungszentren und auf Strecken mit hoher Verkehrsdichte hat sich ein elektrifizierter Betrieb hervorragend bewährt.
Bei der Verbindung von Ballungsräumen untereinander oder mit eher ländlichen Regionen ist jedoch oftmals keine durchgängig elektrifizierte Verbindung vorhanden. Demzufolge müssen die Verkehre zwangsläufig gebrochen werden, wodurch die Attraktivität für die Reisenden deutlich abnimmt. Dem umfassenden Einsatz von Hybridfahrzeugen stehen die derzeit noch fehlende einsatzreife Entwicklung einer preiswerten Serienfertigung sowie die auch über viele weitere Jahre zu nutzenden vorhandenen Fahrzeuge entgegen. Insofern ist es sehr sinnvoll, die durch den Lückenschluss bei der Elektrifizierung bisher dieselbetriebener Strecken in den vorhandenen Bewertungsverfahren nicht berücksichtigten spezifischen Sondereffekte in eine ganzheitliche Betrachtung einzubeziehen.
Die in dieser Ausgabe des Neuen verkehrswissenschaftlichen Journals beschriebene und im Auftrag des Landes Baden-Württemberg entstandene Gesamtwirtschaftliche Bewertung der Elektrifizierung von Dieselstrecken in Baden-Württemberg greift diese Thematik auf und bietet eine transparente, einfach zu handhabende widerspruchfreie Ergänzung zu der bisherigen Verfahrensweise in allgemeingültiger Form, die u.a. überall dort nutzbar ist, wo die Standardisierte Bewertung für Verkehrswegeinvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs zur Anwendung kommt.
Stuttgart, im Mai 2015
Ullrich Martin
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einführung
1.1 Aufgabenstellung
1.2 Problemstellung und Zielsetzung
1.2.1 Anwendungsbereich der Standardisierten Bewertung
1.2.2 Erfahrungen aus der Anwendung der Standardisierten Bewertung
1.2.3 Zielsetzung
1.2.4 Vorgehensweise
2 Bewertungsrelevante Aspekte der Elektrifizierung
2.1 Hypothesen zur Nutzenstiftung durch Elektrifizierung
2.2 Nicht-elektrifizierte Strecken in Baden-Württemberg
2.3 Systematisierung der nicht-elektrifizierten Strecken
2.4 Beurteilung der Hypothesen
3 Perspektiven elektrischer Antriebe
3.1 Erfordernis einer zukunftsgerichteten Betrachtung
3.2 Gestaltung der Energieversorgung
3.2.1 Quellen elektrischer Energie im Jahr 2005
3.2.2 Quellen elektrischer Energie im Jahr 2020
3.2.3 Allgemeiner Strommix vs. Bahnstrommix
3.2.4 Langfristiger Ausblick
3.3 Strompreise
3.3.1 Preisdifferenzierung
3.3.2 Zusammensetzung der Letztverbraucher-Strompreise
3.3.3 Ermäßigungen für Betriebe von Schienenbahnen
3.3.4 Entwicklung und Zusammensetzung des Industriestrompreises
3.3.5 Zukünftige Entwicklung der Strompreise
3.4 Dieselkraftstoffpreis
3.4.1 Zusammensetzung des Preises für Dieselkraftstoff
3.4.2 Entwicklung des Preises für Dieselkraftstoff
3.4.3 Zukünftige Entwicklung des Preises für Dieselkraftstoff
3.5 Preisprognose in Abhängigkeit vom Energiemix
3.5.1 Energieträgeranteile an der Stromerzeugung
3.5.2 Prognosemodell für den Erzeugerpreisindex von Strom bei Abgabe an gewerbliche Anlagen
3.5.3 Einzelpreisprognosen der Energieträger
3.5.4 Prognose des Erzeugerpreisindex für Dieselkraftstoff für Straßen- und Schienenfahrzeuge
3.5.5 Prognose des Erzeugerpreisindex für Elektrizität bei Abgabe an gewerbliche Anlagen
3.6 Sonstige Wirkungen
3.6.1 Potentiale zur Reduzierung technischer Fahrzeiten
3.6.2 Ermittlung des Energiebedarfs
3.6.3 Schienenhybridfahrzeuge
3.6.4 Elektromagnetische Felder
3.6.5 Betriebskosten des ÖPNV
4 Elektrifizierungsspezifische Kriterien und deren Bewertung
4.1 Teilindikatoren des Elektrifizierungsnutzens
4.2 Energiekostensätze für die Bewertung
4.3 CO2-Emissionen und Bewertung sonstiger Schadstoffe
4.3.1 Überarbeitung der Mengen- und Wertansätze
4.3.2 Mengengerüst für klimarelevante Emissionen und Luftschadstoffe
4.3.3 Wertgerüst für klimarelevante Emissionen und Luftschadstoffe
4.3.4 Mengen- und Wertansätze für Emissionen elektrischer Antriebe
4.3.5 Mengenansätze für Fahrzeuge mit Dieselantrieb
4.3.6 Zusammenfassung der Mengen- und Wertansätze für Emissionen
4.4 Schallemissionen
4.5 Umleitungsstrecken
4.6 Kapazitätserhöhung
4.6.1 Kapazitätserhöhung durch Fahrzeitreduktionen
4.6.2 Beispielrechnung zur Kapazitätserhöhung
4.6.3 Diskussion der Ansätze und Auswahl des Bewertungsansatzes
4.7 Vermiedene Fahrten unter Fahrdraht
4.8 Sonstige Zusatznutzen
4.8.1 Autarkiekosten
4.8.2 Fahrkomfort
5 Beispielrechnungen
5.1 Erläuterungen zu den Beispielrechnungen
5.2 Elektrifizierung der Hochrhein-Strecke der Regio-S-Bahn Basel
5.2.1 Anpassung an den aktuellen Stand des Regelverfahrens
5.2.2 Bewertung nach dem Regelverfahren
5.2.3 Bewertung der Elektrifizierung
5.2.4 Vergleich der Bewertungsergebnisse
5.3 Zwischenstufe der Breisgau-S-Bahn
5.3.1 Maßnahmenbeschreibung
5.3.2 Bewertung nach dem Regelverfahren
5.3.3 Bewertung der Elektrifizierung
5.3.4 Vergleich der Bewertungsergebnisse
5.4 Nutzung der Brenzbahn als Umleitungsstrecke
5.5 Gewonnene Erkenntnisse
6 Auswirkungen der ergänzenden Bewertung
7 Zusammenfassung
Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Karte der nicht-elektrifizierten Eisenbahnstrecken in Baden-Württemberg
Abbildung 2: Energieträgeranteile an der Stromerzeugung im Jahr 2005
Abbildung 3: Energieträgeranteile an der Bahnstromerzeugung im Jahr 2005
Abbildung 4: Energieträgeranteile an der Stromerzeugung im Jahr 2020
Abbildung 5: Energieträgeranteile an der Bahnstromerzeugung im Jahr 2020
Abbildung 6: Energieträgeranteile an der Stromerzeugung in den Jahren 2000 bis 2030
Abbildung 7: Zusammensetzung des Industriestrompreises im Jahr 2005
Abbildung 8: Zusammensetzung des Industriestrompreises im Jahr 2012
Abbildung 9: Entwicklung des Preisbestandteils für Erzeugung, Transport und Vertrieb von Industriestrom
Abbildung 10: Prognostizierte Steigerungen des Industriestrompreises 2005 bis 2020
Abbildung 11: Strompreisprognose (nominal)
Abbildung 12: Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland
Abbildung 13: Bestandteile des Dieselkraftstoffpreises
Abbildung 14: Dieselkraftstoffpreis in den Jahren 2005, 2008 und 2012
Abbildung 15: Erzeugerpreisindex für Dieselkraftstoff
Abbildung 16: Strompreisprognose
Abbildung 17: Vergleich der Prognose von Strom- und Dieselpreisindizes
Abbildung 18: Schalldruckpegel in Abhängigkeit der Zuggeschwindigkeit
Abbildung 19: Übersichtskarte Stuttgart – Augsburg
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Liste der nicht-elektrifizierten Strecken in Baden-Württemberg
Tabelle 2: Kategorisierung der nicht elektrifizierten Strecken
Tabelle 3: Anteile der Energieträger an der Stromerzeugung
Tabelle 4: Grundlagen der Einzelpreisprognosen der Energieträger
Tabelle 5: Bestimmtheitsmaße der Modell- und Trendprognosen des Erzeugerpreisindex von Strom bei Abgabe an gewerbliche Anlagen
Tabelle 6: Eingangsdaten der Fahrzeitenberechnung
Tabelle 7: Vergleichsrechnung der Fahrzeiten mit RB-Halten
Tabelle 8: Eingangsdaten der Vergleichsrechnung zum Energiebedarf
Tabelle 9: Vergleichsrechnungen zum Energiebedarf
Tabelle 10: Unterhaltungskostensätze der Standardisierten Bewertung für lokbespannte Züge
Tabelle 11: Unterhaltungskostensätze der Standardisierten Bewertung für Nahverkehrstriebwagen
Tabelle 12: Energiekosten lokbespannter Züge in der Standardisierten Bewertung
Tabelle 13: Energiekosten von Nahverkehrstriebwagen in der Standardisierten Bewertung
Tabelle 14: Teilindikatoren, Bewertungsansätze und Methodik
Tabelle 15: Nominale Fortschreibung der Energiekostensätze
Tabelle 16: Fortschreibung der Energiekostensätze zum Preisstand 2006
Tabelle 17: Ansätze zur Bewertung von Kohlendioxid- und Schadstoffemissionen im Vergleich
Tabelle 18: Wertansätze für Kohlendioxid- und Schadstoffemissionen im Vergleich
Tabelle 19: Mengen- und Wertansätze der Emissionen elektrischer Energie im Szenarienvergleich
Tabelle 20: Dieselverbrauchsspezifische Emissionsraten
Tabelle 21: Mengen- und Wertansätze für Emissionen im Vergleich der Bewertungsverfahren
Tabelle 22: Mengen- und Wertansätze für Emissionen zur Bewertung der Elektrifizierung
Tabelle 23: Grenzwerte der TSI Lärm
Tabelle 24: Fahrzeitvergleich für die beispielhafte Berechnung einer Kapazitätserhöhung
Tabelle 25: Energiebedarfssätze für Regelpersonenfernverkehrszüge
Tabelle 26: Energiebedarfssätze für Regelgüterzüge
Tabelle 27: Standardisierte Bewertung der Regio-S-Bahn (dem aktuellen Verfahrensstand angepasst)
Tabelle 28: Beispielrechnung zur Bewertung der Elektrifizierung der Regio-S-Bahn
Tabelle 29: Vergleich der Bewertungsergebnisse für die Regio-S-Bahn
Tabelle 30: Bewertungsergebnisse für die Regio-S-Bahn im Detail
Tabelle 31: Standardisierte Bewertung der Zwischenstufe der Breisgau-S-Bahn
Tabelle 32: Beispielrechnung zur Bewertung der Elektrifizierung der Breisgau-S-Bahn
Tabelle 33: Vergleich der Bewertungsergebnisse für die Zwischenstufe der Breisgau-S- Bahn
Tabelle 34: Vergleich der Bewertungsergebnisse für die Zwischenstufe der Breisgau-S- Bahn im Detail
Tabelle 35: Umleitung im Ohnefall
Tabelle 36: Umleitung im Ohnefall alternativ
Tabelle 37: Umleitung im Mitfall
Tabelle 38: Gesparte Reisezeiten im Ohne- und Mitfall
Tabelle 39: Streckenbezogene Bewertungssätze für eine exemplarische Zugfahrt
Tabelle 40: Zusätzliches Nutzenpotenzial der Dieselstrecken in Baden-Württemberg bei Elektrifizierung
1 Einführung
1.1 Aufgabenstellung
Das elektrifizierte Streckennetz in Baden-Württemberg wird durch dieselbetriebene Strecken ergänzt. Einige der dieselbetriebenen Strecken weisen aus unterschiedlichen Gründen Potenziale für eine Elektrifizierung auf, die in der Regel jedoch erhebliche Investitionskosten verursacht.
Die Haushaltsordnung des Landes Baden-Württemberg verlangt für alle finanzwirksamen Maßnahmen angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Für Investitionen in ÖPNV-Projekte erfolgt diese Untersuchung in der Regel mit einem bewährten Verfahren, der „Standardisierten Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des ÖPNV“. Die Anwendung dieses Verfahrens ist grundsätzlich auch für den Nachweis „der Wirtschaftlichkeit“ von Investitionen zur Elektrifizierung von Bahnstrecken möglich. Allerdings werden dabei nicht alle Nutzen einer solchen Investition berücksichtigt. Dies betrifft beispielsweise auch die Wirkung von Elektrifizierungsmaßnahmen auf den Bahnbetrieb im überregionalen Schienenstreckennetz Baden-Württembergs.
Zum Nachweis der Elektrifizierungswürdigkeit von Bahnstrecken bedarf es daher eines spezifischen Bewertungsverfahrens, welches die Unterschiede zwischen den Traktionsarten aufgreift. Auf Basis des Verfahrens der „Standardisierten Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des ÖPNV“1 wird ergänzend ein kompatibles, einfach handhabbares Bewertungsverfahren zum Nachweis der Elektrifizierungswürdigkeit erstellt. Dieses Verfahren basiert auf der Grundlage der volkswirtschaftlichen Nutzen-Kosten-Analyse und umfasst betriebliche, ökologische, verkehrliche und wirtschaftliche Aspekte, welche für die Unterscheidung zwischen den Traktionsarten erforderlich sind.
Im Vordergrund der Arbeiten stehen dabei Ergänzungen zum Verfahren der Standardisierten Bewertung, die es ermöglichen, über die im Rahmen einer räumlich sehr eng abgegrenzten, maßnahmenbezogenen Nutzen-Kosten-Untersuchung hinausgehende Nutzeneffekte einzubeziehen, zu quantifizieren und – nach Möglichkeit – zu monetarisieren.
1.2 Problemstellung und Zielsetzung
1.2.1 Anwendungsbereich der Standardisierten Bewertung
Wird vom Träger eines Investitionsvorhabens im ÖPNV die Förderung durch die öffentliche Hand – genauer: durch den Bund – beantragt, so ist die Förderwürdigkeit des Vorhabens durch eine Bewertungsrechnung nach den Vorgaben der Standardisierten Bewertung nachzuweisen. Die Standardisierte Bewertung ist dabei auf solche Vorhaben anzuwenden, deren investiver Aufwand einen Betrag von 25 Millionen Euro überschreitet.
Für Fördermittel die aus dem Landesprogramm des Landes Baden-Württemberg beantragt werden, ist das Verfahren bereits auf Vorhaben mit einer Investitionssumme von mehr als 10 Mio. Euro anzuwenden.
Die Anwendung des Verfahrens erstreckt sich auf alle Vorhaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und § 11 GVFG. Dies sind:
Der Bau oder Ausbau von Verkehrswegen der
Straßenbahnen, Hoch- und Untergrundbahnen sowie Bahnen besonderer Bauart,
Nichtbundeseigenen Eisenbahnen
Soweit sie dem öffentlichen Personennahverkehr dienen, und auf besonderem Bahnkörper geführt werden
Vorhaben der Eisenbahnen des Bundes, die der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden dienen.
Demnach werden sowohl Vorhaben des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs als auch Vorhaben des Schienenpersonennah- und -regionalverkehrs vom Anwendungsbereich der Standardisierten Bewertung erfasst.
1.2.2 Erfahrungen aus der Anwendung der Standardisierten Bewertung
Mit dem Regelverfahren der Standardisierten Bewertung werden Auswirkungen einer Infrastrukturmaßnahme auf die Nutzer des ÖPNV, auf den Betreiber und auf die Allgemeinheit untersucht und monetär bewertet. Erfahrungsgemäß resultiert ein Großteil des gesamtwirtschaftlichen Nutzens aus der Verlagerung von Fahrten des motorisierten Individualverkehrs (MIV) zum ÖPNV. Die Verkehrsverlagerung wird aus einem Verkehrsmodell heraus bestimmt. Eine Verkürzung der Reisezeiten im ÖPNV auf ein Niveau unterhalb der MIV-Reisezeiten ist entscheidend dafür, dass der Anteil des ÖPNV an der Verkehrsleistung – der Modal Split – steigt. Die Reisezeit im ÖPNV bestimmt sich im Wesentlichen aus der Systemzugangszeit und aus der Beförderungszeit. Eine Fahrzeitverkürzung ist demnach nicht unbedingt erforderlich; auch eine Taktverdichtung vermag die Reisezeit spürbar zu reduzieren.
In der gesamtwirtschaftlichen Bewertung führt eine Verlagerung von Verkehrsleistungen zum ÖPNV nicht nur zu einer Senkung der unmittelbaren Pkw-Betriebskosten, sondern auch auf die Allgemeinheit bezogen zu einer Reduktion der Unfallkosten und der bewerteten Kohlendioxid- und Schadstoffemissionen.
Gerade auf Nebenbahnen mit vergleichsweise niedrigen Entwurfsgeschwindigkeiten ist davon auszugehen, dass mit elektrischen Fahrzeugen nur geringe Fahrzeitpotenziale gegenüber Dieselfahrzeugen zu erzielen sind; dies gilt insbesondere für Triebwagen.
Bleibt bei einer Elektrifizierungsmaßnahme das Verkehrsangebot konstant, ändern sich die Systemzugangszeiten ebenfalls nicht. Weil sich die Reisezeiten tendenziell nur in geringem Maße reduzieren lassen, entfällt angesichts geringer Verlagerungspotenziale ein wesentliches Argument für die Vornahme der Maßnahme. Monetär bedeutet dies, dass ein verkehrlicher Nutzen zu erwarten ist, der den investiven Aufwand für die Elektrifizierung unter den Voraussetzungen und Bedingungen des Regelverfahrens unter Umständen nicht rechtfertigen kann.
1.2.3 Zielsetzung
Für eine Elektrifizierung von Dieselstrecken können gute Argumente sprechen, auch wenn diese bewertungstechnisch bisher nicht erfasst sind, z. B. weil das Bedienungsangebot unverändert bleibt und Veränderungen des Modal Split über ein geringfügiges Maß hinaus nicht zu erwarten sind. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, diese Argumente zu sammeln und in einer Form aufzubereiten, die den Einsatz innerhalb eines Bewertungsverfahrens in Analogie zum Regelverfahren der Standardisierten Bewertung erlauben.
Das Bewertungsverfahren soll auch Erkenntnisse zur perspektivischen Entwicklung elektrischer Antriebe und der Rahmenbedingungen ihres Einsatzes berücksichtigen. Grundlegende Erkenntnisse aus diesem Verfahren sollen Anwendung auf die nichtelektrifizierten Eisenbahnstrecken in Baden-Württemberg finden, so dass eine grobe Abschätzung der zusätzlich zu erzielenden Nutzen vorgenommen werden kann.
1.2.4 Vorgehensweise
Der vorliegende Bericht beschreibt zunächst Argumente, die für eine Elektrifizierung von Strecken sprechen. Darauf folgt eine Übersicht der nicht-elektrifizierten Strecken des Landes Baden-Württemberg.
Die Zukunftsfähigkeit des elektrischen Betriebs ist Gegenstand eines eigenen Kapitels. Insbesondere werden die Entwicklung des elektrischen Energiemixes sowie die Preise für Strom und Dieselkraftstoff beleuchtet.
Aus den Argumenten für eine Elektrifizierung wird das elektrifizierungsspezifische Bewertungsverfahren hergeleitet. Es ist so konzipiert, dass es auf dem Verfahren der Standardisierten Bewertung aufbaut und einige Merkmale der Standardisierten Bewertung weiterentwickelt.
Seinen Ausgangspunkt nimmt das Verfahren in bisher wenig oder überhaupt nicht betrieblich erfassten Aspekten der Elektrifizierung wie
der Nutzung von Lückenschlussfunktionen und Durchbindungsmöglichkeiten als Netzverknüpfung,
der Nutzung als Umleitungsstrecke im Störungsfall sowie
der Nutzung von Mitbedienungsmöglichkeiten von Reststreckenabschnitten zur Realisierung umlaufbedingter Einsparpotentiale.
Aus dieser Betrachtung heraus werden zunächst Nutzenbeiträge identifiziert, die teils als eigenständige Teilindikatoren mit eigenen Teilmengen- und -wertgerüsten in die Bewertung aufzunehmen sind, und teils innerhalb des Verfahrens durch eine Erweiterung des Mengengerüsts abzubilden sind.
Darüber hinaus werden zusätzliche Nutzenkomponenten durch eine Überarbeitung der Mengen- und Wertansätze, die auch im Regelverfahren Anwendung finden, in die Bewertung eingebracht. Hierbei werden zukünftige Verschiebungen im Preisgefüge von elektrischer Energie und Dieselkraftstoff antizipiert. Gleichzeitig sind auch die energiebezogenen Emissionsfaktoren betroffen.





























