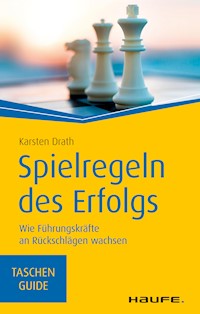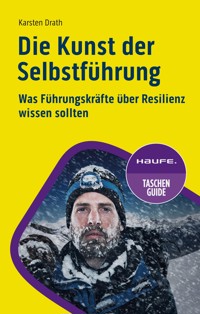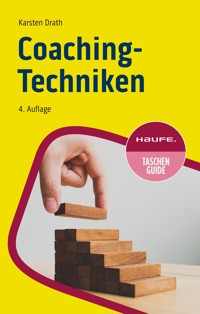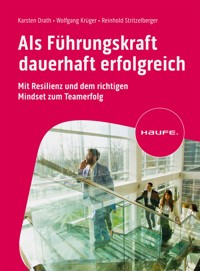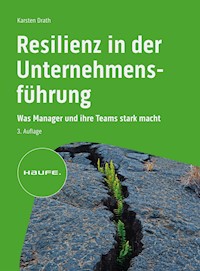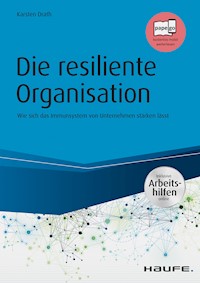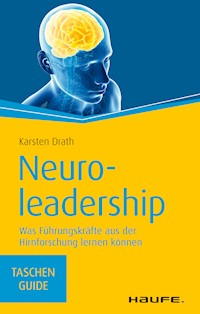
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe TaschenGuide
- Sprache: Deutsch
Hirngerechte Führung macht das Arbeitsleben leichter, sowohl für die Führungskraft als auch für die Mitarbeiter. Nur wer sich wohlfühlt und auf richtige Weise gefordert wird, ist dauerhaft produktiv und motiviert. Dieser TaschenGuide erklärt Ihnen, wie Sie die neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaft in der Führungsarbeit optimal einsetzen. Aktivieren Sie Ihre Mitarbeiter, schaffen Sie mehr Mut für Veränderungen und erreichen Sie eine höhere Produktivität. Inhalte: - Mitarbeiter besser verstehen: Arbeitsweise und Denkstrukturen des Gehirns - Neurowissenschaftlich erwiesen: Irrtümer und Fakten über Führung - Hirngerecht führen: Wie Sie den neurobiologischen Grundbedürfnissen Ihrer Mitarbeiter Rechnung tragen - Negativen Stress vermeiden: Wie Sie hirngerechte Führung im Alltag erfolgreich praktizieren
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum Urheberrecht
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print: ISBN: 978-3-648-07135-9 Bestell-Nr.: 10714-0001ePub: ISBN: 978-3-648-07136-6 Bestell-Nr.: 10714-0100ePDF: ISBN: 978-3-648-07137-3 Bestell-Nr.: 10714-0150
Karsten Drath Neuroleadership – Was Führungskräfte aus der Hirnforschung lernen können
1. Auflage 2015, Freiburg
© 2015, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Straße 9, 79111 FreiburgRedaktionsanschrift: Fraunhoferstraße 5, 82152 Planegg/MünchenTelefon: (089) 895 17-0Telefax: (089) 895 17-290Internet: www.haufe.deE-Mail: [email protected]: Jürgen FischerRedaktionsassistenz: Christine Rüber
Konzeption, Realisation und Lektorat: Nicole Jähnichen, www.textundwerk.de
Satz und Druck: Beltz Bad Langensalza GmbH, 99947 Bad LangensalzaUmschlag: Kienle gestaltet, Stuttgart
Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.
Bildnachweis: Wesentliche funktionale Systeme des Gehirns: fotolia © natav / Lernerfolg in Abhängigkeit vom Lebensalter: Christian Elger, Vortrag ICF-Konferenz „Neuro-Leadership“ (2013)[2]
Vorwort
Wie funktioniert unser Gehirn? Wie „ticken“ Menschen wirklich? Die Antworten auf diese Fragen sind nicht nur für Wissenschaftler interessant. Kein Wunder also, dass die Hirnforschung immer populärer und einflussreicher wird. Dabei geht es nicht nur um medizinische Bereiche. Mittlerweile erlangen die Neurowissenschaften auch immer mehr Bedeutung im Unternehmenskontext. Sie helfen mit ihren Erkenntnissen überall dort, wo es darum geht, sich selbst und andere Menschen besser zu verstehen.
Führungskräfte können dabei besonders vom Wissen der Hirnforscher profitieren. Wer weiß, wie das Gehirn funktioniert, und die neurobiologischen Grundbedürfnisse der Menschen kennt und auf sie eingeht, kann seine Mitarbeiter und Teams hirnorientiert und damit besser führen.
Dieser TaschenGuide zeigt Führungskräften, welche Vorteile Neuroleadership, die hirngerechte Führung, tatsächlich bietet. Er räumt mit alten Vorurteilen rund um die Mitarbeiterführung auf und weiht leicht verständlich ein in die Geheimnisse des Gehirns. Zahlreiche Checklisten, Übersichten und Beispiele verdeutlichen, wie dieses Wissen in die Führungspraxis umgesetzt werden kann.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen
Karsten Drath
Von der Hirnforschung zur optimalen Führung
Wie gerne würden wir in den Kopf anderer blicken, um deren Handeln und Denken besser verstehen zu können. Wie hilfreich wäre es zu verstehen, was sie wirklich antreibt. Die Neurowissenschaften versprechen, genau dies möglich zu machen. Sie liefern Erkenntnisse, die sich vor allem Führungskräfte zunutze machen können.[3]
In diesem Kapitel erfahren Sie u. a., warum
Führungskräfte von der Hirnforschung profitieren,
die Neurowissenschaften immer populärer werden,
hirnorientiertes Führen Unternehmen erfolgreich macht.
Neuroleadership: neues Führungsprinzip mit viel Potenzial
Wir leben in einer Zeit, in der globale Märkte immer transparenter werden und leistungsfähige Mitarbeiter sich jederzeit zwischen zahlreichen attraktiven Unternehmen entscheiden können. Daher werden vermeintlich weiche Faktoren wie gute Führung und eine angenehme Unternehmenskultur immer bedeutsamer für die Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation und damit für den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Doch was ist eigentlich objektiv „gut“, wenn es um das Anleiten von Mitarbeitern geht?
Nicht nur graue Theorie
Was Führungsprinzipien anbelangt, waren verschiedenste Vordenker in den letzten Jahrzehnten sehr kreativ. Im Angebot sind autoritäre oder transaktionale, demokratische, partizipative oder gar dienende Stile, Laissez-faire-Führung bzw. situative oder gar sog. transformationale Ansätze. Alle Konzepte versprechen eine Steigerung von Produktivität, Effektivität und Innovationsfähigkeit. Alle waren zu einer gewissen Zeit modern. Doch objektiv nachweisbar waren die versprochenen positiven Effekte dieser Führungsstile zumeist nicht.
Wissenschaftlich belegbar ist hingegen der Ansatz von Neuroleadership – ins Deutsche übersetzt: hirngerechtes oder hirnorientiertes Führen. Er fußt auf den immer mehr im Fokus stehenden Neurowissenschaften. Diese erfreuen sich nicht nur zunehmender Beliebtheit, sondern sie geben uns auch die Möglichkeit, tiefer in das menschliche Gehirn zu blicken, um die tatsächlichen hirnbiologischen Grundlagen guter Führung zu verstehen.[4]
Und die Erwartungshaltung ist groß. So schreiben nach einer Umfrage aus dem Jahr 2015 unter 218 internationalen Führungskräften und Coaches spektakuläre 96 % den Neurowissenschaften die Fähigkeit zu, relevante Erkenntnisse darüber zu liefern, wie Mitarbeiter optimal geführt werden sollten. Ein großer Anteil der Studienteilnehmer wäre sogar bereit, sein Führungsverhalten gemäß den Erkenntnissen der Hirnforschung in hohem bzw. sehr hohem Maße anzupassen, um dadurch eine bessere Führungskraft zu werden. Die Frage ist nur: Wie geht das?
Was gutes Führen mit dem Unternehmenserfolg zu tun hat
Doch eins nach dem anderen: Macht gute Führung Unternehmen überhaupt erfolgreich? Schließlich gibt es auch genug Unternehmen, die sich trotz eher schlechter Führung am Markt behaupten können. Es leuchtet zwar ein, dass sich gute Führung positiv auf die Mitarbeiter auswirkt. Viele Manager zweifeln jedoch daran, dass sie messbaren Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat.
Ein entsprechendes Indiz dafür kommt von der Harvard Business School, die ziemlich unverdächtig ist, wenn es darum geht, die Gesetze der freien Marktwirtschaft zu bejahen. In einer Studie aus dem Jahr 1998 wurde dort erstmals gezeigt, dass die US-amerikanischen Unternehmen mit der besten Aktienperformance bestimmte Führungsprinzipien beachten:[5]
Sie wechseln ihre Mitarbeiter nicht in Hire-and-Fire-Manier aus, sondern betreiben ein langfristiges Personalmanagement.
Sie setzen auf Dezentralisierung, flache Hierarchien und Transparenz.
Sie fördern Selbstmanagement bei ihren Mitarbeitern und investieren in die Weiterbildung.
Diese Prinzipien decken sich zu einem beachtlichen Teil mit den Grundlagen hirngerechter Führung, wie ich später noch zeigen werde.
Ein weiteres Indiz kommt aus dem Bertelsmann-Konzern, der mit einem Umsatz von über 16 Milliarden Euro eines der weltweit größten Medienunternehmen ist. Bei einer Untersuchung der Profitabilität der 163 größeren Tochterfirmen im Jahr 2007 stellte sich heraus, dass die Firmen mit einer stark ausgeprägten partnerschaftlichen Führung und einer hohen Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen die beste Umsatzrendite aufwiesen. Beide Faktoren sind mit dem Konzept der hirngerechten Führung eng verknüpft.
Zusammenhang zwischen Umsatzrendite und Führungsstil
Es gibt also durchaus Grund zu der Annahme, dass eine Führungskultur, die die neurobiologischen Grundbedürfnisse von Mitarbeitern bewusst oder unbewusst berücksichtigt, gleichzusetzen ist mit guter Führung, was langfristig auch zu finanziellem Erfolg führt.
Warum Sie Mitarbeiter hirngerecht führen sollten
Führungskräfte führen keine Unternehmen, sie führen Menschen. Was wie eine Binsenweisheit klingt, ist in vielen Firmen weit von der betrieblichen Realität entfernt. Das ist bedauerlich, denn dadurch bleibt eine Menge an Potenzial ungenutzt und wird teilweise unnötig verschlissen. Tatsächlich ist die Führung von Menschen der schwierigste Teil der Arbeit eines Managers – und gleichzeitig der am meisten unterschätzte. Die Art der Führungskultur beeinflusst nachweislich signifikant das Maß an Identifikation der Belegschaft mit den Unternehmenszielen. Dieses Engagement der Mitarbeiter erklärt dabei bis zu 30 % der Unterschiede im Erfolg verschiedener Unternehmen, wie Studien zeigen. Ein hohes Maß an emotionaler Identifikation mit dem eigenen Unternehmen resultiert in einer geringeren Zahl von Krankheitstagen, in verminderter Fluktuation sowie in höherer Leistungsfähigkeit und Arbeitsqualität. Auch die Kundenzufriedenheit ist deutlich höher bei Unternehmen, deren Mitarbeiter eine starke Bindung zur Firma haben.[6]
Neuroleadership schafft Vertrauen und Identifikation
In Deutschland empfinden laut einer Untersuchung des Gallup-Instituts aus dem Jahr 2013 nur 15 % aller Beschäftigten eine starke Bindung zu ihrem Unternehmen. 61 % haben dagegen eine mittelmäßige und 24 % haben keinerlei emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen. Das bedeutet, dass statistisch gesehen knapp ein Viertel der Belegschaft eines Unternehmens bestenfalls Dienst nach Vorschrift macht.
Es besteht kein Zweifel daran, dass die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen zusammenhängt mit dem Führungsverhalten des Vorgesetzten. Schließlich folgen Menschen keinen Rollen oder Funktionen, sondern Menschen, die sie respektieren und denen sie vertrauen. Viele Manager sehen sich dabei selbst als Opfer des Systems „Unternehmen“, das sie willentlich oder unwillentlich dazu bringt, sich entgegen ihren eigenen Überzeugungen zu verhalten. Dies mag teilweise zutreffen, sollte aber nicht als Entschuldigung dafür dienen, die Gestaltungsspielräume, die man als Führungskraft hat, nicht zu nutzen. Viele Manager, mit denen wir im Coaching arbeiten, verwenden viel Zeit und Energie darauf, sich über die Faktoren zu beklagen, die sie nicht beeinflussen können. Sie vergessen darüber, die Spielräume zu nutzen, die sie in der Tat haben.[7]
Genau dort setzt hirnorientierte Führung an. Bei Neuroleadership geht es darum, eine Balance zu finden zwischen einer positiven Beziehungsgestaltung, verstehender Zuwendung und Unterstützung einerseits und fordernder Führung mit anspruchsvollen Zielen, offener Kommunikation sowie klaren Regeln und Erwartungen andererseits. Dies klingt kompliziert, ist es aber nicht, wenn man die einfachen Prinzipien dahinter versteht.
Die Neurowissenschaften: Hype oder Heilsbringer?
Keine Frage, Hirnforschung und Neurobiologie sind in aller Munde und hip. Die Neurowissenschaften wurden in den letzten Jahren zum Teil der Popkultur. Hirnforscher schreiben populärwissenschaftliche Bücher, plaudern in Talkshows und sprechen vor großem Publikum über ihre Erkenntnisse zum menschlichen Gehirn und die diversen Paradigmenwechsel, die diese in Bereichen wie Marketing, Verkauf oder Führung zur Folge haben werden. Das Ganze wird flankiert von tollen bunten Bildern, die hochwissenschaftlichen Apparaten entstammen und, zugegebenermaßen, irgendwie cool und sehr glaubhaft aussehen. Von den Medien werden die neuen Erkenntnisse dank ihres hohen Unterhaltungswertes und der vermeintlichen empirischen Unantastbarkeit dankbar aufgenommen und publikumswirksam gepusht („Ist der freie Wille eine Illusion?“; „Depressionszentrum entdeckt!“), mitunter über die Grenzen der Wissenschaftlichkeit und selbst des gesunden Menschenverstandes hinaus. Die Zahl der Veröffentlichungen zum Thema Neurowissenschaften hat sich in der Zeit von 2000 bis zum Jahr 2010 nahezu verdoppelt.[8]
Warum man sehr genau hinsehen sollte
Bei näherem Hinsehen sind viele dieser Erkenntnisse, oder besser Deutungen, jedoch entweder an den Haaren herbeigezogen oder nicht neu und schon gar nicht bahnbrechend, was immer mehr Kritiker auf den Plan ruft. Schlimmer noch: Vielen in Versuchen gewonnenen Erkenntnissen über das Gehirn fehlt die statistische Belastbarkeit, auch Validität genannt. Das bekannteste Beispiel dafür ist wohl der „Salmon of Doubt“, der Lachs des Zweifels.